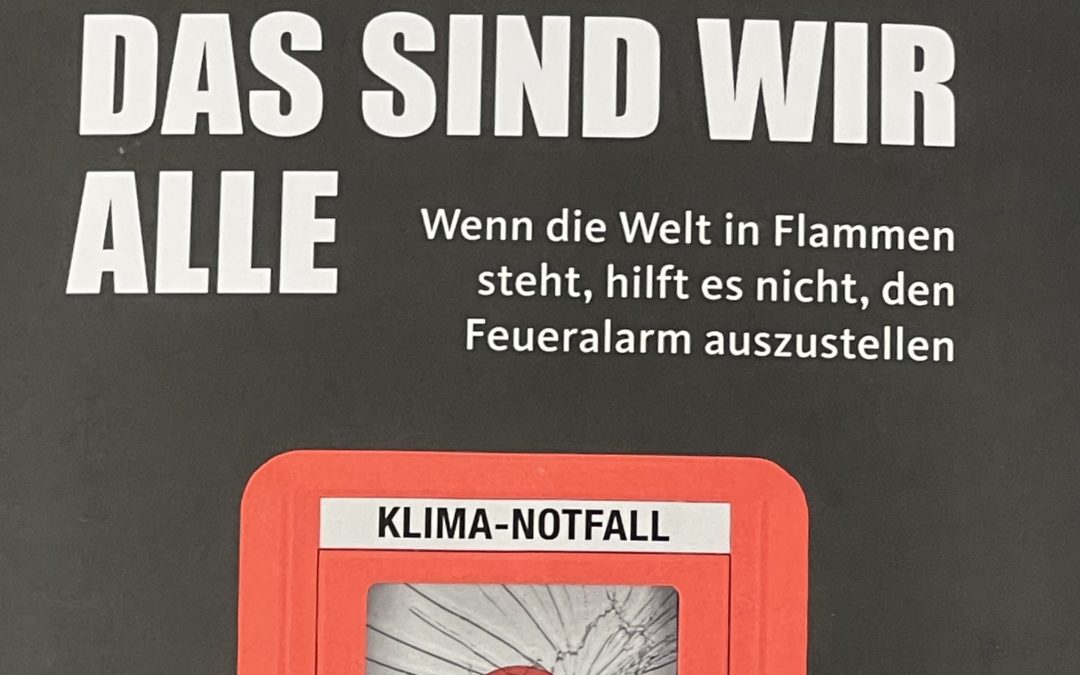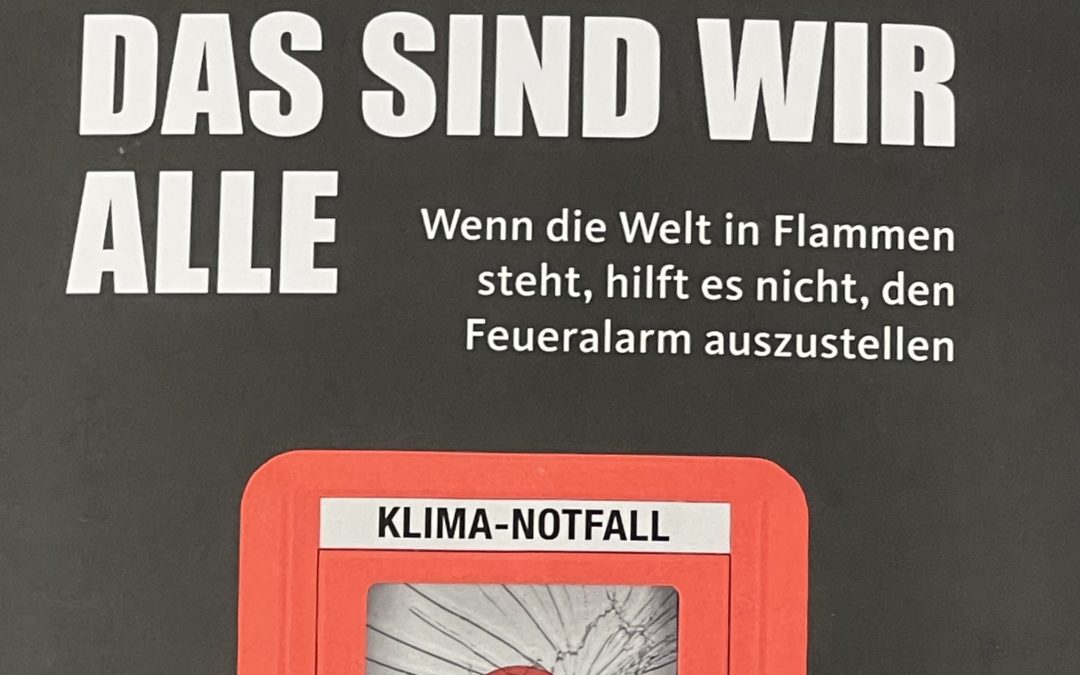
von Jan-Niklas Heil | 02.08.2023
Kurzer Einschub vorneweg
Diese Rezension befasst sich ausschließlich mit den im Buch vorkommenden Inhalten und bewertet nicht die politischen Botschaften oder das Auftreten der „Letzten Generation“ oder einzelner genannten Personen. Dies beruht auf der aktuellen Dynamik in der Debatte um die „Letzte Generation“ aufgrund des bestehenden Anfangsverdacht wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ und der damit einhergehenden Komplexität der Thematik. Dies führt dazu, dass es keine Stellungnahme zu den oben genannten Punkten geben wird, da ich mich nicht im Stande sehe eine, meiner Meinung nach, der Diskussion förderliche Positionierung zu äußern, da mir gerade bei der rechtlichen Betrachtungsweise das hierzu nötige Wissen fehlt. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen rund um die „Letzte Generation“ findet ihr hier.
Vom einem Jesuitenpater, einer Schülerin und einem Studenten
Eins wird gleich zu Beginn deutlich, Klimaschutz verbindet die unterschiedlichsten Menschen. Aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten kommen Menschen zusammen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In dem Buch geht es um drei Personen, die sich und ihr Leben der „Letzten Generation“ verschrieben haben. Es begleitet den Weg von Jörg Alt, Lina Eichler und Henning Jeschke hin zu den Klimaprotesten der „Letzten Generation“. Eingeleitet wird das Buch von den Vorstellungen der drei Protagonist*innen. Besonders hierbei ist die Konstellation in der die drei zueinander stehen. Während Jeschke und Eichler aktiv am Protest der „Letzten Generation“ teilnehmen ist Jörg Alt einer der Unterstützer*innen der „ Letzten Generation“. Besonders die Kontakte Alts in Politik und Welt sind es die später eine besondere Rolle spielen werden.
Mit dem ersten Worten des Buches wird aber auch eins deutlich. Dieses Buch wird nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der „Letzten Generation“ geben, sondern soll auch den Leser überzeugen. Mit Sachargumenten. Nicht mit einer emotionalen Botschaft oder sonstigen Gefühlsduseleinen, sondern mit der Wissenschaft. Immer wieder finden sich Erklärboxen auf den Seiten oder gehen gleich über mehrere. Besonders ist auch, dass es für dieses Buch ein eigenes Quellenverzeichnis gibt. Es ist der Leserin oder dem Leser also möglich sich von jeder Quelle nicht nur einen eigenen Überblick zu verschaffen, sondern gegebenenfalls eigene andere Schlüsse zu ziehen.
Alle Wege führen zum Reichstag
So richtig Fahrt nimmt das Buch in der Mitte auf. Hat man am Anfang noch die drei Protagonist*innen kennengelernt, so erfährt man jetzt, wie der Hungerstreik vor dem Reichstag abläuft. Dieser hatte zum Ziel, dass es ein Gespräch vor der Bundestagswahl 2021 mit dem Kanzlerkandidaten geben sollte. Vor allem aber lernt man die Geschehnisse hinter den Kulissen genauer kennen. So bekommt man nicht nur aus erster Hand mit, wie stark das Leid der Hungerstreikenden ist, sondern auch, wie sehr der Hungerstreik die Gruppendynamik kaputtgemacht hat. Es gibt in der Gruppe selbst immer mehr Zweifel, ob der Hungerstreik über eine so lange Zeit nicht doch ein zu hohes Risiko für das Leben der Streikenden darstellt. Besonders krass finde ich in diesem Zusammenhang, dass gerade bei dieser Aktion Weitsicht eine große Rolle spielt. So wird sich auf diesen Hungerstreik vorbereitet durch Training oder Gespräche mit Fachleuten, wie Ärzt*innen. Aber auch die Schilderungen der Veränderungen werden sehr eindrucksstark übermittelt. So schildert Henning Jeschke zum Bespiel einen stark gebesserten Geruchsinn und teilt rückblickend auf seine Vorbereitung folgende Erfahrung.
„Schon nach drei, vier Tagen Hungern wird der Geruchssinn richtig stark. In der Zeit bin ich noch mal mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, um etwas zu holen. Es war beeindruckend, in welcher Entfernung ich wie intensiv Essen roch, bei jeder Bäckerei aufs Neue.“
Seite 70 Mitte
Der Hungerstreik selbst wird aus den drei unterschiedlichen Perspektiven der Protagonist*innen geschildert. Hennig Jeschke und Lina Eichler, die sich im Hungerstreik befinden und Jörg Alt, der die Gespräche im Hintergrund führt, dabei seine Kontakte in die politische Welt nutzt und eher eine beobachtende Rolle einnimmt. Jeschke und Eichler schildern vor allem ihre Erfahrungen bezogen auf die physischen und psychischen Folgen des Hungerstreiks, aber auch und das ist besonders spannend, wie sich die Gruppe untereinander verhält. Welche Aufruhe herrscht, wenn das Telefon klingelt und die Gruppe hofft eins der erhofften Gespräche zu führen. Der Hungerstreik endet für die Gruppe zwiespältig. Zum einen gibt es Zusagen zu den Gesprächen und 300 neue Kontakte von Menschen, die sich der „Letzten Generation“ anschließen wollen, zum anderen stirbt Henning Jeschke beinahe. Auch der Gruppe als solche geht es nicht besonders gut. Lina Eichler selbst zieht folgendes Fazit über die Gruppe:
„Es ist so schade, dass wir da gemeinsam reingegangen sind, aber nicht als Gruppe rausgekommen sind.“
S. 79 Mitte
Besonders eins ringen mir diese Schilderungen beim Lesen ab. Respekt. Nicht dafür sein Leben zu riskieren, sondern an einer Überzeugung so lange festzuhalten unabhängig von den möglichen Konsequenzen. Das Buch schafft es hier nicht nur einen sehr guten Einblick in die einzelnen Akteure zu liefern, sondern auch einen besonders eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen der „Letzten Generation“ zu liefern. Vieles gab beim Lesen den Eindruck, dass man praktisch mit vor Ort war, da die Schilderung so voller Leben waren und mich persönlich auch sehr fesseln konnten.
Nach dem Hungerstreik
Nach den Schilderungen zum Hungerstreik verliert das Buch ein wenig den WOW- Faktor. Leider. Nachfolgend wird über verschiedene Sitzblockaden berichtet und auch darüber wie man Pipelines abdreht. Eine eher nicht so spannende Etappe in diesem Buch. Liegt aber hauptsächlich daran, dass man diese Ereignisse aus den Medien bereits kannte oder zumindest davon gehört hatte. Was aber besonders ab der zweiten Hälfte gut gelingt ist die Überzeugung selbst tätig zu werden. Es überwiegt hier für den*die Lesenden nicht mehr der Fokus auf einer großen Aktion der „Letzten Generation“, sondern es gibt viele kleine. Dafür wird aber besonders in der zweiten Hälfte deutlich, warum die drei Protagonist*innen handeln, wie sie handeln. Der Versuch die Lesenden von seinen Ansichten auf wissenschaftlichen Wege zu überzeugen wird besonders hier sehr deutlich.
Am Ende ist man immer schlauer
Besonders gegen Ende des Buches und besonders mit den Schlussworten von Angela Krumpen und von bene! Verlagsleiter Stefan Wiesner wird mir eins klar. Das Buch hat nicht an Spannung verloren. Ich habe nur nach den falschen Dingen gesucht. Dieses Buch gibt einem keinen „Blick hinter die Kulissen“ und soll einen so überzeugen. Es bietet um überzeugen zu wollen einen „Blick hinter die Kulissen“. Besonders im Kopf geblieben ist sind mir folgende Worte von Stefan Wiesner:
„Es gibt Bücher, die geschrieben werden müssen. Dieses Buch gehört definitiv dazu.“
Seite 184 unten
Natürlich sind das Worte, die jede Verlagsleitung über Bücher sagen sollte, die im eigenen Verlag veröffentlicht werden, allerdings merkt man gerade in diesem Schlusswort eine bloße Überzeugung in den Worten. Eine Überzeugung, die sich von Anfang bis Ende in jedem geschriebenen Wort des Buches wiederfindet.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der bene! Verlag uns ein Exemplar kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Das Buch gibt es für einen Preis von 18€ überall zu kaufen, wo es Bücher gibt.
Beitragsbild: Jan-Niklas Heil

von Lucas Hohmeister | 19.07.2023
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt es 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag zu gehen. Jedoch sitzen wir im Schnitt 8 bis 10 Stunden pro Tag und liegen auch gerne mal eine ganze Weile im Bett. Neben der Arbeit oder dem Studium dann noch darauf zu achten, jedes Mal eine bestimmte Anzahl an Schritten pro Tag erfüllen zu müssen, schreckt dahingehend viele Leute ab. Wenn man hingegen ohne jeglichen Zwang, irgendwas zu erfüllen rausgeht, egal für wie lange, dann ist man dem Ganzen schon weniger abgeneigt und kann das Ganze auch etwas mehr genießen. Man geht in diesem Fall lediglich zum Zeitvertreib raus und nicht, um irgendwelche Schrittzahlen voll zu kriegen. Das Ganze nennt sich dann spazieren gehen.
Ein Schritt in die richtige Richtung:
Ich bin früher als Kind oft mit meinem Vater eine Runde Spazieren gegangen, wenn das Wetter schön war. Heutzutage sind Spaziergänge jedoch eher eine Rarität in meinem Alltag geworden. Glücklicherweise haben wir beim webmoritz. ja unsere Kolumne „umgekrempelt”, bei der wir in einer Art Selbstexperiment versuchen unser Leben zeitweise in bestimmten Aspekten umzustellen. Im Vergleich zu anderen Beiträgen in der Kolumne ist spazieren gehen mit Sicherheit nicht ganz so eine große Lebensumstellung. Ich bin jedoch trotzdem der festen Überzeugung, dass es den Alltag in vielerlei Hinsicht bereichern kann. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort: „Ein Spaziergang am Tag hält den Körper fit und stark”. Okay, das Sprichwort hab ich mir ausgedacht, stimmen tut es aber trotzdem, denn tatsächlich soll spazieren gehen dazu beitragen den Kreislauf wie auch das Immunsystem zu stärken. Zudem werden Stresshormone durch Bewegung schneller abgebaut. Klingt doch alles in allem nach einem super „care package“, was man da vom Spazierengehen serviert bekommt. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem täglichen Spaziergang teile ich euch im Folgenden mit.
Ein Spaziergang ist jeden Schritt wert:
Ich habe versucht möglichst viele verschiedene Erfahrungen beim Spazierengehen zu sammeln und bin deshalb möglichst immer zu anderen Uhrzeiten losgegangen und habe auch immer andere Wege eingeschlagen. Einer der Wohl bekanntesten Zeitpunkte, um spazieren zu gehen, ist mit Sicherheit nach dem Essen. Das war tatsächlich früher auch schon immer der häufigste Anlass für mich, um einen Spaziergang zu machen und war auch als der berühmt berüchtigte Verdauungsspaziergang bekannt. Spazieren nach dem Essen ist vorteilhaft, da durch die Bewegung sowohl der Blutzucker im Körper stabilisiert wird, als auch die Verdauung angeregt wird. Auch diesmal bin ich öfters nach dem Essen rausgegangen. Abhängig davon wann man gegessen hat, ist draußen natürlich auch unterschiedlich viel los und man erlebt dahingehend auch jeweils immer andere Sachen. Das Ganze fängt bei den Personen an, die einem über den Weg laufen. Während es mittags öfters ein Rentnerpärchen ist, welches ebenfalls eine Runde durch die Nachbarschaft macht, sind es nachmittags dann schon eher die Kinder, die gerade von der Schule den Rückweg antreten. Abends sind es dann vermehrt die Studis, die geschafft von der Uni nach Hause gehen oder fahren.
Tags und nachts unterwegs:
Das Ganze hängt von der Uhrzeit ab, bei der man rausgeht. Uhrzeit ist auch ein gutes Stichwort, denn, wenn ich es mal zeitlich nicht geschafft habe, nach dem Essen spazieren zu gehen, dann habe ich den täglichen Spaziergang woanders hin verlagert. So war ich unter anderem auch schon früh morgens unterwegs und habe mir noch etwas die Beine vertreten, bevor ich meinen Termin beim Arzt wahrnehmen musste. Die Bewegung hat in jedem Fall geholfen, um schneller wach zu werden. Da ich keinen Kaffee trinke, war der kleine Spaziergang daher ganz passend, denn dadurch bin ich im Wartezimmer beim Arzt nicht direkt wieder eingeschlafen. Ganz früh morgens ist auf den Straßen auch noch nicht so viel los, was den Spaziergang insgesamt natürlich entspannter macht. Ich bin dem Berufsverkehr quasi gerade so noch entgangen, was das Ganze ziemlich stressfrei gemacht hat. Noch ruhiger ist es eigentlich nur nachts gewesen. Auch wenn ich den Nachtspaziergang nur einmal in der ganzen Woche gemacht habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es der idyllischste unter allen Spaziergängen war. Da nichts draußen los war, war der Spaziergang perfekt, um den Kopf frei zu kriegen und die übrig gebliebenen Alltagssorgen beiseite zu schieben.
Durchnässt und verirrt:
Eine weitere wichtige Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist, dass man manchmal doch mehr als nur seine eigenen zwei Beine braucht zum Spazierengehen. Es schadet beispielsweise nicht im Vorhinein mal einen Blick auf den Wetterbericht zu werfen. Ich hätte das wohl auch hin und wieder mal machen sollen. Die Quittung dafür, dass ich es nicht gemacht habe, habe ich dann kassiert, als ich bei einem abendlichen Spaziergang an einem Feldweg auf einmal von einem Regenschauer überrascht wurde. Ohne Regenschirm oder eine Möglichkeit sich irgendwo unterzustellen, entwickelte sich der gemütliche Spaziergang schnell zu einem 200 Meter Sprint zum nächstgelegenen Baum.
Was ich ebenfalls empfehlen kann, ist für alle Fälle immer ein Handy dabei zu haben. Für viele ist das wahrscheinlich sowieso schon selbstverständlich, da das Smartphone zur heutigen Zeit einen Dauersitzplatz in den Händen der meisten Leute hat. Ich habe bei meinen Spaziergängen aber möglichst immer versucht mein Handy zuhause zu lassen, um jegliche Ablenkungen beiseite zu schaffen. Wir hängen tagtäglich sowieso schon lang genug am Handy, da kann es nicht schaden, wenn man es auch einfach mal aktiv weg legt und sich anderen Dingen widmet. Der Grund, warum ich nun trotzdem empfehle gelegentlich ein Smartphone mitzunehmen, ist für den Fall, dass ihr euch verlauft. Wie ja bereits am Anfang angekündigt, hatte ich mir vorgenommen immer neue Wege einzuschlagen und das habe ich nach Möglichkeit auch gemacht. Jedoch kann es dann auch gerne mal vorkommen, dass man in komplett unvertraute Gegenden hineinspaziert. So fand ich mich zum Beispiel an einem sonnigen Nachmittag im Herzen von Greifswalds Industriegebiet wieder, ohne jegliche Idee, wie ich aus diesem wieder rauskommen sollte. Eventuell könnte ich das alles auch einfach auf meinen manchmal nicht existenten Orientierungssinn schieben. Jedenfalls wäre Google Maps mit Sicherheit eine gute Hilfe gewesen zu diesem Zeitpunkt. Man könnte sich natürlich auch im Vorhinein mit einer bestimmten Gegend vertraut machen, indem man sie sich auf diversen Karten oder im Internet schonmal anschaut, bevor man dorthin geht. Jedoch finde ich, dass es dem Spazierengehen etwas den Sinn wegnimmt, wenn man die komplette Route quasi vorher schon plant, da ein Spaziergang davon lebt, dass man komplett befreit und ohne irgendwelche anderen Intentionen rausgeht und die Umgebung genießt. Welchen Weg man genau einschlägt sollte mehr oder weniger instinktiv und auch zufällig ablaufen und weniger intentional oder bezweckt.
Mein Fazit:
Wie ihr vielleicht schon beim Lesen gemerkt habt, habe ich weder Schrittzahlen noch Zeiten genannt im Text. Wäre das hier ein Sportexperiment, dann wäre das mit Sicherheit auch angebracht gewesen, jedoch ist es das nicht. Wie bereits am Anfang gesagt, ist ein Spaziergang lediglich zum Zeitvertreib und zur Entspannung gedacht. Die positiven Nebeneffekte, die ein Spaziergang auf den Körper hat, nimmt man natürlich trotzdem gerne mit. Auch wenn es nur knapp eine Woche war, habe ich trotzdem gespürt, dass die tägliche Bewegung mir extrem gut tut. Für eine Person wie mich, die nicht gerne aktiv laufen oder joggen geht, ist spazieren gehen eine gute Alternative, um zumindest ein bisschen fit zu bleiben.
Neben den körperlichen Vorteilen, waren die Spaziergänge auch immer perfekt, um den Kopf frei zu kriegen und etwas Ablenkung vom Alltag zu bekommen. Wenn man sonst nur mit universitären Verpflichtungen zu kämpfen hat, dann tut es zwischendurch auch einfach mal gut, eine Runde spazieren zu gehen, um den Stress etwas zu reduzieren. Mir hat es jedenfalls sehr gut getan, einfach mal für eine gewisse Zeit an nichts denken zu müssen. Zeit ist ein gutes Stichwort, denn es kommt tatsächlich auch gar nicht darauf an, wie lange man spazieren geht. Ob es 15 Minuten, eine halbe Stunde oder zwei Stunden sind, ist komplett egal. Ein guter Spaziergang ist nicht abhängig von der Zeit, die man unterwegs ist, sondern von der eigenen Genugtuung, die man verspürt.
Ich hatte sehr viel Spaß mit meinen täglichen Spaziergängen und werde auch weiterhin versuchen mir jeden Tag etwas die Beine zu vertreten. Nur diesmal den Umständen entsprechend ausgestattet mit Regenschirm und Google Maps an meiner Seite, damit ich auf alles vorbereitet bin.
Beitragsbild: Lucas Hohmeister

von Laura Schirrmeister | 10.07.2023
Musik – Töne mit Zusammenhang, oder gerne auch ohne. Im Prinzip systematischer Krach. Jede*r hat schon mal Musik gehört, aber was ist die Geschichte hinter den einzelnen Stücken, auch Lieder genannt, und womit verbinden wir sie? Was lösen sie in uns aus und wer hat sie erschaffen? webmoritz. lässt die Pantoffeln steppen, gibt vor, was angesagt ist, und buddelt die versteckten Schätze aus. Unsere Auswahl landet in eurer moritz.playlist.
Menschen, die Musik wie blink-182, Box Car Racer, Thirty Seconds To Mars, Lostprophets, the Offspring oder American Hi-Fi hören, dürfte die Band Angels & Airwaves (kurz: ΛVΛ) nicht vollkommen unbekannt sein. Die ΛVΛ-Bandmitglieder spielten unter anderem in genau diesen genannten Bands. Der Frontsänger, Tom DeLonge, ist Gitarrist und Sänger der Bands blink-182 und Box Car Racer.
Doch auch Menschen, die weniger mit Skate-Punk, Pop-Punk oder Alternative Rock in Berührung gekommen sind, könnte die Band etwas sagen. Die beiden Songs Lifeline und Everything‘s Magic waren Teil des Soundtracks von Keinohrhasen, einem Film von Til Schweiger aus dem Jahre 2007. Auch in Schweigers 2011 erschienenen Film Kokowääh war mit Epic Holiday ein Song der amerikansichen Band zu hören. Damit wurden Angels & Airwaves in Deutschland ein wenig bekannter.
Spread Love Like Violence
ΛVΛ gründeten sich 2005 – kurz nach der Trennung DeLonges von blink-182. Bereits ein Jahr später erschien das erste Album We Don‘t Need To Whisper. Doch ΛVΛ machen nicht nur Musik, sondern auch Film- und Grafikprojekte. So erschien 2011 der von ΛVΛ produzierte Film Love, welcher Songs des gleichnamigen Albums enthält. Okay, eigentlich sind es zwei Alben: Love (2010) und Love: Part Two (2011). 2015 wurde dann das Projekt Poet Anderson veröffentlicht: Ein animierter Kurzfilm, ein Comic-Buch und – natürlich – das fünfte Studioalbum. 2021 hat die Band mit Lifeforms ihr bereits sechstes Studioalbum veröffentlicht. Zusätzlich erschienen drei EPs, darunter eine Acoustic EP mit Songs des ersten Albums.
Von dieser Acoustic EP – We Don’t Need To Whisper (Acoustic) – möchte ich den ersten Song für die moritz.playlist auswählen. Dieser Song ist The Adventure. Mit seinen positiven Lyrics ist das ein Song, den man immer wieder hören kann, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Die Message des Songs ist auch unmissverständlich: Genieß das Leben mit den wunderbaren Menschen, die es begleiten und die dich unterstützen. Zusätzlich ist es eine Akustikversion, was dem Ganzen nochmal einen anderen Blickwinkel (oder Hörwinkel?) gibt.
Finding A Light In A World Of Ruin
Besonders faszinierend finde ich die Andersartigkeit der Musik. Wobei sie gar nicht so andersartig ist. Der Stil ist bekannt – aus den späten 60ern bis frühen 70er Jahren. Space Rock. Progressive Rock mit ein wenig mehr 21. Jahrhundert – Neo-Progressive Rock. Eine angenehme Abwechslung.
Für mich persönlich beschreibt der Song Spellbound vom 2021 veröffentlichten Album Lifeforms den Stil am besten. Schwerelos, synthetisch, ein ruhiger Beat, aber äußerst stark. Es wird das Gefühl vermittelt, man höre Musik aus einer anderen Zeit.
Ein weiterer Faktor, der definitiv hineinspielt: Ich mag Tom DeLonges Stimme wirklich sehr. Während er sich bei blink-182 den Gesang mit Mark Hoppus teilt, ist bei ΛVΛ ausschließlich seine Stimme zu hören. Großer Pluspunkt für Angels & Airwaves.
Doch auch die Lyrics treffen den (meinen) Ton. Meist handeln die Songs von Liebe oder Krieg oder beidem. Weswegen die Alben Love und Love: Part Two vermutlich lange Zeit meine favorisierten Alben zwischen all den Bands, die ich so höre, waren. Man kann mitsingen oder einfach nur zuhören und nachdenken. Es funktioniert einfach. Die beiden Alben waren jedoch auch melodisch ein kleines Meisterwerk und haben mich doch ein wenig an Pink Floyd erinnert. Abgelöst wurden die Love-Alben in meiner Favoritenliste übrigens von Lifeforms.
„The music of Love. It’s like blending Radiohead and U2 together with these kind of Pink Floyd movements. Things happen unpredictably and take you to these epic soundscapes. It’s very much in the spirit of Angels & Airwaves, but it sounds way, way more thought-out and way more ambitious.“
Tom DeLonge über das Album Love
Hope When Things Get Dark
Einen Song, den ich ganz dringend noch in diesem Artikel einbauen möchte, ist All That’s Left Is Love. Veröffentlicht wurde der Song im April 2020, direkt zu Beginn der COVID-19-Pandemie. Das Video folgte im Juni 2020. Die Einnahmen der Single gingen an Feeding America, speziell an deren COVID-19 Relief Fund.
Abgesehen davon, dass der Song aufgrund der Spendenthematik einen sehr netten Hintergrund hat, ist er auch wieder einmal lyrisch und melodisch ein Fest. Die Band hat es sich schon sehr früh zur Aufgabe gemacht, Liebe und Hoffnung auszudrücken und auszusenden. Mit dem Fortschreiten der Pandemie ist das ein noch wichtigerer Faktor geworden. Mit All That’s Left Is Love haben ΛVΛ genau für diesen Zweck eine hervorragende Hymne erschaffen.
Den letzten Song für die moritz.playlist stellt Shove dar. Mit einer ähnlichen Botschaft wie schon The Adventure trifft auch dieser Song meinen Nerv. Außerdem kann man bei Shove hervorragend mitsingen. Hört gern aber auch in weitere Songs der Band hinein, denn die hier ausgewählten vier Lieder sind wirklich nur eine kleine Auswahl.
She said show me the world that’s inside your head.
Show me the world that you see yourself, you could use some help.
‚Cause sometimes it comes with a shove, when you fall in love.
Shove (2010)
Beitragsbild: Tanner Vonnahme auf Unsplash

von Clara Ziechner | 08.07.2023
Von vermeintlich ungesehenen Mitgliedern einer Gesellschaft und von einem Justizsystem, das die Augen verschließt, erzählt die Netflix-Miniserie »When They See Us« aus dem Jahr 2019. Um welches erschreckendes Fehlverhalten des US-amerikanischen Rechtswesens sich die Serie dreht und wie bewegend die Geschichte der »Central Park Five« wirklich ist, erfahrt ihr hier.
Zum CaMeTa-Staffellauf:
Dieser Artikel ist Teil des kollaborativen CaMeTa-Staffellaufs. Hintergrund sind die namensgebenden Campusmedientage, ein jährliches Treffen studentischer Medien aus ganz Deutschland. Aus dem Treffen heraus entstand dann auch der »Staffellauf«, eine Artikelreihe unter einem gemeinsamen Oberthema (dieses Mal: (Un-)Sichtbar). Die Reihe ist das Ergebnis der Zusammenarbeit aller teilnehmenden Redaktionen und der Weitergabe des »Staffelstabs«, die alle zwei Tage erfolgt. Bleibt auf dem neusten Stand und verfolgt das Projekt auf Instagram!
Wenn man die auf wahren Begebenheiten beruhende Serie zu schauen beginnt, wird man förmlich hineingeworfen in das New York dieser Zeit: belebt, ausgefallen, offen. Der Retro-Vibe der späten Achtzigerjahre ist ein schöner Moment der Ästhetik – der aber schnell verfliegt. Nachdem man die fünf jugendlichen Protagonist*innen der Geschichte kurz vorgestellt bekommt, hat man eine ungefähre Ahnung davon, wen man in den nächsten vier Folgen so begleiten wird. Antron liebt die Yankees, Kevin spielt Trompete, Korey glänzt in der Schule durch Abwesenheit und Raymond und Yusef sind mit ihren Freund*innen unterwegs. Fünf ganz normale Kids und fünf Leben, die sich nun zum ersten Mal kreuzen werden. Eine verhängnisvolle Nacht im April 1989 ist die Startszene der Handlung.
Zum Zeitpunkt des Beginns der Geschichte ist Spring Break, die New Yorker Schüler*innen haben also Ferien und das merkt man an der ausgelassenen Stimmung. Was die fünf Hauptfiguren gemeinsam haben, ist, dass sie an jenem Abend des 19. Aprils gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen im Central Park unterwegs sind. Wildin, wie sie es nennen. Also einfach raus, mal schauen, was so geht, und einfach eine gute Zeit zusammen haben. Ein paar der Kids pöbeln dann zum Teil auch Passant*innen an oder geraten in Raufereien, es wird jedoch schnell klar, dass die fünf, die man kennengelernt hat, sich in dieser Situation eher unwohl fühlen und sich ihr lieber entziehen. Sie alle waren an diesem Abend zufällig im Park. Trotzdem wird ihnen ihr Involvement ungerechterweise zum Verhängnis werden.
Am 19. April 1989 wird die damals 28-jährige Patricia Meili beim Joggen überfallen. Sie wird brutal angegriffen, sexuell missbraucht und so stark verprügelt, dass es einem Wunder gleicht, dass sie diese Nacht überlebt. Patricia war im Dunkeln unterwegs, in einer abgelegenen Ecke des Central Parks. Genau wie die fünf Jungs.
Nachdem die Schwerverletzte von der Polizei gefunden wurde, beginnen prompt die Ermittlungen. An dieser Stelle tritt eine weitere Figur in den Fokus der Serie: Staatsanwältin Linda Fairstein. Fairstein, sichtlich ambitioniert und erbarmungslos, fasst das Ziel, die oder den Verantwortliche*n für die schreckliche Tat so schnell wie möglich zu finden und so einen wichtigen Schritt gegen die wachsende New Yorker Kriminalität zu gehen. Da sich neben dem Verbrechen an der Joggerin zur gleichen Zeit auch die anderen Überfälle und Raufereien der Jugendlichen im Central Park ereigneten, gerieten diese (vor-)schnell ins Visier der Staatsanwältin. So landen die fünf Hauptfiguren in engen Verhörräumen und werden ohne die Anwesenheit eines*r Anwält*in und teils auch ohne ihre Eltern von skrupellosen Ermittler*innen in Gespräche verwickelt. Und nicht nur das, in der Folge dieser Verhöre entstehen auch falsche Geständnisse und Zeug*innenaussagen, weshalb gegen die fünf Jungs schließlich Anklage erhoben wird. Anschließend werden auch der Prozess und das Leben der »Central Park Five«, also der Angeklagten, nach dem Verfahren beleuchtet.
»The mother left, voluntarily?« – » Is it snowing? […] It suddenly feels like christmas.«
Detectives, über die Aussicht, die Minderjährigen ohne Aufsicht zu verhören (Folge 1)
Mein Eindruck
Wer mal wieder so richtig sauer sein möchte, schaut am besten diese Serie. Nicht, weil sie schlecht gemacht ist, sondern weil die unfassbare Ungerechtigkeit in diesem Fall zum Haareraufen ist. Dass die Minderjährigen in den Verdacht der Ermittlungen geraten, ist schwer nachvollziehbar, aber wie dann auch noch mit ihnen umgegangen wird, kann man wirklich nicht akzeptieren. Es entfalten sich Machtgefälle der übelsten Art und die Geschichte ist geprägt von Rassismus, unfairen Verhältnissen und unfähigen Detectives und Ankläger*innen.
Aus heutiger Perspektive ist die Serie, aufgrund dieser Missstände, fast körperlich schmerzhaft anzusehen, dieses Unrecht kaum vorstellbar. Aber das war das echte Leben von Antron McCray, Kevin Richardson, Korey Wise, Raymond Santana und Yusef Salaam. Für die fünf POC wurde dieses Fehlverhalten der Justiz folgenschwer und so verbrachten sie zwischen sechs und 14 Jahren in (Jugend-)Gefängnissen. Ohne Beweislast, nur ermöglicht durch die rassistische Willkür der Staatsanwaltschaft, wurde fünf jungen Menschen das Leben entzogen. Erst 2002 wurden sie aus der Haft entlassen und der Fall neu aufgerollt.
»You’ve been spoon-fed a story and you’re eating it up!«
Aktivist*in in Harlem (Folge 2)
In der Serie wird noch viel mehr betrachtet als dieser kurze Abriss der Geschichte und sie ist definitiv sehenswert. Die Besetzung der Figuren ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen und die Umsetzung der Story geht unter die Haut. Auch wenn es zeitweise wirklich schwer ist, das Unrecht mitanzublicken, und die über eine Stunde langen Folgen keine leichten Happen sind, bin ich der Ansicht, dass jede*r diese Serie gesehen haben sollte. Ich denke, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung rund um den Fall leisten kann. Auf Netflix gibt es auch die ergänzende Dokumentation »When They See Us Now« zu sehen, die einen Talk Show-Auftritt mit Oprah Winfrey abbildet. In dieser Sendung sind sowohl die echten »Central Park Five« vor Ort als auch die Schauspieler*innen, die sie in der Miniserie verkörperten, sowie andere Funktionär*innen der Produktion. Auch diese Sendung ist ein berührender Beitrag zu den Ereignissen und reflektiert über die Leben der Justizopfer.
»When They See Us« ist genau das Richtige für alle, die sich für wahre Verbrechen interessieren und auf hohem Level unterhalten werden wollen. Wer sowohl über die historischen Verhältnisse des Falls lernen möchte als auch erfahren will, wie die fünf zu Unrecht Verurteilten mit dieser Ungerechtigkeit umgehen, sollte die beiden Produktionen sehen. Die Geschichte der »Central Park Five« ist eine Geschichte über Wahrheit, Macht, das Kämpfen und die Bedeutung von Familie und Freund*innen in Zeiten, in denen man nicht aufgeben darf.
Beitragsbild: Tingey Injury Law Firm auf Unsplash

von Lilly Biedermann | 05.07.2023
In meiner ersten Greifswaldwoche habe ich sie noch genossen: die Rufe der Möwen. Sie klangen nach Urlaub an der Ostsee, Sommer und salziger Luft. Inzwischen habe ich gelernt, wozu die Urheber des Geschreis im Stande sind. Statt an Sommer und Urlaub denke ich jetzt nur noch an Angst und Aggressionen.
Meine Abneigung gegen Möwen basiert größtenteils auf zwei Erlebnissen. Das erste geschah in einem dunklen Corona-Winter, in dem der Bodden zugefroren war und die Mensa nur Essen zum Mitnehmen verkaufte. Als wäre es nicht schlimm genug, in der Prüfungszeit bei -20°C auf dem Beitz-Platz essen zu müssen, hatten die Möwen mitbekommen, dass es dort etwas zu holen gab. Nach nur wenigen Minuten sammelten sich immer mehr Möwen um mich und meine Pommes. Als ich ihnen mit einer fahrigen Handbewegung versehentlich eine Pommes hinwarf, stürzten sich so viele Möwen auf mein Essen, dass mir nichts als die Flucht blieb. Meine Pommes musste ich aus Selbstschutz zurücklassen.
Bei der zweiten Gruselbegegnung gab es sogar Tote. Also keine menschlichen, aber das macht es nicht weniger schlimm. Auf dem Parkplatz vor einem der Wohnheime flitzte eine Maus umher. Mir kam es schon recht unsicher für so eine kleine Maus vor, ohne Schutz auf dem Parkplatz unterwegs zu sein. Deshalb versuchte ich, sie ins Gebüsch zu bringen. Doch die Maus wollte nicht so ganz. Ich verabschiedete mich mit einem: „Pass auf dich auf, Maus“, und drehte mich kurz zu meinem Fahrrad, als ich auf einmal ein durchdringendes Piepsen hörte. Es war der Todespieps der Maus, die von drei Möwen zerrissen wurde. Als wäre ich nicht da, zerlegten die drei Vögel sie vor meinen Augen auf dem Parkplatz.
Diese zwei Geschichten stehen vermutlich exemplarisch für zahlreiche Möwen-Vorfälle in Greifswald. Aber es ist nicht nur meine persönliche Abneigung, es gibt fünf ganz rationale Gründe, warum Möwen die schlimmsten Vögel in Städten sind:
- Erstens sind sie riesig. Mit Tauben könnte ich mich noch anlegen und würde vielleicht gewinnen. Mit Spatzen sowieso. Aber Möwen – mit ihrem riesigen Schnabel können sie ernsthafte Verletzungen verursachen. Und bei der Flügelspannweite bräuchte es nur einen gekonnten linken Haken und ich würde zu Boden gehen.
- Zweitens sind sie Fleischfresser. Auch Tauben können nervig werden, wenn sie Brotkrumen wollen. Aber bei denen ist man sich wenigstens sicher, dass sie es auf das Brot abgesehen haben. Bei Möwen bin ich mir nie sicher, ob sie mein Fischbrötchen oder mich fressen wollen.
- Drittens sind sie skrupellos. Die Greifswalder Möwen haben jegliche Scheu vor Menschen verloren. Nicht, dass sie Angst vor uns haben müssten, wir haben keine Chance. Aber wie dreist sie Menschen angreifen, um an Futter zu kommen, finde ich schon beängstigend. Ich würde diesen Vögeln sogar zutrauen, Waffen unter ihren Flügeln zu verstecken.
- Viertens sind sie laut. Klar, auch die Spatzen, die ab vier Uhr morgens ihre Beziehungsprobleme vor meinem Fenster ausdiskutieren, könnten das leiser machen. Aber Möwen sind deutlich lauter und ihre Schreie haben nicht einmal etwas Melodisches. Möwenschreie können auch ganz komische Assoziationen bringen. Ich habe mal eine Möwe schreien gehört, bei der es klang, als ob eine Katze geschlachtet wird.
- Und fünftens verschmutzen sie die Stadt. Vielleicht wäre es mal eine Maßnahme, eine möwensichere gelbe Tonne einzuführen. Wie oft ich schon Möwen dabei beobachtet habe, wie sie gelbe Säcke zerreißen, um an den Inhalt zu kommen. Überall fliegt dann der Plastikmüll rum. Einfach nicht cool von den Möwen.
Bei der „Recherche“ für diesen Artikel habe ich mich mit Freund*innen aus Greifswald über Möwen unterhalten. Und jede*r konnte mir eine merkwürdige Möwengeschichte erzählen. Von gezieltem Ankacken, zu geklauten Eiskugeln und Nestbau auf dem Balkon habe ich alles gehört. Möwen am Strand sind für mich völlig in Ordnung, oder auf dem Meer, oder an einem Hafen an dem Fischfang betrieben wird. Aber auf Möwen in der Greifswalder Innenstadt kann ich absolut verzichten.
Beitragsbilder: Leonie Ratzsch und Nadine Frölich

von Kirstin Seitz | 03.07.2023
2021/2022 nahmen die Menschen in Deutschland laut Statista im Jahr 34,8 Kilogramm Zucker zu sich, was einem täglichen Verzehr von ca. 95 Gramm entspricht. Die WHO empfiehlt jedoch, nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag zu verzehren. Sie raten sogar eher, den Zuckerkonsum auf 25 Gramm pro Tag zu reduzieren, was etwa 6 Teelöffeln entspricht. Zu viel Zucker kann langfristig verschiedene gesundheitliche Probleme nach sich ziehen, wie Diabetes Typ 2, Schädigung der Leber etc. Ein großes Problem: Es gibt in vielen Lebensmitteln versteckten Zucker! In einer Tiefkühlpizza stecken beispielsweise ca. 4,5 Würfel Zucker, in einem 100g Fruchtjoghurt 4,4 Würfel Zucker. Das ist ganz schön viel, finde ich! Deshalb dachte ich mir, ich starte ein Experiment, bei welchem ich eine Woche komplett auf industriellen Zucker verzichte (nicht jedoch auf frisches Obst).
Eine Woche ohne industriellen Zucker. Ich dachte zuerst, dass das ja nicht so schwer sein könnte, da ich mich eigentlich schon relativ gesund ernähre – würde ich zumindest behaupten. Zugegebenermaßen habe ich dieses Experiment schon einmal starten wollen. Als ich mich dann aber damit auseinandergesetzt habe, wo überall Zucker versteckt ist und damit, dass ich deshalb einige meiner normalen Rezepte nicht kochen könnte, war ich entmutigt und habe das Experiment erst einmal verschoben. Aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr, diese Woche wird es in Angriff genommen!
Tag 0 – Vorbereitungen
Bevor es überhaupt los ging, habe ich mich in meiner Küche auf Spurensuche nach verstecktem Zucker gemacht. Leider musste ich nicht lange suchen, bis ich etwas gefunden hatte. Nein, ich rede nicht von Schokolade oder anderen Süßigkeiten, welche ich nur ab und zu esse. Ich meine Konservendosen. Das wissen vielleicht schon einige von euch, dass in Dosen Industriezucker zu finden ist. Mir war es auch bewusst, aber hin und wieder habe ich zum Kochen trotzdem Mais, Kichererbsen, Erbsen oder Bohnen aus der Dose verwendet. Das wird für diese Woche verbannt aus meiner Küche, denn ich denke mir: Aus den Augen, aus dem Sinn! Vielleicht komme ich weniger in Versuchung, solche Lebensmittel zu mir zu nehmen, wenn ich sie gar nicht griffbereit habe. Wenn ich also jetzt etwas mit den besagten Lebensmitteln kochen möchte, muss ich die Hülsenfrüchte eben einige Stunden davor in Wasser einlegen, damit sie leichter bekömmlich sind. Das geht, aber es dauert eine gewisse Zeit und man muss schon eine Weile vor dem Kochen daran denken, sonst kann man sie nicht verwenden.
Sojasauce und Tomatenmark muss ich auch aus der Küche verbannen, genauso wie natürlich Tomaten in der Dose.
Bei manchen Lebensmitteln bin ich mir nicht sicher, ob natürlicher oder zugesetzter Zucker enthalten ist. Bei meiner Gemüsebrühe steht beispielsweise dabei „enthält von Natur aus Zucker“ – das finde ich bei den Tomatendosen nicht, also lasse ich sie diese Woche lieber weg. Auch bei meinem Erdnussmus ist Zucker enthalten, es steht aber bei der Zutatenliste nichts von industriellem Zucker, genauso wenig findet sich jedoch ein Hinweis, dass von Natur aus Zucker enthalten ist. Ich lasse das also auch sicherheitshalber weg.
Bei der Sojasoße hingegen steht bei der Zutatenliste der zugesetzte Zucker explizit mit drauf, die wird diese Woche also auf jeden Fall nicht verwendet.
Bei den Konservendosen mit Mais etc. steht zwar „natursüß, ohne Zuckerzusatz“, in den Sternchen darunter findet sich aber zu lesen: „bezogen auf das abgetropfte Produkt“. Da vertraue ich aber lieber nicht drauf, dass beim Abspülen mit Wasser auch wirklich jeglicher Zucker weggeht.
Nächster Punkt: Morgens esse ich meistens Porridge. In Mandel-, Hafer-, Soja oder den anderen Milchalternativen findet sich aber leider meistens Zucker auf der Inhaltsliste. Da ich keine Lust hatte, sämtliche Milchalternativen zu studieren, ob in diesen natürlicher Zucker enthalten war oder dieser zugesetzt wurde, entschied ich mich einfach, zuckerfreie Pflanzenmlich zu verwenden. Teilweise esse ich mein Porridge mit Banane und etwas Kakao. Leider steht auf der Verpackung des Kakaos auch Zucker drauf. Ich finde jedoch keine Hinweise, ob dieser zugesetzt ist oder von Natur aus enthalten ist, also lasse ich ihn auch lieber weg.
Nachdem ich meine Küche „entrümpelt“ hatte, machte ich mich auf die Suche nach geeigneten Rezepten für diese Woche. Beim Frühstück musste ich zum Glück nicht so viel anpassen, ich hatte in letzter Zeit eh schon darauf geachtet, zuckerfreie Pflanzenmilch zu kaufen und auf den Kakao konnte ich diese Woche auch verzichten. Manche meiner sonst üblichen Rezepte waren eher schwer umsetzbar. Nudeln mit Linsen, Karotten und gestückelten Tomaten aus der Dose koche ich eigentlich gerne. Das ging diese Woche nicht, es sei denn, ich würde die Dose mit Tomaten durch natürliche Tomaten ersetzen…vielleicht sollte ich das ausprobieren. Oder natürlich jegliche Gerichte mit Sojasauce oder Erdnussmus.
Tag 1 – Aller Anfang ist schwer
Das Frühstück aus zuckerfreier Mandelmilch, Blaubeeren, Zimt und Kardamom stellte keine Probleme dar, das esse ich so normal auch öfter. Auch das Mittagessen, bestehend aus Nudeln, Tomaten, Spinat, Rucola, Lauchzwiebeln und Sprossen schmeckte mir und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichten würde.
So weit, so gut. Nachmittags hatte ich dann ein Blockseminar und unser Dozent hat Snacks und Süßigkeiten für uns mitgebracht. Das war eine wirklich nette Geste, aber ich konnte davon ja nichts essen, obwohl mich alles vier Stunden lang angelacht hat. Ich blieb jedoch standhaft, auch wenn es nicht immer leicht war; vor allem, wenn andere zugriffen und ich ihnen beim Essen der Süßigkeiten zusehen musste. Das nächste kleine Problem offenbarte sich, als mich zwei Freundinnen fragten, ob ich am Montag mit ihnen essen gehen würde. Da ich jedoch nicht wusste, welche Zutaten in dem Restaurant verwendet werden, musste ich leider absagen und habe die beiden stattdessen zu mir nach Hause eingeladen, um zusammen ein Gericht zu kochen.
Mein Abendessen hat mir auch geschmeckt und ich hatte nicht das Gefühl, als würde etwas fehlen. Es gab Hirse mit Mango, Gurke, Minze und gerösteten Mandeln.
Tag 2 – Der Versuchung erfolgreich widerstanden
Mein Frühstück bestand an diesem Morgen aus Porridge mit Banane, Zimt und Kardamom, aber ohne Kakao. Heute war der zweite Teil des Blockseminars und wieder hatte der Dozent Süßigkeiten und Snacks für uns dabei…heute starrten sie mich noch länger an als gestern, aber ich konnte dennoch der Versuchung widerstehen. Ich versuchte einfach, über sie hinweg zu sehen, sie nicht zu beachten, jedoch war das nicht immer so einfach, wenn die Komiliton*innen sich etwas davon schnappten. Okay ich gestehe: Dadurch, dass ich wusste, ich darf es nicht essen, quälte mich der Anblick der Süßigkeiten mehr, als wenn ich dieses Experiment nicht durchgeführt hätte
Zu essen gab es heute die Reste von gestern. Bei meinen eigenen Kreationen habe ich bisher nicht das Gefühl, als würde ich etwas vermissen, aber es war ja auch erst der zweite Tag und ich war noch voll motiviert. Zudem war für den nächsten Tag kein Blockseminar angesetzt, ich konnte Süßigkeiten also gut aus dem Weg gehen.
Für morgen hatte ich auch schon Rezepte rausgesucht: Spinat und Pilz mit Polenta und abends sollte es einen Linsen-Eintopf geben.
Tag 3 – Aus den Augen, aus dem Sinn
Mein morgendliches Porridge gab es heute mit frischen Erdbeeren und Mango. Hat mir wieder sehr gut geschmeckt!
Da heute vor meinen Augen keine Süßigkeiten für mehrere Stunden platziert waren und ich die Rezepte schon herausgesucht hatte, hatte ich heute keine Probleme mit dem Zuckerverzicht. Der Spruch „Aus den Augen, aus dem Sinn“, passte somit bei mir.
Tag 4 – Kochen mit Freundinnen
Das Frühstück bestand an diesem Morgen zur Abwechslung nicht aus Haferflocken, sondern aus Milchreis mit Mandelmilch, Zimt und Blaubeeren. Mittags gab es dann Linsensuppe mit Salat.
Die zwei Freundinnen, die mit mir Essen gehen wollten, kamen stattdessen zum Abendessen zu mir und wir haben gemeinsam ein Spargel-Pilz-Risotto gekocht. Natürlich alles ganz ohne industriellen Zucker, dafür aber sehr lecker!
Zucker oder irgendeine Süßigkeit habe ich heute nicht vermisst. Ich hatte aber auch keine Süßigkeiten vor meiner Nase stehen. Mal sehen, wie es die nächsten Tage wird!
Tag 5 – Einkaufen und Rezeptsuche
Vom Milchreis habe ich extra mehr gekocht, weshalb es diesen auch heute morgen wieder mit Zimt, Kardamom, Blaubeeren und Erdbeeren gab. Heute musste ich mal wieder einkaufen gehen und mir neue Rezepte suchen. Die Rezeptsuche wurde langsam immer schwieriger, da in vielen meiner veganen/vegetarischen Rezepten Sojasoße, Erdnussbutter, Kokosmilch oder Tomatendosen verwendet werden und das einfach wegzulassen oder zu ersetzen, ist gar nicht so einfach. Ich hatte mich dafür entschieden, am nächsten Tag die vegane Linsen-Bolognese ohne die gestückelten Tomaten in der Dose zu probieren und stattdessen echte Tomaten weich zu kochen.
Neben meinem Porridge mit Beeren gab es heute die Reste vom Spargel-Pilz-Risotto und vom Linseneintopf.
Tag 6 – Linsen-Bolognese geht auch ohne Tomaten aus der Konservendose!
Mein Frühstück bestand heute aus Porridge mit einer Banane, Kardamom und Zimt, es war wieder sehr gut!
Ich muss sagen, dass ich mittlerweile den Zucker gar nicht mehr vermisse und ich habe auch kein Verlangen danach. Außerdem habe ich mich daran gewöhnt, bei Rezepten genau hinzuschauen, ob in einer Zutat versteckter Zucker enthalten sein könnte. Ich habe auch gemerkt, dass ich Dosen gar nicht brauche, denn mein Versuch, die vegane Linsen-Bolognese mit weichgekochten Tomaten zu kochen, war ein voller Erfolg! Sie schmeckte mir so sogar fast noch besser als mit den Tomaten aus der Dose, auch wenn es etwas mehr Arbeit war. Abends gab es eine Süßkartoffel-Suppe mit zuckerfreier Hafermilch.
Tag 7 – Experiment erfolgreich geschafft
Juhu, der letzte Tag des Experiments war gekommen! Es gab natürlich wieder Porridge, aber heute mit einer Birne. Mittags gab es die Reste der veganen Linsen-Bolognese und abends die Reste der Suppe.
Die Zeit ging dann doch schneller vorbei, als ich anfangs dachte. Als ich zu Beginn nach Rezepten gesucht und meine Küche auseinander genommen habe, kam mir das Experiment sehr kompliziert vor. Mit einer guten Vorbereitung und Durchhaltevermögen ging die Zeit dann doch relativ schnell vorbei. Aber ich freue mich jetzt auch darauf, wieder essen gehen zu können oder mal ein Eis etc. zu essen.
Fazit
Was mich wirklich schockiert hat, war, in wie vielen Lebensmitteln Zucker zu finden ist und dass es durchaus schwierig ist, ihn immer zu umgehen und, dass man sich auch einschränken muss. Essengehen ist beispielsweise schwierig, da man keine Kontrolle darüber hat, ob sich irgendwo im Essen Zucker versteckt hat.
Ich esse zwar nicht jeden Tag Süßes und koche auch nicht jeden Tag etwas mit Konservendosen o.ä., aber wenn man sich für eine Woche den Verzicht auferlegt, werden solche Dinge gefühlt doch schmackhafter. Es stimmt also schon, dass man durch Verbote noch mehr Verlangen nach den genau diesen Dingen hat, das habe ich bei dem Blockseminar-Wochenende selbst erlebt.
Ich habe jedoch in dieser Woche gelernt, dass man sehr wohl ohne Konservendosen auskommt und ich habe noch einmal mehr auf meine Ernährung geachtet. Komplett ohne Industriezucker auszukommen, geht also schon, aber es ist etwas mühselig, da man bis auf Gemüse und Obst jedes Produkt umdrehen und studieren muss. Außerdem darf man auch nicht essen gehen, weil man nie weiß , was sich in den Zutaten versteckt.
Wo es geht, werde ich in Zukunft darauf achten, die natürlichen Lebensmittel zu verwenden, auch wenn es vielleicht mehr Arbeit macht, aber für den Körper ist es auf jeden Fall besser! Man ist schließlich, was man isst. Ich werde aber trotzdem ab und zu mit Freund*innen essen gehen und auch ab und an Kichererbsen aus der Dose essen oder Tomatenmark verwenden.
Deshalb: den Zuckerkonsum einschränken: JA! Aber nie mehr Essen gehen oder Süßes essen? NEIN!
Beitragsbild: Kirstin Seitz