von Archiv | 12.12.2005
Sie sind Kult und jeder kennt sie: Der ewig-planende Egon, Benny, Kjeld und Nervensäge Yvonne, gejagt von Kommissar Hansen und seinem Assistenten. Nun bevölkern sie die Bühne im Theater Vorpommern in der Komödie von Peter Dehler „Die Olsenbande dreht durch“.
 Groß war die Wiedersehensfreude, als der bekannte Chef der Bande aus dem obligatorischen Gefängnistor auf die Bühne trat. Das Haus war voll besetzt, dementsprechend laut der Jubel. Die Begeisterung sollte auch die folgenden zwei Stunden anhalten, denn Jung und Alt ließen sich von der witzigen Geschichte mitreißen. Wieder einmal ging es um einen genialen Coup. Das Publikum wurde Zeuge, wie die dreiköpfige Bande mit Witz und Geschick die Polizei an der Nase herumführte und dem Geschäftsmann Bang Johansen wichtige Dokumente stahl, um diese zu Geld zu machen. Nicht alle der spektakulären Pläne Egons wollten auf Anhieb gelingen, dennoch konnten sich die drei inklusive Yvonne schließlich über sieben Koffer Geld und auf eine bevorstehende Weltreise freuen.
Groß war die Wiedersehensfreude, als der bekannte Chef der Bande aus dem obligatorischen Gefängnistor auf die Bühne trat. Das Haus war voll besetzt, dementsprechend laut der Jubel. Die Begeisterung sollte auch die folgenden zwei Stunden anhalten, denn Jung und Alt ließen sich von der witzigen Geschichte mitreißen. Wieder einmal ging es um einen genialen Coup. Das Publikum wurde Zeuge, wie die dreiköpfige Bande mit Witz und Geschick die Polizei an der Nase herumführte und dem Geschäftsmann Bang Johansen wichtige Dokumente stahl, um diese zu Geld zu machen. Nicht alle der spektakulären Pläne Egons wollten auf Anhieb gelingen, dennoch konnten sich die drei inklusive Yvonne schließlich über sieben Koffer Geld und auf eine bevorstehende Weltreise freuen.
Nicht nur das originelle Medley aus allen 13 Olsenbande-Filmen, sondern auch die originalgetreue und liebevolle Ausstaffierung der Figuren erfreute den Kenner. Eng an die Filmvorlagen angelehnt, ließen sich viele Details wiedererkennen, vom tippelnden Gang Bennys bis zur ewig nörgelnden Yvonne. Es folgte Witz auf Witz, zur Freude der anwesenden Kinder manchmal etwas zu überdreht, doch auch das erwachsene Kind hatte seinen Spaß. In jedem Fall passt das harmlos lustige Stück wunderbar in die Vorweihnachtszeit und ist besonders für Studenten zu empfehlen, da zwei ihrer Kommilitonen die Aufführung bereichern.
Geschrieben von Uta-Cacilia Nabert, Grit Preibisch
von Archiv | 12.12.2005
Kurt Tucholsky liebt Deutschland, Kurt Tucholsky hasst „Deutschland“.
Kontrastreich war auch das Programm „Kurt Tucholsky: Drei Minuten Gehör“, das an einem Donnerstagabend im Theater auf der Probebühne dargeboten wurde.
Begleitet vom Pianisten und Antagonisten Thomas Bloch–Bonhoff, gab Sabine Kotzur mit Texten, Gedichten und Chansons die satirisch-humoristische, aber auch die vaterlandsmüde Seite Tucholskys wieder. Mit Chansons á la „Zieh Dich aus Petronella“ oder „Immer angelehnt“ beherrschte sie die Kunst des Flirtens und Kokettierens mit den anwesenden Männern im Publikum voll und ganz.
Mit fabelhaft sonorer Stimme und Berliner Schnauze trug sie Texte gegen die eitle Männlichkeit, gegen den Militarismus, gegen das Beamtentum und natürlich für die Liebe vor. Mal schlüpfte sie in die Rolle der Tochter, die einem Geliebten beichtet, mal in die Rolle des Arbeitsvermittlers, der dem Sohn eine Beamtenlaufbahn empfiehlt und dann nahm sie wieder die Rolle des selbstverliebten Mannes ein, der vor dem Spiegel posiert, um einer Zimmerpalme zu imponieren. Auch Szenen einer Ehe durften natürlich nicht fehlen. Wer „Rheinsberg“ kennt, weiß, wie gnadenlos Tucholsky Stärken und Schwächen einer Beziehung seziert.
Auch als überzeugter Pazifist war Tucholsky bekannt und prägte den berühmt gewordenen Satz „Soldaten sind Mörder“. Wie kein anderer kritisierte der bedeutendste Satiriker der Weimarer Republik die Missstände seiner Zeit. An diesem Abend fand auch dieser Aspekt Berücksichtigung im abwechslungsreichen Repertoire. Die Auswahl von Tucholskys Texten spiegelte die zwiespältige Seele des Dichters gelungen wider.
An seiner Hassliebe zu Deutschland ging er letztendlich zu Grunde: 1935 starb Tucholsky im schwedischen Exil nahe Gripsholm durch eigene Hand.
Geschrieben von Katarina Sass
von Archiv | 12.12.2005
Wie wird aus Liebe Hass und aus Zuneigung Verachtung? Warum wird eine Frau zur Mörderin ihres Bruders und ihres eigenen Sohnes?
Seit Jahrhunderten lebt der Mythos der Kindsmörderin Medea. Zahlreiche Autoren wie Euripides oder auch Christa Wolff ließen sich von dieser leidenschaftlichen Frauengestalt zu unterschiedlichsten Ausarbeitungen inspirieren, als Opern- und Filmstoff ist das Schicksal der Medea aufgegriffen worden.
Im Theater Vorpommern ist nun ein modernes Ballett von Ralf Dörnen zu erleben, in dem Medea ihren Weg durch die Irrungen des Lebens sucht. Für ihren Geliebten Jason wendet sie sich gegen ihre eigene Familie, wird kriminell und verlässt fluchtartig ihre Heimat.
Fortan führt sie ein Leben, das von Verzweiflung und Entwurzelung geprägt ist. Das Glück mit Jason und dem gemeinsamen Sohn währt nicht lange, denn Jason verlässt sie, um für sich den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Hasserfüllt entwickelt Medea einen grausamen Racheplan, der alle Beteiligten in tiefe Verzweiflung stürzt.
Zur Musik von Stephan Marc Schneider lassen die Mitglieder des Ballettensembles diese Geschichte mit tragischem Ausgang zum Leben erwachen. Dynamische Bewegungen sowie moderne Sprung- und Tanzkombinationen werden genutzt, um dem Zuschauer die Handlungen und Emotionen der Protagonisten zu erklären. Nicht immer will dies gelingen.
Theaterbesucher, die die Geschichte der Medea nicht kennen, haben sicherlich Mühe, der Handlung zu folgen. Begrenzt sind auch die Möglichkeiten eines Balletts, die vielschichtigen Motive und Gefühle der Handelnden, vor allem der Medea, ausschließlich durch Bewegung und Mimik auszudrücken.
Beeindruckend ist die Aufführung jedoch allemal, denn der Inhalt, die tänzerische Leistung, die musikalische Begleitung sowie die Kostüm- und Bühnengestaltung wissen in ihrer Gesamtheit zu überzeugen.
Geschrieben von Grit Preibisch
von Archiv | 12.12.2005
Neben den Slawischen Tänzen, der achten und der neunten Sinfonie („Aus der neuen Welt“) sowie der späten Oper „Rusalka“ zählt das Violoncellokonzert zu den wichtigsten Kompositionen des Tschechen Antonín Dvorák (1841–1904). Obwohl der Brahmsfreund das Cello aufgrund seiner klanglichen Qualitäten in der hohen wie tiefen Lage nicht überschwänglich schätzt, geriet das Werk zu seinem besten Instrumentalkonzert.
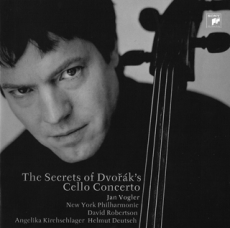 Der Solist Jan Vogler reiste für die Einspielung des Stücks mit David Robertson und dem New York Philharmonic Orchestra eigens nach New York – dem Ort, wo Dvorák 1894, kurz vor Abreise nach seinem dreijährigen, erfolgreichen USA-Aufenthalt, die Arbeit daran begann. Damit endet innerhalb des Gesamtoeuvres die „amerikanische“ Phase, in der Dvorák indirekt die Diskussion um die musikalische Identität des Landes anregend begleitet. Doch anstelle eines Hinweises auf jenen historischen Hintergrund betonen Jan Vogler als Solist und der Musikwissenschaftler Michael Beckermann die geheimnisvolle, wenn auch persönlich-tragische, Seite des Cellokonzerts. Was sich interpretatorisch als beflügelnd herausstellt, lässt wissenschaftlich Fragen offen.
Der Solist Jan Vogler reiste für die Einspielung des Stücks mit David Robertson und dem New York Philharmonic Orchestra eigens nach New York – dem Ort, wo Dvorák 1894, kurz vor Abreise nach seinem dreijährigen, erfolgreichen USA-Aufenthalt, die Arbeit daran begann. Damit endet innerhalb des Gesamtoeuvres die „amerikanische“ Phase, in der Dvorák indirekt die Diskussion um die musikalische Identität des Landes anregend begleitet. Doch anstelle eines Hinweises auf jenen historischen Hintergrund betonen Jan Vogler als Solist und der Musikwissenschaftler Michael Beckermann die geheimnisvolle, wenn auch persönlich-tragische, Seite des Cellokonzerts. Was sich interpretatorisch als beflügelnd herausstellt, lässt wissenschaftlich Fragen offen.
Dem Hörer kommt bei dieser Aufnahme das pädagogisch wertvolle Konzept zugute. Anstelle von Taktzahlen in einer Partitur führen die angegebenen Spielzeiten durch das Werk und ermöglichen einen klareren Überblick über dessen dramatische Konzeption. Mit wunderbarem Strich gleitet Jan Vogler nach einem bedrückt grüblerischen Orchesterauftakt in das Werk und präsentiert eine insgesamt recht aufgewühlte Interpretation, die für sich selbst stehen kann.
Hingewiesen sei abschließend auf die Einspielungen von Pablo Casals und Mstilav Rostropovitsch. Letzterem gelingt unter dem Dirigat Herbert von Karajans eine anfangs bescheidene, in der Expressivität keinesfalls nachstehende Deutung, bei der Orchester und Solist wunderbar verschmelzen. Die Schaffung eines prahlerischen Virtuosenstücks lag Dvorák mit Konzert für Violoncello und Orchester fern.
Geschrieben von Uwe Roßner
von Archiv | 12.12.2005
In Russland ist Sergej Lukianenko als Schriftsteller von Fantasy und Science-Fiction kein Unbekannter mehr. Im Gegenteil. Für seine Romane und Erzählungen ist der Gegenwartsautor mit Preisen bedacht worden. Hierzulande erstreckt sich sein Bekanntheitsgrad vorerst auf „Nochnoi Dozor“.
 In Greifswald fesselte der auf dem gleichnamigen Buch basierende Film „Wächter der Nacht“ in der Spätvorstellung. Der Roman ist Auftakt einer Fantasy-Triologie, in der nach einem lange zurückliegenden Waffenstillstand Gut und Böse auf das empfindliche Kräftegleichgewicht achten. Der Kampf um den Sieg steht solange aus, bis eine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil errungen hat.
In Greifswald fesselte der auf dem gleichnamigen Buch basierende Film „Wächter der Nacht“ in der Spätvorstellung. Der Roman ist Auftakt einer Fantasy-Triologie, in der nach einem lange zurückliegenden Waffenstillstand Gut und Böse auf das empfindliche Kräftegleichgewicht achten. Der Kampf um den Sieg steht solange aus, bis eine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil errungen hat.
Die deutsche Erstausgabe des Buches lässt rasch nach der literarischen Qualität Lukianenkos fragen. Fade Dialoge, fleischlose Figuren und ein recht konturloses Moskau sorgen nicht für die nötige Spannung auf 525 Seiten, wovon allein nur das erste Kapitel als Drehbuchgrundlage diente. Zwar ist Quentin Tarantino im Klappentext außerordentlich über den Film erfreut, dennoch erklärt sich die Schwäche des Buches daraus nicht. Vielleicht bringen Teil zwei und drei mehr Licht ins Dunkel.
Das Buch „Wächter der Nacht“ von Sergej Lukianenko ist im Heyne-Verlag als Taschbuch erschienen und kostet 13 Euro.
Geschrieben von Uwe Roßner
 Groß war die Wiedersehensfreude, als der bekannte Chef der Bande aus dem obligatorischen Gefängnistor auf die Bühne trat. Das Haus war voll besetzt, dementsprechend laut der Jubel. Die Begeisterung sollte auch die folgenden zwei Stunden anhalten, denn Jung und Alt ließen sich von der witzigen Geschichte mitreißen. Wieder einmal ging es um einen genialen Coup. Das Publikum wurde Zeuge, wie die dreiköpfige Bande mit Witz und Geschick die Polizei an der Nase herumführte und dem Geschäftsmann Bang Johansen wichtige Dokumente stahl, um diese zu Geld zu machen. Nicht alle der spektakulären Pläne Egons wollten auf Anhieb gelingen, dennoch konnten sich die drei inklusive Yvonne schließlich über sieben Koffer Geld und auf eine bevorstehende Weltreise freuen.
Groß war die Wiedersehensfreude, als der bekannte Chef der Bande aus dem obligatorischen Gefängnistor auf die Bühne trat. Das Haus war voll besetzt, dementsprechend laut der Jubel. Die Begeisterung sollte auch die folgenden zwei Stunden anhalten, denn Jung und Alt ließen sich von der witzigen Geschichte mitreißen. Wieder einmal ging es um einen genialen Coup. Das Publikum wurde Zeuge, wie die dreiköpfige Bande mit Witz und Geschick die Polizei an der Nase herumführte und dem Geschäftsmann Bang Johansen wichtige Dokumente stahl, um diese zu Geld zu machen. Nicht alle der spektakulären Pläne Egons wollten auf Anhieb gelingen, dennoch konnten sich die drei inklusive Yvonne schließlich über sieben Koffer Geld und auf eine bevorstehende Weltreise freuen.
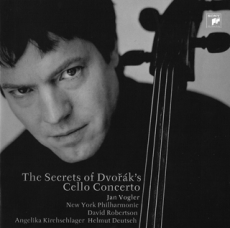 Der Solist Jan Vogler reiste für die Einspielung des Stücks mit David Robertson und dem New York Philharmonic Orchestra eigens nach New York – dem Ort, wo Dvorák 1894, kurz vor Abreise nach seinem dreijährigen, erfolgreichen USA-Aufenthalt, die Arbeit daran begann. Damit endet innerhalb des Gesamtoeuvres die „amerikanische“ Phase, in der Dvorák indirekt die Diskussion um die musikalische Identität des Landes anregend begleitet. Doch anstelle eines Hinweises auf jenen historischen Hintergrund betonen Jan Vogler als Solist und der Musikwissenschaftler Michael Beckermann die geheimnisvolle, wenn auch persönlich-tragische, Seite des Cellokonzerts. Was sich interpretatorisch als beflügelnd herausstellt, lässt wissenschaftlich Fragen offen.
Der Solist Jan Vogler reiste für die Einspielung des Stücks mit David Robertson und dem New York Philharmonic Orchestra eigens nach New York – dem Ort, wo Dvorák 1894, kurz vor Abreise nach seinem dreijährigen, erfolgreichen USA-Aufenthalt, die Arbeit daran begann. Damit endet innerhalb des Gesamtoeuvres die „amerikanische“ Phase, in der Dvorák indirekt die Diskussion um die musikalische Identität des Landes anregend begleitet. Doch anstelle eines Hinweises auf jenen historischen Hintergrund betonen Jan Vogler als Solist und der Musikwissenschaftler Michael Beckermann die geheimnisvolle, wenn auch persönlich-tragische, Seite des Cellokonzerts. Was sich interpretatorisch als beflügelnd herausstellt, lässt wissenschaftlich Fragen offen. In Greifswald fesselte der auf dem gleichnamigen Buch basierende Film „Wächter der Nacht“ in der Spätvorstellung. Der Roman ist Auftakt einer Fantasy-Triologie, in der nach einem lange zurückliegenden Waffenstillstand Gut und Böse auf das empfindliche Kräftegleichgewicht achten. Der Kampf um den Sieg steht solange aus, bis eine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil errungen hat.
In Greifswald fesselte der auf dem gleichnamigen Buch basierende Film „Wächter der Nacht“ in der Spätvorstellung. Der Roman ist Auftakt einer Fantasy-Triologie, in der nach einem lange zurückliegenden Waffenstillstand Gut und Böse auf das empfindliche Kräftegleichgewicht achten. Der Kampf um den Sieg steht solange aus, bis eine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil errungen hat.

