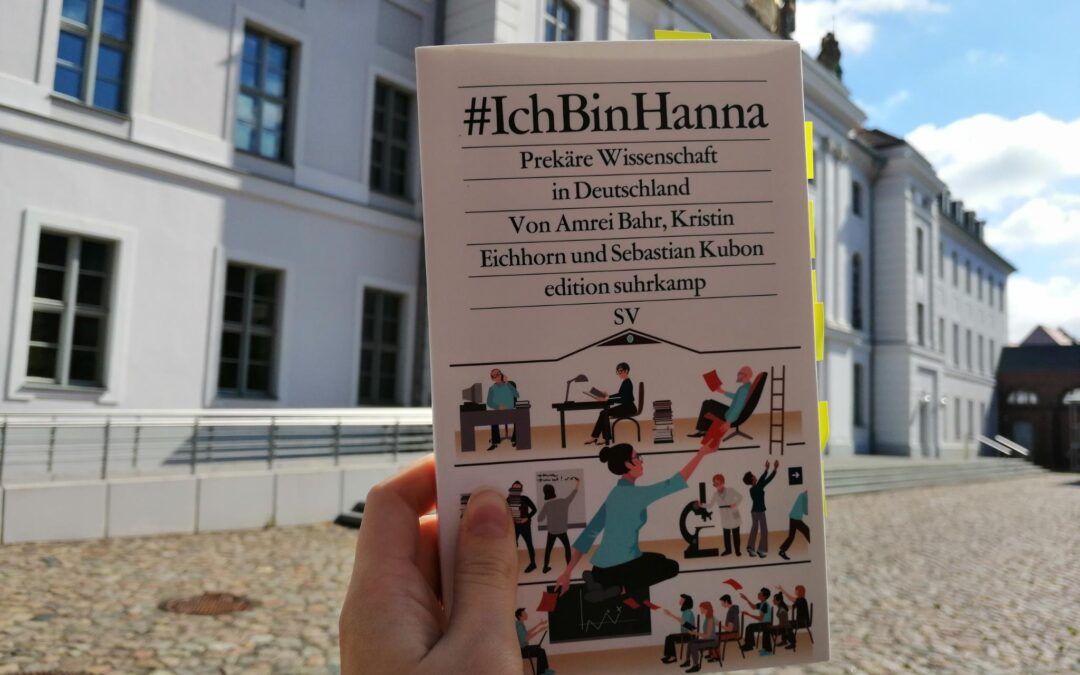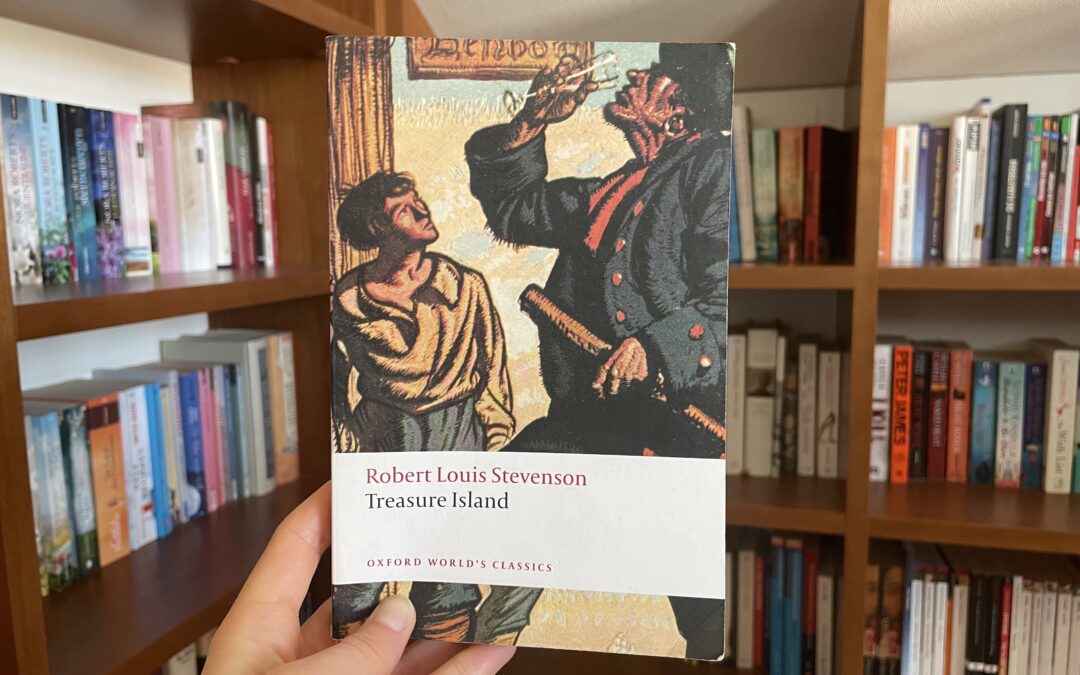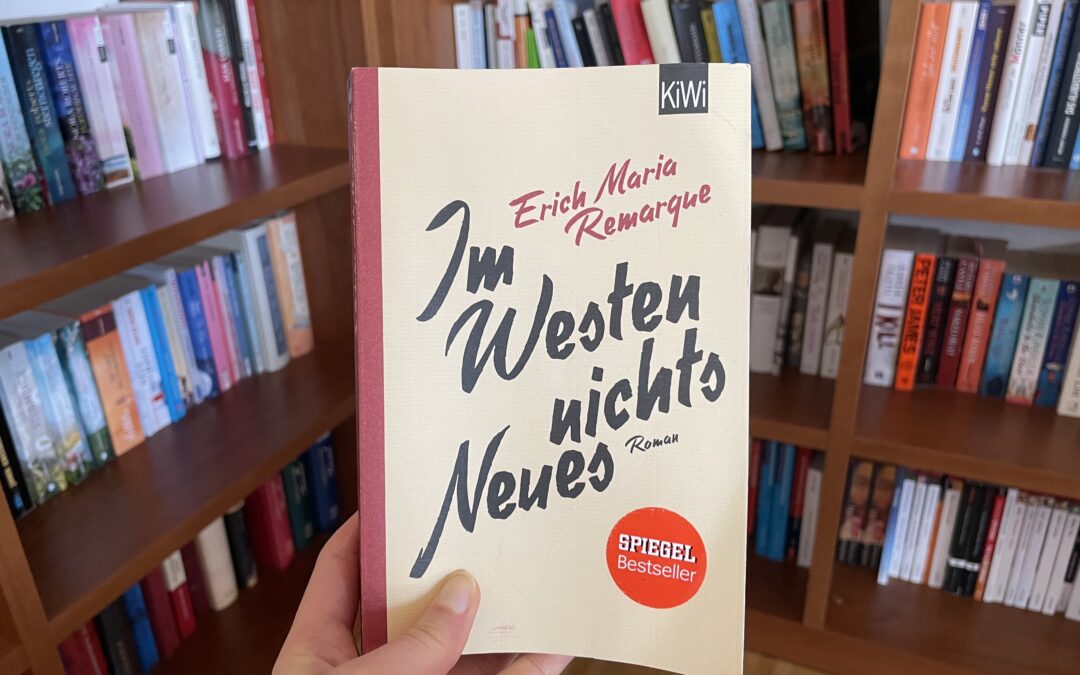von Kirstin Seitz | 10.11.2022
Der Film „Das Boot“ von Wolfgang Petersen wird als einer der besten deutschen Filme bezeichnet und wurde 2008 sogar von Filmfans zum besten deutschen Film aller Zeiten gewählt.
Ein paar Hintergrundinformationen
„Das Boot“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Lothar-Günther Buchheim, in welchem er seine Erfahrungen als Kriegsberichterstatter auf unterschiedlichen U-Booten im Zweiten Weltkrieg verarbeitet. Der Film erzählt vor allem aus der Sicht des Kriegsberichterstatters Leutnant Werner (gespielt von Herbert Grönemeyer) von einem deutschen U-Boot, das während der Atlantikschlacht im Zweiten Weltkrieg Teil des U-Boot-Kriegs ist und Jagd auf feindliche Schiffe macht.
Der ursprüngliche Plan war, den Film von einem amerikanischen Regisseur mit amerikanischen Schauspieler drehen zu lassen, um internationalen Erfolg zu erzielen. Diese Idee wurde jedoch schnell wieder verworfen, da sie die Deutschen in dem Film als rein stereotype, brutale Nazis darstellen wollten: Laut dem Spiegel war der amerikanische Drehbuchautor Ronald M. Cohen der Überzeugung, „dass ein deutsches U-Boot […] ohne Nazi-Bestie so unverkäuflich [sei] wie Transsylvanien ohne Dracula“. Dagegen protestierte Buchheim vehement: „Man hat aus meinem Buch einen japanischen Remmidemmi-Film gemacht und die Deutschen als Blutsäufer hingestellt“. Die tatsächliche Verfilmung unter Petersen weicht deutlich von solchen Vorstellungen ab.
Alle, die den Film schon gesehen haben, wissen wahrscheinlich, dass es mehrere Fassungen gibt. Der erste in den Kinos gezeigte Film ist von 1981 und dauert 149 Minuten, wobei hier die Kommentare von Werner fehlen. Diese Fassung wurde von der deutschen Presse kritisiert, von der ausländischen Presse jedoch gefeiert. Dies mag einen vielleicht überraschen, da der Film aus der Sicht von deutschen Soldaten englische U-Boote angreift. Nicht nur die Presse, sondern auch der Autor des Romans hielt sich mit Kritik an dem Film nicht zurück. Selbst die Nominierung des Films für 6 Oscars, was bis heute noch Rekord für einen deutschen Film ist, änderte die Kritik nicht. Auch die Schauspieler waren mit der ersten Fassung nicht zufrieden; für sie war das nicht ihr Film, den sie gedreht hatten, sondern ein ganz anderer, da so viel Material weggelassen wurde und damit die Handlung und die Charaktere teilweise anders dargestellt wurden.
1985 kam eine sechsteilige Fernsehfassung heraus, die 309 Minuten dauert und somit deutlich länger ist als der Kinofilm. Erst diese Fassung zeigt den wahren Charakter des Films und gewann als erste deutsche Fernsehserie einen Emmy. Sowohl die Presse als auch Buchheim verfassten zu der Fernsehserie positive Kritiken. Zudem erschien 1997 noch der Director’s Cut, welcher 200 Minuten lang ist. Laut Petersen sollte eigentlich diese Fassung 1981 in den Kinos erscheinen, kommerzielle Gründe hätten dies aber verhindert. Wenn ich in diesem Artikel von dem Film „Das Boot“ rede, meine ich die Fernsehserie, welche von den Schauspielern selbst auch als einzig wahre Fassung bezeichnet wird.
Der Film „Das Boot“
Der Film spielt im Jahr 1941, der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange und die U-Boot-Kämpfe werden für die Deutschen immer schwieriger: Die Handelsschiffe, die Großbritannien mit wichtigen Kriegsgütern beliefern, welche die Deutschen angreifen sollen, werden nun von Zerstörern begleitet. Die Zerstörer machen einen Angriff auf diese Geleitzüge aus deutscher Sicht gefährlicher, weswegen die Offensiven der Deutschen auch weniger erfolgreich sind.
Der Anfang des Films nimmt die Zuschauer*innen zu dem letzten Abend der Besatzung an Land mit, bei der diese und andere Marine-Offiziere ausgelassen feiern und trinken; ein Soldat hingegen nimmt nur schweren Herzens Abschied von seiner französischen Freundin. Am nächsten Tag läuft das U-Boot am französischen Atlantikhafen La Rochelle mit fröhlicher Musik aus. Bei der Abfahrt wirken die meisten Besatzungsmitglieder noch positiv gestimmt und fahren frohen Mutes los, vor allem Werner unterschätzt die Gefahr total. Schnell macht sich jedoch Lagerkoller breit, der sich auch teilweise in Aggression zeigt, da nichts passiert; sie treffen zunächst auf kein feindliches Schiff, das sie angreifen können. Als die Meldung kommt, dass sie Fahrt auf einen Geleitzug aufnehmen sollen, ist der Jubel groß, denn endlich passiert etwas. Jedoch schlägt die Freude schnell in Angst um, als sie von dem Feind mit Wasserbomben attackiert werden. Hier, wie auch bei anderen spannenden Stellen des Films, kann man sich als Zuschauer*in gut in die Lage der Besatzung versetzen, man fühlt ihre Anspannung. Dies liegt zum einen an der sehr guten schauspielerischen Leistung und zum anderen auch an der hervorragenden Kameraführung, die den Zuschauer*innen das Gefühl gibt, selbst Teil der U-Boot-Mannschaft zu sein.
Nachdem das U-Boot dem Zerstörer entkommen konnte, jubeln die Männer erleichtert auf. Auch diese Freude wird bald durch einen wochenlang andauernden Sturm erstickt, weshalb sie nur schwer auf ihrem Kurs bleiben können, was das Aufeinandertreffen mit einem anderen deutschen U-Boot auch verdeutlicht. Auch in dieser Zeit wird die Besatzung wieder von Lagerkoller und Aggressionen heimgesucht. Anschließend folgen noch weitere spannende Szenen, in denen das U-Boot in Bedrängnis kommt, die ich hier jedoch nicht vorweg nehmen möchte, wenn manch einer oder eine den Film selbst noch anschauen möchte. Aktuell ist die sechsteilige Version auf Netflix verfügbar.
Wird der Film zu Recht so gelobt?
Schon alleine die Starbesetzung an Schauspielern, die mit diesem Film ihren Durchbruch hatten, macht ihn sehenswert. Einzig Jürgen Prochnow war davor schon bekannt, alle anderen waren noch unbekannt. Ich konnte mir Herbert Grönemeyer davor nicht als Schauspieler vorstellen, für mich war er der bekannte Sänger, jedoch erlangte er seinen künstlerischen Durchbruch mit dem Film „Das Boot“. Aus meiner Perspektive hat er seine Rolle exzellent gespielt, was gar nicht so einfach ist, wenn er zwar eine der Hauptrollen verkörpert, aber neben seinen erzählerischen Kommentaren nicht viele Dialoge an Bord hat. Darüber hat er sich anfangs laut eigenen Angaben selbst auch gewundert, als er das Drehbuch bekam. Daneben spielen unter anderem noch Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, Heinz Hönig und Martin Semmelrogge als bekannte Schauspieler mit.
Außerdem sind die Charaktere der Besatzungsmitglieder sehr vielfältig und meiner Meinung nach gut getroffen. Individuelle Schicksale werden gezeigt, wie zum Beispiel der „LI“ (leitende Ingenieur), der um seine kranke Frau bangt oder ein deutscher Soldat, der mit einer Französin zusammen ist, welche von ihm ein Kind erwartet. Es befindet sich mit dem „1. WO“ (1. Wachoffizier) auch ein regimetreuer Nazi an Bord. Der „Kaleu“ (Kapitänleutnant = der Kommandant des U-Boots) macht immer wieder regierungskritische Aussagen, mit denen er bei dem 1. WO aneckt. Zudem ist seine Beziehung zu Leutnant Werner ambivalent: Mal ist er freundlicher zu ihm, dann stichelt er wieder gegen ihn, da ihm bewusst ist, dass Werner mit seinem Bericht der NS-Propaganda zuarbeitet.
Was mir an dem Film auch besonders gut gefällt: die Besatzung von U-Booten stammte damals aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands, was auch in diesem Film berücksichtigt wurde, denn die Schauspieler sind auch aus verschiedenen Ecken Deutschlands und sogar Österreichs. Das zeigt, dass beim Dreh auf Authentizität geachtet wurde.
Ziel sei es gewesen, alles so authentisch wie möglich darzustellen und die Zuschauer*innen hautnah am Geschehen teilhaben zu lassen. Das ist meiner Meinung nach geglückt, denn man fühlt sich so, als wäre man tatsächlich Teil der Besatzung und kann sich richtig gut in die Charaktere hineinversetzen. Für mich wirkt der Film so, als hätten sie dargestellt, wie das Leben auf einem U-Boot damals wirklich abgelaufen sein könnte. Dazu trägt unter anderem die hervorragende Kameraführung bei. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass diese auch für einen Oscar nominiert wurde. Außerdem passt die Filmmusik optimal zu dem Film. Wenn man sie einmal gehört hat, vergisst man sie nicht mehr. Sie wurde ebenfalls für einen Oscar nominiert.
Man könnte als kleinen Kritikpunkt anmerken, dass diese Fassung schon wirklich sehr lang ist und man manches vielleicht auch hätte kürzen oder weglassen können (ich habe das natürlich nicht alles an einem Stück angeschaut, sondern in kleinen Teilen). Jedoch bin ich der Meinung, dass man den Film nur dann wirklich versteht und seine wahre Größe erst in diesen 309 Minuten begreifen kann.
Dass er einer der besten deutschen Filme und für mich auch einer der besten Filme überhaupt ist, steht für mich außer Frage. Gerade auch in der Sparte Kriegsfilme über den Zweiten Weltkrieg, vor allem aus deutscher Sicht, ist er für mich unübertroffen, denn die U-Boot-Besatzung wird hier nicht als ein Haufen fanatischer Nazis dargestellt. Stattdessen werden einzelne Schicksale gezeigt und auch Kritik am Regime wird geäußert, selbst wenn ein Nazi der 1. Wachoffizier ist. Ganz ohne einen durch und durch überzeugten Nazi würde der Film wahrscheinlich auch die Wirklichkeit verzerren, schließlich gab es davon einige. Zudem macht der Film von Beginn an auf die Schrecken des U-Boot-Kriegs aufmerksam, indem erzählt wird, dass von den 40.000 U-Boot-Männern nur 10.000 lebend zurückkehrten. Damit wird deutlich, dass es sich klar um einen Anti-Kriegsfilm handelt. Auch in der Bar am Vorabend des Auslaufens des U-Boots wird diese Antikriegshaltung deutlich: In einer Szene bekommt ein Kapitän zwar das Ritterkreuz verliehen, er ist jedoch dem Alkohol verfallen und leidet zudem sichtlich unter posttraumatischer Belastungsstörung. Das Ende des Films unterstreicht noch einmal, dass der Film ein Anti-Kriegsfilm ist. Da aber manche Leser*innen des Buches den Film vielleicht noch nicht kennen und jetzt Lust darauf bekommen haben, möchte ich den Ausgang nicht verraten. Nur so viel sei gesagt: damit hätte ich nicht gerechnet!
Wer sich noch mehr über die Dreharbeiten und Hintergründe zu dem Film interessiert, dem würde ich eine Dokumentation von Arte empfehlen. Die Originalversion habe ich auf YouTube leider nicht gefunden, diese hat englische Untertitel, ist sonst aber genau so wie das Original. Auch dieser Artikel von Wilhelm Bittorf 1980 im Spiegel gibt einen guten Einblick in die Hintergründe zum Filmdreh.
Titelbild: scholty1970 auf Pixabay
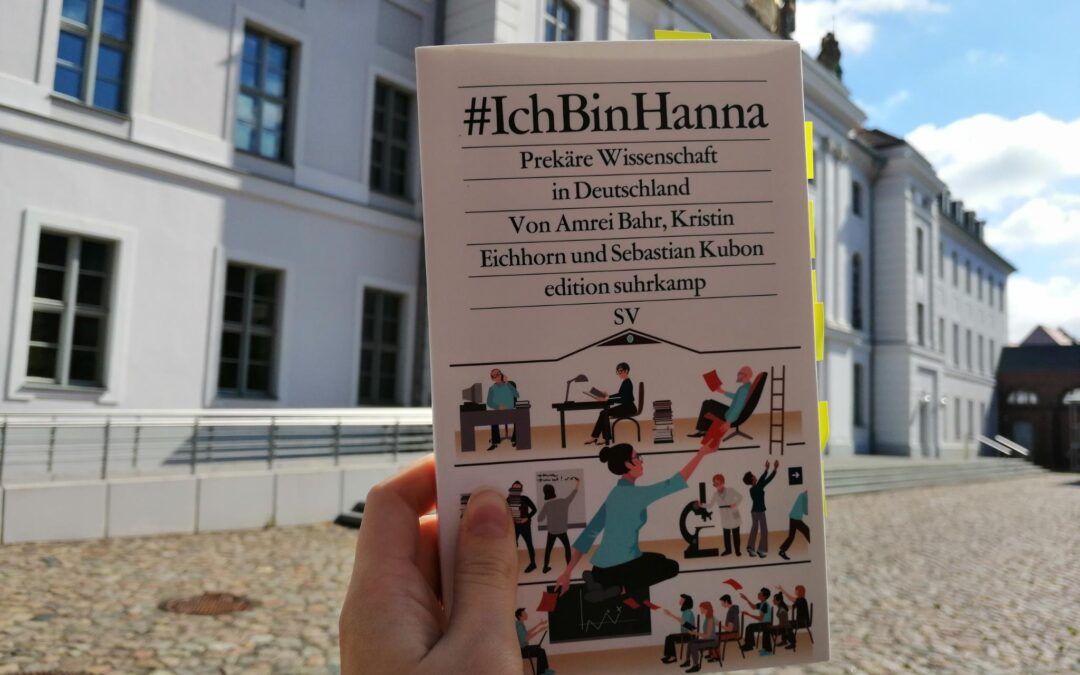
von Maret Becker | 27.06.2022
Mein verklärtes Bild von der wundervollen Arbeit der Dozierenden an einer Universität verschwand, sobald ich anfing zu studieren. Aber anscheinend ist die Situation der Dozierenden bzw. wissenschaftlichen Mitarbeitenden noch viel, viel schlimmer, als ich mir ausmalen konnte. Von dieser prekären Lage wird im Buch #IchBinHanna erzählt.
Überblick
#IchBinHanna ist ein Buch von Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon. Die drei Autor*innen des Buches sind allesamt wissenschaftliche Mitarbeitende an einer Universität oder haben eine Professur inne. Sie wissen also ganz genau, wie der wissenschaftliche Betrieb an einer Universität abläuft. In ihrem Buch klären sie über ihren ins Leben gerufenen Hashtag #IchBinHanna auf. Mit diesem Hashtag wollten sie auf die prekäre Lage der Wissenschaft durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Deutschland aufmerksam machen, von dem sie selbst betroffen sind. Das Buch ist noch sehr neu, denn es erschien erst 2022 im Suhrkamp Verlag. Die zweite Auflage hat 135 Seiten.
Jetzt nochmal in kurz und knapp, worum es in dem Buch genauer geht: Es wird erklärt, was es mit dem Hashtag #IchBinHanna auf sich hat, warum das Wissenschaftszeitvertragsgesetz den Dozierenden mehr schadet als nutzt und wie man die ganze Problematik lösen bzw. reformieren könnte. Damit ihr einen genaueren Überblick bekommt, kläre ich euch kurz über die einzelnen Teile des Buches auf.
#IchBinHanna – Einordnung
Vielleicht hast du in den Nachrichten oder sogar in deinem universitären Umfeld schon einmal von dem Hashtag #IchBinHanna gehört. Der ging nämlich in den Medien eine Zeit lang ganz schön viral. Falls nicht, erfährst du jetzt mehr dazu.
Am 10. Juni 2021 benutzte Sebastian Kubon, einer der Autor:innen, zum ersten Mal den Hashtag #IchBinHanna. Er echauffierte sich über ein Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von 2018. In dem Video zeigt die fiktive Biologin Hanna die Vorzüge des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Sie beschreibt den schnellen Wechsel des Personals als vorteilhaft für die Wissenschaft. Die Befristungen seien nämlich nötig, um neue Fachkräfte aus neuen Generationen nachrücken zu lassen. Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon sahen das deutlich anders und lancierten den Hashtag. Das war erst der Anfang. Zahllose Wissenschaftler*innen folgten dem Beispiel und erzählten auf Twitter ihre eigenen Geschichten im wissenschaftlichen Bereich. Auch sie waren mit ihren Anstellungen in der Wissenschaft unzufrieden. Das liegt an den Bedingungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Im Buch wurden passend dazu auch einige Twitterbeiträge abgedruckt.
Silke, 49, Literaturwissenschaftlerin, verstopft das System seit Oktober auf einer halben unbefristeten Stelle. Sonst hätte ich nach 20 Jahren Wissenschaft, 4 Monografien, 58 Aufsätzen und einer knappen Million eingeworbener Drittmittel auf der Straße gestanden. #IchBinHanna
Zitat eines Tweets, S. 66
Das Problem mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)
Um es ganz plump auszudrücken: Das Gesetz ermöglicht die Befristung von Arbeitsverträgen des wissenschaftlichen Personals. Durch das Gesetz resultieren die Arbeitsbedingungen und somit auch die beruflichen Aussichten von Akademiker*innen. Das Problem? Die befristete Anstellung. Es ist ein Sonderbefristungsrecht, das regelt, dass Wissenschaftler*innen in Deutschland maximal sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion befristet beschäftigt werden können. Somit haben Wissenschaftler*innen eigentlich keine Perspektiven auf eine Daueranstellung in der Wissenschaft. Dieser Stress verursacht bei den Betroffenen unter anderem Depressionen und Überlastung. Verständlich, wenn von einem immer wieder verlangt wird, Anträge auszufüllen und sich zu bewerben, anstatt engagiert lehren und forschen zu können.
Die herausragende Stellung der Professor*innen führt schließlich dazu, dass eigenständige Leistungen anderer Wissenschaftler*innen nicht angemessen gewürdigt werden. Wenn auch formal inzwischen inexistent, wirkt hier das deutsche Lehrstuhlprinzip nach, in dessen Zentrum die Professur steht, der abhängig beschäftigte Wissenschaftler*innen als sogenannte „Ausstattung“ zugeordnet sind.
S. 95
Gibt es eine Lösung?
Die Aufregung um den Hashtag #IchBinHanna hat etwas gebracht. Die sämtlichen Kernforderungen der Autor*innen wurden nämlich im Koalitionsvertrag der Bundesregierung berücksichtigt.
Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag 2021–2025 das Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu verbessern und dazu unter anderem „das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Basis der Evaluation [zu] reformieren“.
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen wir das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Basis der Evaluation reformieren. Dabei wollen wir die Planbarkeit
und Verbindlichkeit in der Post-Doc-Phase deutlich erhöhen und frühzeitiger Perspektiven für
alternative Karrieren schaffen. Wir wollen die Vertragslaufzeiten von Promotionsstellen an die
gesamte erwartbare Projektlaufzeit knüpfen und darauf hinwirken, dass in der Wissenschaft
Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden. Wir tragen für eine verbesserte
Qualitätssicherung der Promotion Sorge.
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD),
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S. 23
Es gibt weitere Ideen, wie eine Personalreform für die Wissenschaft vonstattengehen könnte. Die können im Buch nachgelesen werden.
Fazit
Alle essenziell wichtigen Themen werden im Buch ganz ausführlich erklärt. Die Autor*innen haben dabei immer das Ziel vor Augen, auf die prekäre Lage der Wissenschaft in Deutschland hinzuweisen. Das schaffen sie mit einer wissenschaftlich fundierten Art, die dabei gleichzeitig auf das Leid der Betroffenen aufmerksam macht. Denn hinter all unseren Dozierenden stecken Personen mit einem Privatleben, die nicht nur dafür existieren, zu forschen und zu lehren, um dabei ausgebeutet zu werden.
Das Buch ist nicht für eine leichte Sommerlektüre geeignet, denn es ist ein wissenschaftliches Buch, dessen Aufgabe es ist aufzuklären, anstatt zu unterhalten. Dennoch lässt es sich aufgrund der niedrigen Seitenzahl schnell durchlesen. Als Studentin fand ich das Thema, von dem ich zuvor nur oberflächlich hörte, sehr interessant. Deswegen legte ich mir das Buch auch zu. Enttäuscht wurde ich nicht. Ich wurde besser über den Hashtag #IchBinHanna aufgeklärt und über die ganze Thematik, die damit einhergeht. Es war schön zu lesen, dass es sozusagen zu einem Happy End in der Realität kommen kann, da die Autor*innen mögliche Lösungsvorschläge für das Problem aufzeigen.
Wer sich allerdings nicht für die Arbeit in einem wissenschaftlichen Bereich interessiert, sollte lieber zu einem anderen Buch greifen.
Beitragsbild: Maret Becker
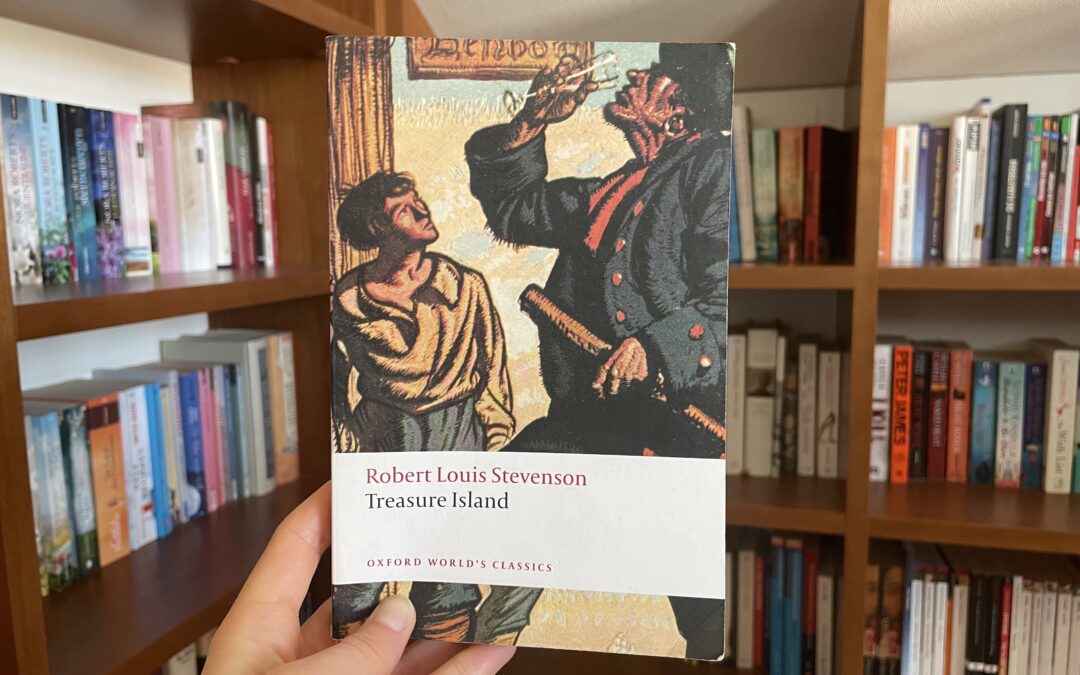
von Kirstin Seitz | 17.06.2022
Das Sommersemester ist in vollem Gange, der Uni-Alltag hat einen im Griff– wer träumt da nicht von einem Urlaub im Paradies? Genau dazu lädt der Roman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson ein. Wäre da nicht ein Problem: Die karibische Insel ist alles andere als ein Paradies! Aber wie kommt es überhaupt dazu?
Der Abenteuerroman Die Schatzinsel (engl. Treasure Island) von Robert Louis Stevenson, der erstmals vom 1. Oktober 1881 bis zum 28. Januar 1882 in Form eines Mehrteilers in der Zeitschrift Young Folks erschienen ist, ist ein Klassiker und wurde bereits über 20 Mal verfilmt. Meine Ausgabe in englischer Sprache ist bei Oxford World’s Classics 2008 erschienen und hat 191 Seiten. Jedoch gibt es auch noch eine Einleitung und einige Extrakapitel. Der Roman handelt davon, dass eine Gruppe von Seemännern und Nicht-Seemännern zu einer Schatzinsel aufbricht, da der Protagonist und Ich-Erzähler in den Besitz einer Schatzkarte gekommen ist. Auf der Insel entwickelt sich dann jedoch alles anders als geplant. Noch bevor sie überhaupt auf der Insel angekommen sind, passiert die erste gravierende Wendung:
I had either fallen asleep, or was on the point of doing so, when a heavy man sat down with rather a clash close by. The barrel shook as he leaned his shoulders against it, and I was just about to jump up when the man began to speak. It was Silver’s voice, and before I heard a dozen words, I would not have shown myself for all the world, but lay there, trembling and listening, in the extreme of fear and curiosity; for from these dozen words I understood that the lives of all the honest men aboard depended upon me alone.
Treasure Island, S. 56
In einem englischen Gasthaus, dem „Admiral Benbow“ bei Bristol schlägt ein alter Seemann sein Quartier auf. Der Ich-Erzähler des Romans, Jim Hawkins der der Sohn des Gastwirtpaares ist, soll für diesen Seemann, genannt William Bill Bones, nach einem einbeinigem Mann Ausschau halten, vor dem dieser Angst hat. Nach kurzer Zeit erscheint ein blinder Bettler, der Bones ein Papier mit einem schwarzen Punkt überreicht. Kurz darauf stirbt Bones an einem Herzinfarkt. Als der blinde Bettler mit seinen Leuten bald darauf das Gasthaus überfällt, können sich Jim und seine Mutter in letzter Sekunde retten. Jim hatte jedoch davor ein Päckchen aus der Kiste von Bones mitgenommen. In dieser befindet sich die Karte einer Insel, auf der es einen Schatz geben soll. Diese Karte zeigt er anschließend dem Arzt Dr. Livesey und dem Gutsherrn John Trelawney, die eine Expedition auf diese Insel beschließen, auf die Jim auch mitkommen darf. Das Abenteuer geht auf der Insel erst richtig los, denn es kommt zu einer unerwarteten Wendung, gefolgt von vielen weiteren. Auf der Suche nach dem Schatz finden sie auch das Skelett eines Piraten, kurz danach ertönt eine Stimme, die sich wie der Verstorbene anhört:
Ever since they had found the skeleton and got upon this train of thought, they had spoken lower and lower, and they had almost got to whispering by now, so that the sound of their talk hardly interrupted the silence of the wood. All of a sudden, out of the middle of the trees in front of us, a thin, high, trembling voice struck up the well-known air and words:-
‚Fifteen men on the dead man’s chest –
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!‘
I never have seen men more dreadfully affected than the pirates. The colour went from their six faces like enchantment; some leaped to their feet, some clawed hold of others; Morgan grovelled on the ground.
Treasure Island, S. 175-176
Das Buch lädt uns ein in eine wundersame Welt mit Piraten, Geheimnissen und auf eine tropische Insel mit einem Schatz. Dem Autor gelingt es, seine Kapitel oftmals mit Spannung zu beenden, sodass man gezwungen ist, weiterzulesen, um herauszufinden, welche neuen Ereignisse nun wieder folgen. Ich konnte das Buch abends schwer aus der Hand legen, denn die Spannung war zu groß. Die Entwicklung der Figuren, besonders der des Long John Silver, sind meiner Meinung nach sehr gelungen und halten Überraschungen bereit. Long John Silver ist ein ambivalenter Charakter, der einem mal etwas sympathisch erscheint und dann doch wieder nicht, was das Buch unter anderem so gut und fesselnd macht. Auch Jim Hawkins macht im Laufe der Geschichte eine Entwicklung durch, zeigt sich aber von Anfang an als intelligent, raffiniert und mutig. Hier ist ein Ausschnitt zu lesen, was er zu den Piraten sagt, als er von ihnen auf der Insel gefangen genommen wird:
your whole business gone to wreck; and if you want to know who did it – it was I! I was in the apple barrel the night we sighted land, and I heard you, John, and you, Dick Johnson, and Hands, who is now at the bottom of the sea, and told every word you said before the hour was out. And as for the schooner, it was I who cut her cable, and it was I that killed the men you had aboard of her, and it was I who brought her where you’ll never see her more, not one of you.* The laugh’s on my side; I’ve had the top of this business from the first; I no more fear you than I fear y fly. Kill me, if you please, spare me. But one thing I’ll say, and no more; if you spare me, bygones are bygones, and when you fellows are in court for privacy, I’ll save you all I can. It is for you to choose. Kill another and do yourselves no good, or spare me and keep a witness to save you from the gallows.‘
Treasure Island, S. 152
Fazit
Alles in allem wird das Buch dem Genre Abenteuerroman auf jeden Fall gerecht und hält auch einige Wendungen in der Geschichte bereit. Gerade die Abläufe auf der Insel sind nicht unbedingt vorhersehbar und machen das Buch spannend. Ich finde es auf jeden Fall empfehlenswert, auch für Erwachsene, selbst wenn das Buch eigentlich unter dem Genre Jugendroman geführt wird. Wer dem Englischen nicht abgeneigt ist, dem empfehle ich es, wie jedes englischsprachige Buch, in der Originalsprache zu lesen. Man muss aber dazu sagen, dass einige Schiff- und Seefahrerbegriffe auftauchen, die mir auch nicht alle geläufigen waren. Davon darf man sich jedoch nicht abschrecken lassen. Manches ergibt sich aus dem Sinn, oder man googelt die Wörter einfach schnell. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass die Geschichte nicht nur aus der Perspektive von Jim Hawkins, sondern auf der Insel auch teilweise von dem Arzt Dr. Livesey erzählt wird. Dadurch erhält man unterschiedliche Eindrücke der Geschichte.
Vielleicht ist ein Entfliehen in eine Welt mit weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser, die noch dazu ein Abenteuer bereit hält, sogar noch besser als nur ein öder Roman, der uns ein Paradies beschreibt.
P.S.: Falls euch der Name des Autors etwas sagt: er hat auch die Novelle The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde geschrieben.
Bild: Kirstin Seitz

von Julian Schlichtkrull | 15.06.2022
Alleine am Rand der Bühne und zur Hälfte im Halbschatten verborgen steht Emma da, gekleidet in eine schlichte orangene Jacke, eine gerade geschnittene Jeans und bereits etwas ausgetretene Turnschuhe. „Hol Luft, Emma“, singt sie, anfangs noch ganz leise und zerbrechlich, dem Publikum entgegen, und macht mit diesen Worten auch sich selbst Mut. Denn Emma hat sich vor Kurzem geoutet und damit nicht nur die Abneigung ihrer Mitschüler*innen und deren Eltern auf sich gezogen. Sie könnte durch eben dieses Outing auch den gesamten Abschlussball ihrer Klassenstufe in Gefahr gebracht haben. Nur wegen des Wunschs nach einem einzigen Tanz mit dem Mädchen, das sie liebt.
Das Musical The Prom – Der Abschlussball, das derzeit im Kaisersaal des Greifswalder Theaters aufgeführt wird, basiert auf dem Stück von Chad Beguelin (2016) und der anschließenden Netflix-Verfilmung (2020). Die Greifswalder Aufführung beeindruckt in erster Linie durch ihre Schlichtheit. Die Bühne ist nur dezent gestaltet – wo wir uns befinden symbolisieren nur ein Spind oder ein Tisch oder vier Bürostühle, die allesamt schnell auf- und abgebaut und hin und her geschoben werden können. Gefühle entstehen vor allem durch die Abwesenheit von großen Effekten und durch das Spiel mit Licht und Dunkelheit, mit den Farben. Und The Prom beeindruckt durch seine Nahbarkeit. Denn der gesamte Cast besteht selbst aus Schüler*innen, denen man abkauft, dass sie verstehen, worüber sie dort sprechen und singen. Die Neunt- bis Zwölftklässler*innen des Jahn-Gymnasiums wissen, was es bedeutet, seinen Platz in der Schubladenwelt finden und behaupten zu müssen, mit der Angst im Hinterkopf, möglicherweise abgelehnt zu werden, von Gleichaltrigen, den Eltern oder vielleicht sogar der ganzen Gesellschaft.
Von Fremdbestimmung und Eigeninitiative
Unterstützt wird Emma bei ihrem Kampf vom Schulleiter und vier etwas in die Jahre gekommenen Broadway-Schauspieler*innen. Es wirkt ein wenig befremdlich und erinnert beinahe an die alltägliche Bevormundung queerer Leute durch nicht-queere Menschen, wenn die Vier ohne Absprache mit Emma für die Schülerin sprechen und handeln. Aber wie so vieles im echten Leben ist auch das Stück ein Prozess. Und so merkt Emma gerade durch die Fehler ihrer Schutzengel-Diven, dass sie anfangen muss, für sich selbst zu sprechen. Wir dürfen sie dabei begleiten, wie sie zunehmend ihre eigene Stimme findet, und auf diesem steinigen Weg nicht nur sich selbst, sondern auch ihren eigentlichen Helfer*innen hilft – sie selbst zu sein, Mut zu haben, für sich einzustehen. Und ein Stück weit hilft sie damit auch uns Zuschauer*innen.
Dabei ist es keinesfalls Emmas Anliegen, diese Bürden auf sich zu laden und der Welt – oder zumindest dem vor Wut kochenden Elternrat – entgegenzutreten. „Ich will keinen Aufstand machen, bin zum Vorbild nicht gemacht“, singt sie und klammert sich dabei verzweifelt an die Hände ihrer Freundin. Und während die Eltern den Ball um jeden Preis verhindern wollen und mit dem Finger auf diejenigen zeigen, die auch für Emma einen Ball fordern, und sich damit gegen das Recht der freien Wahl ein diskriminierendes Arschloch zu sein stellen wollen, steht Emma auf der anderen Seite der Bühne und sagt in einer fast schon absurden Einfachheit: „Ich möchte doch nur zum Abschlussball gehen.“
Die Komik in der Absurdität des Tragischen
Solche Gegenüberstellungen zweier Situationen in der gleichen Szene durchziehen das Stück wie ein roter Faden. Sie verdeutlichen die Ungerechtigkeit und die Hilflosigkeit, wenn man als Einzelne*r gegen alle anderen steht. Und genau diese Ungerechtigkeit ist es, die im Publikum immer wieder teils Unverständnis, teils eine unangemessen wirkende Belustigung auslöst. „Das ist ein Albtraum“, sagt Emma, und ihr Schulleiter erwidert trocken: „Das ist kein Albtraum. Aus einem Albtraum kannst du aufwachen“, und so aus der Ferne betrachtet kann man lachen über diese Worte. Hier im Publikum ist es ja immerhin auch geradezu lächerlich, dass ein erwachsener Mann nur wegen seines Outings seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter haben könnte, von hier aus sieht es absurd komisch aus, wenn die schillernden Broadway-Schauspieler*innen inmitten der schwarzgekleideten Masse stehen, von Akzeptanz singen und dabei von den genervten Monstertruck-Fans ausgebuht werden, die doch eigentlich nur den Sport sehen wollen.
Diejenigen, die solche Szenen aus dem eigenen Alltag kennen, haben aber hingegen vielleicht kein Lachen auf den Lippen, sondern Tränen in den Augen. Man schaut sich einen Moment im Publikum um, blickt in die vielen erheiterten Gesichter, wird zum Nachdenken angeregt. Warum kommt uns Diskriminierung und Ausgrenzung auf der Bühne so absurd und lächerlich vor? Warum können wir hier im Publikum ihre absolute Sinnfreiheit erkennen? Warum gelingt uns das im echten Leben so oft nicht, obwohl es doch täglich direkt in unserer Mitte geschieht?
Ein amerikanisches Musical?
Denn wer regelmäßig nach Neuigkeiten über die LGBTQ+-Community schaut, stolpert andauernd darüber: Im Land der Glorreichen und Freien wurde wieder ein Gesetz gekippt, hat wieder eine weitere Minderheit ihre Rechte verloren. Ob es das im März verabschiedete Don’t say gay bill Floridas ist, nach dem Erzieher*innen und Lehrkräfte gegenüber Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter nichts mehr erwähnen dürfen, das gleichgeschlechtliche Liebe oder trans*-Identitäten andeuten und damit Kinder frühsexualisieren könnte (keine Sorge, Genderparties und Trickfilm-Küsse zwischen Disneyprinz und -prinzessin sind selbstverständlich weiterhin erlaubt). Oder ob es die verschiedenen Gesetze der Südstaaten sind, die alle bereits in diesem Jahr beschlossen wurden und unter anderem Eltern und Lehrkräften mit bis zu 10 Jahren Gefängnis drohen, wenn diese ihren trans*-Kindern helfen wollen, sich in ihrem Körper wohler zu fühlen. Auch der reale Fall McMillen v. Itawamba County School District, auf dem The Prom beruht und bei dem einer Schülerin die Teilnahme an ihrem eigenen Abschlussball verweigert werden sollte, nur weil sie ihre Freundin als Begleitung mitbringen wollte, ist gerade einmal 12 Jahre her, und auch wenn dieser Prozess große Medienaufmerksamkeit erhielt, ist er bei Weitem kein Einzelfall.
Aber das ist ja nur Amerika, nicht wahr? In Deutschland dürfen wir immerhin schon seit nun fast 5 Jahren unsere gleichgeschlechtlichen Partner*innen heiraten (zur besseren Anschaulichkeit: die „Ehe für Alle“ ist damit vom Anfang der Coronapandemie genauso weit entfernt wie wir heute), und seit bereits etwas mehr als 10 Jahren kann ich theoretisch mein Geschlecht im Ausweis ändern lassen, ohne zwangssterilisiert zu werden. Großartig! Und trotzdem wirkt die Rhetorik des Elternrats an Emmas Schule nur allzu vertraut. Denn sie wird noch immer zahlreich genutzt, auch hier. Es ist erschreckend, wenn man ohnmächtig wie Emma und ratlos wie zwischen all den lachenden Zuschauer*innen dabei zusehen muss, wenn die Partei dieBasis, die erst am vergangenen Sonntag in der Greifswalder OB-Wahl auf mehr als 8 Prozent aller Stimmen kam, in ihren Artikeln sichtbar queere Menschen als „extremste Beispiele“ beschimpft und im gleichen Atemzug glaubt, für „unauffälligere“ queere Menschen sprechen zu können, die sich angeblich von all jenen „von der Realität weit entfernten“ Individuen angegriffen fühlen. Würden wir über diese Art der Diskriminierung auch lachen, wenn wir sie mit genug Distanz auf der Theaterbühne sehen würden?
The Prom – Der Abschlussball wird noch drei Mal im Kaisersaal aufgeführt, an diesem Donnerstag, Freitag und Samstag. Gespielt von Schüler*innen des Jahn-Gymnasiums ist es sicherlich ein Stück, dass in erster Linie Freund*innen und Familie in den Theatersaal lockt, aber das sollte es nicht sein. Denn Emmas Geschichte ist nicht nur aus der Begeisterung einer Gruppe von Jugendlichen für eine Netflix-Adaption entstanden, sondern aus der Realität unserer Gesellschaft. Und es ist eben diese Nähe zu unseren eigenen Erfahrungen von Diskriminierung – egal welcher Art –, die das Stück für das gesamte Publikum so fühlbar macht und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Das Wichtigste auf einen Blick:
Was? Musical The Prom – Der Abschlussball
Wann? Donnerstag, Freitag, Samstag, 16., 17. und 18.06.2022, jeweils 19:30 Uhr
Wo? Kaisersaal, Theater Greifswald
Preis? 12 Euro, ermäßigt für Studierende 10 Euro; Karten sind online oder an der Abendkasse erhältlich
Beitragsbild: Julian Schlichtkrull
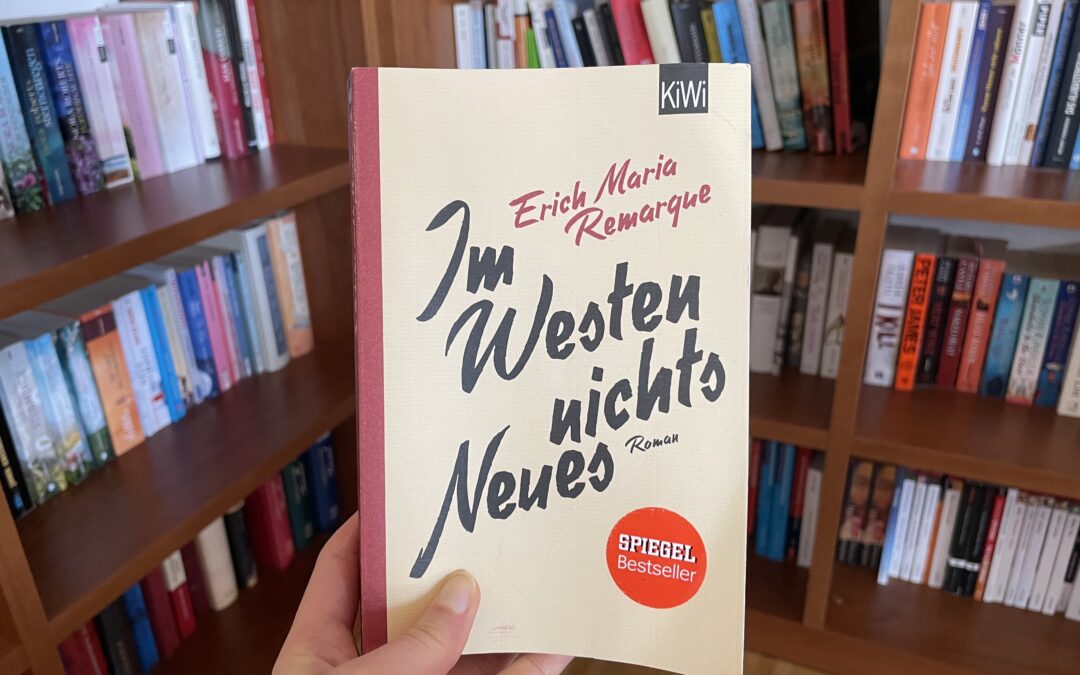
von Kirstin Seitz | 05.05.2022
Zugegeben: Das Thema Krieg ist so aktuell wie selten zuvor in den letzten Jahren. Wen es nicht stört, dazu auch ein Buch zu lesen – das jedoch einen anderen Krieg behandelt, nämlich den Ersten Weltkrieg – der sollte Im Westen nichts Neues unbedingt lesen! Und allen anderen würde ich empfehlen, sich das Buch trotzdem zu merken und es später in die Hand zu nehmen. Gelesen haben sollte es aber meiner Meinung nach jede*r! Man bekommt einen sehr guten Eindruck, wie der Erste Weltkrieg für Soldaten abgelaufen ist und erhält vor allem auch Einblicke in die grauenvolle Seite des Kriegs.
Der Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque erschien erstmals 1928 als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung und als Buch am 29. Januar 1929 beim Propyläen Verlag. Er hat in meiner Fassung samt Anhang 325 Seiten, die Geschichte selbst umfasst 259 Seiten, der reine Fließtext hat 252 Seiten. Der Roman schildert die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten und zählt zu einem Klassiker der Weltliteratur.
Das Buch startet nicht mit einer Einleitung, wie die Männer zum Krieg gekommen sind, sondern beginnt in medias res: man wird sofort in die Welt des Krieges hineingezogen. Der Roman zeigt den Leser*innen die Welt des Krieges aus der Sicht des jungen Soldaten Paul Bäumer. Während der Geschichte verliert er Freunde, berichtet vom alltäglichen Kriegsleben, seiner Verletzung mit anschließendem Lazarettbesuch, seinem Heimaturlaub und wie er sich von dem normalen Leben distanziert hat, von ungerechten Vorgesetzten und von den Grauen des Ersten Weltkrieges. Im folgenden Zitat bekommt man einen Einblick, wie Paul Bäumer und seine Kameraden von ihrem Vorgesetzten Himmelstoß tyrannisiert wurden:
Er galt als der schärfste Schinder des Kasernenhofs, und das war sein Stolz. […] Auf Kropp, Tjaden, Westhus und mich hatte er es besonders abgesehen, weil er unseren stillen Trotz spürte. Ich habe an einem Morgen vierzehnmal sein Bett gebaut. Immer wieder fand er etwas daran auszusetzen und riß es herunter. […] ich habe auf seinen Befehl mit einer Zahnbürste die Korporalschaftsstube sauber geschrubbt […] ich habe in vollem Gepäck mit Gewehr auf losem, nassem Sturzacker „Sprung auf, marsch, marsch“ und „Hinlegen“ geübt, bis ich ein Dreckklumpen war und zusammenbrach;
Im Westen nichts Neues, S. 26-27
Mir persönlich hat kein anderes Buch einen so guten Eindruck vom Ersten Weltkrieg vermittelt wie dieses. Es beschönigt nichts, es glorifiziert nichts, es beschreibt meiner Ansicht nach wirklich, wie ein Soldatenleben während des Krieges ausgesehen haben kann. Es problematisiert vor allem die Schrecken des Krieges und zeigt, dass die jungen Männer eine verlorene Generation waren, wenn sie vom Krieg zurückkehrten, denn sie konnten mit dem normalen Leben nichts mehr anfangen. Es zeugt sowohl von der Ungerechtigkeit des Krieges, aber auch davon, wie normal er für die Soldaten teilweise wurde.
Albert spricht es aus. „Der Krieg hat uns für alles verdorben.“ Er hat recht. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns. Vor unserem Leben. Wir waren achtzehn Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mußten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran; wir glauben an den Krieg.
Im Westen nichts Neues, S. 80-81
Dieser Antikriegsoman stieß bei seiner Veröffentlichung in Deutschland jedoch nicht überall auf Anerkennung: Er wurde von den Nationalsozialisten missbilligt und wurde 1933 Opfer der Bücherverbrennung. Fünf Jahre später wurde dem Autor zudem die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.
aber bedenk doch mal, daß wir fast alle einfache Leute sind. Und in Frankreich sind die meisten Menschen doch auch Arbeiter, Handwerker oder kleine Beamte. Weshalb soll nun wohl ein französischer Schlösser oder Schuhmacher uns angreifen wollen? Nein, das sind nur die Regierungen. Ich habe nie einen Franzosen gesehen, bevor ich hierherkam, und den meisten Franzosen wird es ähnlich mit uns gehen. Die sind ebensowenig gefragt wie wir.“ „Weshalb ist denn überhaupt Krieg?“ fragt Tjaden. Kat zuckt die Achseln. „Es muß Leute geben, denen der Krieg nützt.“ „Na, ich gehöre nicht dazu“, grinst Tjaden. „Du nicht, und keiner hier.“
Im Westen nichts Neues, S. 182
Fazit
Neben dem bereits beschriebenen Eindruck gefällt mir besonders gut, dass der Autor selbst im Ersten Weltkrieg gedient hat. Das heißt, dass er weiß, wovon er spricht und wahrscheinlich wirkt das Buch genau deshalb so authentisch. Man sollte jedoch als Leser*in kein Problem mit Beschreibungen von Gewalt und Verletzungen haben, denn gerade letzteres wird sehr eindrücklich und nicht beschönigend dargestellt. Es lohnt sich auch absolut, den Anhang zu lesen, da dort Entwürfe des Romans und ein Nachwort zur Entstehungsgeschichte abgedruckt sind.
Ich bin jung, ich bin zwanzig Jahre alt; aber ich kenne vom Leben nichts anderes als die Verzweiflung, den Tod, die Angst und die Verkettung sinnlosester Oberflächlichkeiten mit einem Abgrund des Leidens. Ich sehe, daß Völker gegeneinandergetrieben werden und sich schweigend, unwissend, töricht, gehorsam, unschuldig toten.
Im Westen nichts Neues, S. 233
Meine Fassung ist die 8. Auflage und ist 2017 im Kiepenhauer und Witsch Verlag erschienen.
Beitragsbild: Kirstin Seitz

von Thore Fründt | 02.05.2022
Kaum ein Film wurde 2022 mit einer vergleichbaren Erwartungshaltung antizipiert, wie die dritte Instanz der „Phantastische Tierwesen„-Reihe von Warner Bros. Der Grund dafür war nicht zuletzt die mehrfache Verschiebung des Erscheinungsdatums von „Phantastische Tierwesen. Dumbledores Geheimnisse„. Weiterhin wurde der Film schon vor seiner Fertigstellung von Skandalen begleitet. Darunter die vorgeworfene Transphobie J.K. Rowlings, basierend auf einigen Tweets der Autorin im Juni 2020, und der Schauspielerwechsel des Antagonisten im Film. Dieser Artikel konzentriert sich nun allerdings auf die Kunst, die sich hinter dem Tarnumhang des Medienrummels verbirgt.
Eine Welt im Wandel
Der dritte Film des voraussichtlich fünfteiligen Franchises führt uns in die 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Wie auch in den vorherigen Instanzen wird in puncto Handlung auf internationale Drehorte gesetzt. Während Teil eins und zwei vorwiegend in den U.S.A. und Paris spielten, setzt der dritte Teil noch einen drauf. So spielt der Film unter anderem im Dschungel Brasiliens, im südasiatischen Buthan und sogar in Deutschland finden sich unsere Protagonist*innen zwischenzeitig wieder. Wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann – also 1930er Jahre plus Deutschland – muss kein*e Historiker*in sein, um sich denken zu können, dass das deutsche Zaubereiministerium nicht ganz so gut wegkommt in diesem Film.
Die Welt ist im Wandel und damit lässt sich auch das Thema des Films gut einleiten. Wie stoppt man diesen Bösewicht Grindelwald, der versucht, an die Macht zu gelangen und Menschen zu unterdrücken? Denn das eigentlich Gefährliche an der Figur ist ihr Charisma, dass Mads Mikkelsen ihr großartig zu geben vermag. Während der Antagonist der Harry-Potter-Reihe seine Macht durch die Etablierung von Angst in der Zaubereigesellschaft festigte („Du weißt schon wer“), schafft Grindelwald dies mit einem verquerten Idealismus, der für die Allgemeinheit sehr verlockend zu sein scheint. Dieser Verlockung wollen sich Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seine Gefährt*innen nun entgegenstellen. Ein schwieriges Unterfangen, da Grindelwald, wie bereits in Teil zwei etabliert wurde, als Seher in die Zukunft schauen kann. Wie hält man also jemanden auf, der die eigenen Pläne voraussieht?
Der Plan, keinen Plan zu haben
So beginnt also ein Katz-und-Maus-Spiel, das für Verwirrung sorgen soll. Leider ist das jedoch nicht nur für den Antagonisten der Fall. Auch der*die Zuschauer*in fragt sich zwischendurch, was hier eigentlich abgeht. Durch die Vielzahl an Figuren, die alle verschiedene Aufgaben haben, wird aus den Handlungssträngen zwischenzeitig eher ein Handlungsknoten, den nichtmal Houdini in 142 Minuten Filmdauer lösen könnte. So wird der Eindruck erweckt, dass auch der Film an sich eher nach dem Plan handelt, keinen Plan zu haben. Ein Vorwurf, dem sich auch schon der Vorgänger, „Grindelwalds Verbrechen“, stellen musste.
Die Lösung für dieses Problem sollte bei „Dumbledores Geheimnisse“ in Form von Steve Kloves kommen. Kloves war der Screenwriter von sieben der insgesamt acht Harry-Potter-Instanzen und hatte bereits bewiesen, dass er J.K. Rowlings komplexe Welt der Bücher sehr gut in die kompakte Welt der Filmscripts übertragen konnte. Nun sollte er also mit J.K. Rowling zusammen für den Film schreiben. Man sieht seinen Einfluss auf das Script an manchen stellen des Films zwar durchaus positiv durchscheinen, aber trotzdem wirkt der Film oft gleichzeitig gehetzt und langatmig und alles in allem etwas ziellos. Das vergisst man allerdings schnell wieder, wenn das 200-Mio.-Dollar-Spektakel – so viel hat der Film nämlich gekostet – tief in die CGI-Kiste greift und ein paar sehr beeindruckende Visual Effects auspackt. Trotzdem bleibt manches in dem Film rätselhaft.
Rowlings Geheimnisse
Die Harry-Potter-Enthusiast*innen, die sich mit „Dumbledores Geheimnisse“ Antworten auf die vielen Fragen aus Teil zwei erhofft hatten, werden in vielerlei Hinsicht leider enttäuscht. Es wirkt, als ob J.K. Rowling sich nicht mehr an die Regeln ihrer eigens kreierten Welt hält, die so liebevoll, komplex und wunderbar weird ist. Es sind zwar meist nur Kleinigkeiten, wie beispielsweise, dass Dumbledore nicht „Verteidigung gegen die dunklen Künste“, sondern „Verwandlung“ unterrichtet hat, oder etwa, dass Minerva McGonagall, die im Film als Lehrerin auftaucht, eigentlich erst 1935 geboren wurde. Allerdings fragt man sich eben deshalb, weil es solche Kleinigkeiten sind, warum die Entscheidung getroffen wurde, sich nicht an die Informationen der Buchvorlage zu halten. Es kommt einem wie ein komischer Fanservice vor, der die Hardcore-Fans eher re-serviert werden lässt.
Aber möglicherweise ist dies auch Teil eines größeren Plans, den J.K. Rowling gerade ausheckt. Vielleicht ist es ein gewollter Aspekt der Narratologie dieser Reihe, dass manche Unstimmigkeiten bestehen und am Ende werden sie möglicherweise sogar aufgelöst. Ob Rowlings Geheimnisse eine bewusste narratologische Entscheidung sind, oder ob es sich bei der „Phantastische Tierwesen“-Reihe wirklich um ein planloses Spektakel handelt, wird sich in den nächsten Instanzen der Filmreihe zeigen.
Beitragsbild: Jules Marvin Eguilos
Seite 5 von 7« Erste«34567»