
von moritz.magazin | 04.10.2013
 Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.
Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.
„Warum ich mich engagiere? Ich brauchte ein Hobby und eine Tätigkeit, die mich erfüllte. Ich war rastlos und das Studium stresste sehr. Das Radio ist mein Ausgleich“, erklärt Fanny Pagel, die stellvertretende Chefredakteurin des radio 98eins‘ ist. Chefredakteurin Franziska Hain kann diese Aussage nur bestätigen: „Die ganze Arbeit im Sender macht Spaß! Vom Schreiben bis zum Einsprechen – und außerdem trifft man immer nette Leute.“
Laut einer Studie der Hochschul-Informarions-System GmbH, die 4 000 deutsche Studenten befragt haben, engagieren sich rund zwei Drittel in sportlichen, politischen, sozialen oder kulturellen Vereinen – so auch die beiden Radioredakteurinnen. Zu ihren Aufgaben im Radio gehören neben dem Einsprechen von Nachrichten oder dem Schreiben von Artikeln auch das Organisieren von Sendeplänen, die Qualitätssicherung der Sendungen sowie die Verwaltung der Musik. Doch trotz des hohen zeitlichen Aufwandes würden die Geschichtsstudentinnen, die aufgrund der Suche nach einem Praktikum auf radio 98eins gestoßen sind, ihre Arbeit nicht aufgeben wollen.
Kultur macht Spaß
Auch Isabella Metelmann, Clubmeisterin im Rotaract Greifswald, nimmt die Vereinsarbeit nicht als Belastung wahr. Besonders der Gedanke, anderen Menschen helfen zu können, gefällt der Medizin- und Politikwissenschaftsstudentin am Rotaract Greifswald „Egal, ob es sich dabei um Aufräumaktionen im Wald, das Kleidersammeln für die Greifswalder Tafel oder Benefizpartys handelt“, erklärt sie.
Durch genau solch einen Benefizabend ist Isabella vor vier Jahren auf den Verein aufmerksam geworden und war von Anfang an vom Rotaract und seinen motivierten Mitgliedern begeistert. Eine sehr beliebte Form der Spendenparty ist Profs@turntables, das auch in diesem Wintersemester wieder stattfinden wird. Das Besondere an Profs@turntables ist, dass die Dozenten am DJ-Pult sitzen und den Takt vorgeben. Im vergangenen Jahr konnten so insgesamt 4 500 Euro an das Projekt „Polio Plus“ gespendet werden, dieses Jahr soll der Erlös an „Schulbausteine für Gando e.V.“ gehen. Das Projekt wurde von Francis Kéré organisiert, der ein Architekt aus Burkina Faso ist und dort sozial und ökologisch nachhaltige Bildungseinrichtungen baut, erzählt Isabella. „Und es wird mal wieder hochprominent“, verrät die 21-jährige dann noch. „Prorektor Professor Schumacher hat zugesagt, dieses Jahr Platten aufzulegen! Und auch fünf weitere Dozenten sind mit dabei: Professor Kischel, Professor Steinmetz, Professor Heckmann, Doktor Radau und Doktor Söhnel.“
Neben dem Helfen gehört aber auch das gemütliche Beieinandersitzen dazu: Alle zwei Wochen treffen sich die Rotaractmitglieder, wie der Name schon sagt, zu einem rotierenden Stammtischtreffen „zum entspannten Quatschen und Zusammensitzen – das klappt natürlich am Besten in den verschiedenen Bars in Greifswald“, erklärt Isabella mit einem Augenzwinkern. Auch Ulrike Kurdewan, die sich seit drei Jahren im Vorstand des StudentenTheaters engagiert, schätzt die Zusammenarbeit und das Gemeinschaftsgefühl. „Mein letztes eindrucksvolles Erlebnis mit StuThe war ein Projekt mit unserem Partnertheater Teatr Brama im Juli. Wir waren auf dem Land in der Nähe von Stettin und haben zwei Wochen lang nichts anderes gemacht als Theater, Musik und Artistik. Am Ende gab es eine große Performance auf der Freilichtbühne in Goleniow. Das Schöne an dem Projekt ist, dass ich weiß, dass das erst der Anfang einer zukünftigen Zusammenarbeit ist. Im letzten Sommer haben wir auch schon zusammengearbeitet und im nächsten Sommer geht es sicher weiter“, erzählt die 26-jährige, die Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Eher durch Zufall ist Ulrike mit dem StudentenTheater in Greifswald in Berührung gekommen. Dadurch dass alle Mitglieder kleinere Aufgaben übertragen bekommen, würde man schnell in die Vereinsarbeit einbezogen, erklärt sie. Mittlerweile möchte sich Ulrike aus dem Vorstand zurückziehen, um Platz für neue engagierte Studenten zu schaffen, denn diese Arbeit, in der es darum geht, neue Akteure zu gewinnen, Erstsemesterveranstaltungen oder das wöchentliche Theatertraining zu organisieren, nimmt wie jede ehrenamtliche Tätigkeit einige Zeit in Anspruch.
Zeitmangel als Grund für Nichtengagement
So ist der Mangel an Zeit laut einer Umfrage der Prognos Arbeitsgemeinschaft als häufigster Grund für Nicht-Engagement genannt worden. Auch Studenten fehlt häufig die Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Denn obwohl zwei Drittel aller Hochschüler Ehrenämter wahrnehmen, beispielsweise als Nachhilfelehrer oder Basketballtrainer, sind die wenigsten von ihnen regelmäßig mehrmals in der Woche aktiv, so die Studie der Hochschul-Informations-System GmbH. Genügend Anreize, sich neben dem Studium freiwillig und unentgeltlich zu engagieren, scheint es für Studenten demnach nicht zu geben.
Auf der Vollversammlung der Studierendenschaft 2012 forderten Milos Rodatos, Henri Tatschner und Erik von Malottki neben der Wertschätzung von ehrenamtlichen sozialen, politischen oder sportlichen Tätigkeiten eine besondere Aufmerksamkeit in Form eines Preises für „herausragendes studentisches Engagement“ sowie Credit Points. Aber braucht es für ehrenamtliches Engagement wirklich einen Preis?
Isabellas Antwort ist eindeutig: „Nein, denn ehrenamtliche Arbeit braucht keine Vergütung. Das ist ja gerade das Schöne daran: dass es Menschen sind, die motiviert sind, weil sie Lust haben, etwas zu tun und nicht, weil es ihnen einen Vorteil verschafft.“ Und auch Radioredakteurin Fanny empfindet diese Art von Anreiz als ein Wettbewerb, der in Ehrenämtern fehl am Platze sei: „Man sollte ehrenamtlich arbeiten, weil man Spaß an der Sache hat und nicht irgendwelchen Punkten oder Preisen nachjagt.“
Eine kleine Auszeichnung oder Anerkennung für alle ehrenamtlichen Studenten fänden Franziska und Ulrike allerdings gar nicht verkehrt. „Es gibt Universitäten, an denen das StudentenTheater in die Lehre so eingebunden wird, dass eine Inszenierungsarbeit über ein Semester als Lehrveranstaltung fungiert“, erklärt Ulrike. „Das wünsche ich mir für unsere Universität auch.“
Punkte fürs Helfen?
Tatsächlich gibt es diese Art der Integration von ehrenamtlichem Engagement in das theoretische Studium schon seit längerer Zeit in den USA. Seit 2003 gibt es dies auch an der Universität Mannheim, an der der Pädagoge Manfred Hofer das erste deutsche Service-Learning-Seminar angeboten hat. Bei diesen Seminaren soll das theoretisch gelernte Wissen im Umfeld praktisch angewendet werden. Medienwissenschaftler würden demnach beispielsweise ehrenamtlich beim Radio oder in anderen Medien arbeiten und unter Anleitung eines Dozenten Projekte entwickeln, die sie dort verwirklichen könnten. Preise gibt es keine, jedoch werden für das Service-Learning-Seminar wie für andere Seminare im Studium Credit Points angerechnet – und ganz nebenbei hat man sich auch noch gesellschaftlich engagiert.
Zwar gibt es schon von der Universität Greifswald geforderte Pflichtpraktika, die mit Leistungspunkten honoriert werden, doch der Idee, die hinter dem Service-Learning-Seminar steckt, wird man damit nicht gerecht. Denn dieses Praxis-Seminar gibt Studenten die Möglichkeit, sich langfristig – und nicht nur für zehn Wochen während der Semesterferien – für kulturelle, sportliche, naturverbundene oder soziale Vereine in ihrer Umgebung einzusetzen. Dabei werden die Studenten mit der Verantwortung nicht allein gelassen, sondern von ihrem Dozenten betreut.
Um dieses Konzept in den Hochschulen zu verbreiten und zu etablieren, wurde das Netzwerk „Bildung durch Verantwortung“ gegründet. Neben der Universität Duisburg-Essen gehören auch die Universitäten Erfurt, Würzburg und des Saarlandes sowie die Fachhochschule Erfurt zu den Gründungsmitgliedern.
Gemeinschaft, Spaß und die Tatsache, seine Zeit neben dem Studium sinnvoll zu verbringen – das sind die Motive, sich zu engagieren, sei es bei Amnesty International, GreiMUN, Unicef, den moritz-medien, dem Orchester, dem Greifswalder Märchenkreis, den Kunstwerkstätten oder bei der Stadtbibliothek; ehrenamtliche Vereine und Organisationen leben von Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Einen materiellen Preis gibt es dafür nicht, aber darum geht es bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit auch nicht. Stattdessen steht die Tätigkeit im Mittelpunkt und die Möglichkeit sein direktes Umfeld kreativ mitzugestalten, wie Gauck in seiner Rede am 23. März 2012 in Berlin schon sagte: „Ihr seid Bürger, das heißt Gestalter, Mitgestalter. Wem Teilhabe möglich ist und wer ohne Not auf sie verzichtet, der vergibt eine der schönsten und größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins: Verantwortung zu leben.“
Ein Feature von Sabrina von Oehsen.

von moritz.magazin | 04.10.2013
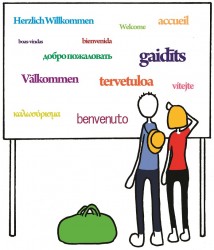 Das Studentenleben besteht nicht nur aus Vorlesungen, Seminaren oder Prüfungen. Dort knüpft man zwar neue Kontakte, allerdings erhöht das Engagement bei einem Verein die Chancen auf noch mehr Bekanntschaften. In Greifswald gibt es einige Möglichkeiten, die das erleichtern: Die Mitarbeit in Vereinen wie GrIStuF, LEI oder Capufaktur.
Das Studentenleben besteht nicht nur aus Vorlesungen, Seminaren oder Prüfungen. Dort knüpft man zwar neue Kontakte, allerdings erhöht das Engagement bei einem Verein die Chancen auf noch mehr Bekanntschaften. In Greifswald gibt es einige Möglichkeiten, die das erleichtern: Die Mitarbeit in Vereinen wie GrIStuF, LEI oder Capufaktur.
Schummrig ist es, wenn man den Keller der Alten Frauenklinik in der Wollweberstraße betritt. Ein paar klapprige Schränke stehen im Flur und alte Tische in den Ecken. An den Türen prangen Schilder aus der Zeit, als die Frauenklinik noch genutzt wurde; sie weisen den Weg zur „Wäscherei“ und dem „Krankenblattarchiv“. Doch jetzt befinden sich hier keine Krankenblätter mehr, jetzt ist der Keller das Reich vom Greifswald International Students Festival (GrIStuF e.V.).
Der Verein organisiert seit 2002 regelmäßig drei große Veranstaltungen: das Running Dinner, die Fête de la musique und das alle zwei Jahre stattfindende Festival. Wöchentlich finden dazu die Sitzungen statt, zu denen sich seit ein paar Monaten auch Magdalene Majeed gesellt. Neben GrIStuF arbeitet die Masterstudentin für Organisationskommunikation noch im Allgemeinen Studierendenausschuss und in ihrem Fachschaftsrat mit. „Das ist natürlich extrem zeitintensiv“, gibt sie zu, „aber man kriegt das alles schon unter einen Hut. Man muss sich nur die Zeit gut einteilen.“ Sie begeisterte sich für den Verein in ihrer ersten Woche in Greifswald, als sie dessen Schnuppersitzung besuchte. „In Bamberg, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, war das Angebot an studentischer Kultur nicht so groß. Und dann kam ich hierher und hab den Verein für mich entdeckt. Da dachte ich mir: Geh ich doch einfach mal vorbei!“, erzählt sie lächelnd. Magdalene freut sich schon sehr auf das anstehende Festival: „Es wird stressig, keine Frage, aber ich mag das. Ich brauche diesen Stress.“ Natürlich habe das Studium ein bisschen gelitten durch die ehrenamtlichen Aufgaben, aber Magdalene hat kein Problem damit, ein Semester länger zu studieren: „Ich mache das eben sehr gerne. Dafür nehme ich mir gerne die Zeit und verlängere um ein Semester.“
Durch das Sitzungszimmer spannt sich eine Leine mit Briefumschlägen, die mit den Namen der Mitglieder beschriftet sind. Aus einigen schauen Zettel hervor. An der Wand pinnt ein erster Entwurf vom Ablaufplan des Festivals, mit dem die Mitglieder allerdings noch nicht hundertprozentig zufrieden sind. Ungefähr ein Jahr, bevor das Festival stattfindet, beginnt das Team mit den Planungen. Magdalene sowie Anne Tober sind Teil der PR-Gruppe, in der unter anderem das Design des Festivals entwickelt wird: Das Logo, die Gestaltung der T-Shirts und der Homepage fallen darunter. „Man lernt auf jeden Fall etwas, das man im normalen Studium nicht lernt. Hier steigt man in solche großen Projekte ein und eignet sich alles learning by doing an“, schwärmt Magdalene. Anne ergänzt: „Ich freue mich darauf, kreativ sein zu können bei der Gestaltung des Logos. Da kann man sich schon recht gut ausleben.“ Sie schreibt gerade an ihrer Diplomarbeit in Biologie und ist erst vor kurzem zu GrIStuF gestoßen: „Zwei meiner Mitbewohner waren vorher schon dabei. Ich allerdings habe mich recht spät entschlossen mitzumachen.“ Durch den Aufruf „Die Fête fällt aus!“, der vom Verein gestartet wurde, weil es zu wenig Engagierte gab, hat sie sich endgültig zu einer Mitarbeit entschieden. Beide sind sehr gespannt auf die Teilnehmer, die aus vielen verschiedenen Ländern kommen. „Jeder bringt seine eigene Geschichte mit, weshalb er hier ist. Ich freue mich auch darauf, ihnen Greifswald zu zeigen, weil Greifswald eine tolle Stadt ist“, erklärt Magdalene.
Während die Sitzungen bei GrIStuF auch in den Semesterferien weitergehen, hat Sabryna Junker diesbezüglich wenig zu tun. Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Lokalen Erasmus Initiative (LEI n.V.). „Während der Semesterferien bin ich dabei, die alten Unterlagen zu sortieren, um zu schauen, was aktualisiert werden muss. Weil mir die alten Sitzungsprotokolle in die Hände gefallen sind, weiß ich auch wieder ganz genau, wann ich zu LEI gestoßen bin: am 16. Oktober 2007“, erzählt sie lachend. In den Semesterferien sei eigentlich nur der Vorstand aktiv, alle anderen Mitglieder stoßen kurz vor Beginn des Semesters wieder dazu. Für die ausländischen Studierenden gibt es schon eine Woche vor der Erstsemesterwoche Veranstaltungen, bei denen sie die Stadt kennen lernen oder letzte organisatorische Dinge klären können.
Nach der Arbeit zu der Sitzung
Sabryna macht gerade Feierabend von ihrer Doktorarbeit am Institut für Mikrobiologie. Durch den Job ist sie zeitlich nicht mehr so flexibel wie früher während des Studiums. „Ich hatte tagsüber mehr Zeit, ich war nie von 8 bis 18 Uhr in der Universität. Dadurch war es natürlich einfacher Termine, wie Behördengänge, zu erledigen“, erklärt Sabryna. Sie rief die Stadtführung für die Erasmusstudenten ins Leben. Diese zählt inzwischen zu dem Repertoire, dass LEI jedes Semester anbietet. „Wir wollen den Studenten das Einleben in die Stadt und eine Integration in die Studierendenschaft erleichtern. Sie sollen deutsche Studenten, Greifswald und die Region kennen lernen“, zählt sie auf. Deswegen organisieren die LEI-Mitglieder neben Partys auch Fahrten in Großstädte wie Berlin oder Hamburg, aber auch nach Rügen oder Usedom. „Jeder kann hier die Aufgabe übernehmen oder die Veranstaltung organisieren, auf die er Lust hat“, meint Sabryna. Ihr selbst liegen eher die organisatorischen Dinge: Mit der Verwaltung sprechen, die Finanzierung planen oder eben alte Unterlagen sortieren. Sie erklärt lachend: „Ich arbeite lieber im Hintergrund. Mir macht die Arbeit Spaß, die normalerweise keiner machen will.“ Schon zu Schulzeiten war das Interesse, sich für ausländische Schüler zu engagieren, bei ihr sehr ausgeprägt. „LEI war eine willkommene Gelegenheit, das umzusetzen“, erläutert Sabryna.
Mittlerweile gibt es 15 bis 20 Mitglieder, die um die 20 bis 30 Veranstaltungen pro Jahr planen und durchführen. „Die Initiative ist viel größer geworden. Im Oktober 2006, beim ersten Treffen, kamen sechs oder sieben Leute zusammen, um zwei bis drei Veranstaltungen zu organisieren“, erzählt Sabryna, „Jetzt haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, etwas auf die Beine zu stellen.“ Durch LEI lerne man neue Kulturen und Bräuche kennen. Die Nachtschicht, die jedes Semester stattfindende Schnitzeljagd durch Greifswald, brachte beispielsweise ein tschechischer Student aus seiner Heimat mit. Für Sabryna steht fest: „Es ist eine recht unkomplizierte Möglichkeit viele Leute und auch das kennen zu lernen, was neben dem Studium abläuft.“ Durch LEI hat sie viele Kontakte geknüpft zu Leuten innerhalb ihres Studiengangs, zu ausländischen Studenten, wobei der Kontakt auch erhalten blieb, nachdem die Studenten wieder in ihre Heimat zurückgegangen sind. „Ich habe auch sehr viel mehr über meine Region und die Universität kennen gelernt, als ich als Student kennen gelernt hätte, wenn ich nur geradeaus geschaut hätte“, hält sie fest.
Aufnahmeverfahren schreckt nicht ab
Anders als bei GrIStuF und LEI, bei denen man einfach bei den Sitzungen vorbeischauen kann, hat die studentische Unternehmensberatung Capufaktur e.V. ein Aufnahmeverfahren. Der Vereinsmitglieder arbeiten in verschiedenen Projekten mit meist regionalen Firmen zusammen. So haben sie zum Beispiel das Konzept für das Karriereportal „UNIchance“ der Universität Greifswald mitentwickelt (moritz berichtete im Heft 103). „Wir haben ein Assessment Center, bei dem wir unter anderem die Teamfähigkeit testen“, erklärt Jette Dowe, die seit ihrem fünften Semester bei dem Verein dabei ist. Danach muss jeder Anwärter auch ein Anwärterprojekt als eine Art Probedurchlauf mitmachen, bevor man offiziell Berater wird. „Man kann natürlich jederzeit als Interessent auch so zu den Vereinsrunden kommen, allerdings ist es dann abhängig vom jeweiligen Ressortleiter, ob man aktiv mitarbeiten kann“, erklärt Ersin Ceylaner, einer der Vorstandsvorsitzenden. Dieses Aufnahmeverfahren wird nur zu Beginn des Semesters angeboten. „Wir haben dieses Verfahren eingeführt, als ich im Vorstand war“, erklärt Jette, „denn damals sind sehr viele Anwärter von ihren Projekten abgesprungen, was die verbliebenen Mitglieder demotivierte.“ Abschreckend wirkt das Aufnnahmeverfahren anscheinend aber nicht: Zum letzten Termin waren über 60 Studenten da, weswegen drei Assessment Center organisiert wurden.
Ersin und Jette sitzen gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins in der Cafeteria in der Mensa am Berthold-Beitz-Platz, um zu frühstücken, und sich danach auf ihre Prüfungsvorbereitungen zu stürzen. Die meisten Mitglieder sind BWL-Studenten, so auch Ersin und Jette. Beide lernten Capufaktur zu Beginn ihres Studiums kennen, entschieden sich aber später zum Beitritt. „Man sagt sich immer, man will das später machen, aber je eher man beginnt, desto besser kann man seine Zeit managen“, findet Ersin. Bei der Capufaktur gibt es zwei Karrieren, die man gehen kann. Es gibt auf der einen Seite eine Art „Vereinskarriere“: Man startet Anwärter, wird dann Ressortleiter und kann später Vorstandsmitglied werden. Dann gibt es aber noch die „Projektkarriere“ mit den Stufen Projektteammitglied, Projektleiter, Projektmanager. Jette hält fest: „Ich konnte eigentlich überall mal ein bisschen reinschnuppern. Mir gefällt die Stelle als Projektleiterin sehr.“ Ihrer Ansicht nach hält die Capufaktur viel für die Mitglieder bereit. Man lernt, sich vor anderen Leuten zu präsentieren, wie man effizienter verhandelt, aber auch wie man in einem Team zusammenarbeitet. Man durchläuft bei den Projekten mehrere Phasen und lernt dabei auch, mit dem Druck durch den Kunden umzugehen. Ersin fügt hinzu: „Man lernt Studenten kennen, die dasselbe machen wie wir auch. Es gibt zweimal im Jahr einen Kongress unseres Dachverbands, bei denen man ziemlich gut Kontakte knüpfen kann, zum Beispiel mit Unternehmen. Dabei springt ab und an auch mal ein Praktikumsplatz raus.“
Der Zeitmangel scheint bei allen drei Initiativen das größte Hindernis zu sein, weswegen sich Studenten gegen ein über das Studium hinausgehende Engagement entscheiden. „Ich finde, außerhalb der Klausurenphase habe ich keine Probleme, Studium und Capufaktur unter einen Hut zu bekommen. Während der Klausuren allerdings muss das eine oder andere Treffen doch schon mal verschoben werden“, erklärt Ersin. Bei allen Initiativen kann man selbst entscheiden, wie viel Zeit man in das Engagement stecken will. „Wenn man allerdings alles mitnehmen will, dann muss einem schon bewusst sein, dass ein Vorstandsposten sehr viel Energie kosten kann“, verdeutlicht Jette, „aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann schafft man das auch.“ Und für Magdalene ist klar: „Ich verstehe das, wenn man Angst hat, dass es zu zeitintensiv wird oder dass man das Studium vernachlässigen könnte. Aber man bekommt einfach so viel zurück.“
Ein Feature von Katrin Haubold
von moritz.magazin | 18.06.2013
 100 Tage ist es her, dass die Toni-Kroos-Universität einen neuen Rektor bekommen hat: Professor Milos Rodatos. Dieser ist nicht nur ein ehemaliger Student der Universität, sondern auch der jüngste Rektor Norddeutschlands. Anlass genug, sich mit ihm persönlich zu treffen.
100 Tage ist es her, dass die Toni-Kroos-Universität einen neuen Rektor bekommen hat: Professor Milos Rodatos. Dieser ist nicht nur ein ehemaliger Student der Universität, sondern auch der jüngste Rektor Norddeutschlands. Anlass genug, sich mit ihm persönlich zu treffen.
Vom Präsidenten des Studierendenparlamentes (StuPa) zum Rektor: Wie haben sich die vergangenen 20 Jahre angefühlt?
(schmunzelt und zeigt mit dem linken Daumen nach oben) Es waren einige sehr emotionale Momente dabei. Sei es der Bachelor- und Masterabschluss oder auch das Erreichen des Doktortitels und schlussendlich die Berufung nach Rostock. Der Rektorensessel der Toni-Kroos-Universität Greifswald (TKU) war jedoch immer das Ziel, auf das ich hingearbeitet habe.
Wir feiern dieses Jahr den 575. Geburtstag der Universität. Inwieweit sehen Sie den Fortschritt in den letzten 20 Jahren, die Sie sicherlich mitverfolgt haben?
Die Universität hat vor allem in einem Punkt dazu gelernt: Studierende und Unileitung ziehen inzwischen zusammen an einem Strang. So hat die verfasste Studierendenschaft endlich ein größeres Mitspracherecht bekommen. Als ich zu meinen Masterzeiten das Amt des AStA-Vorsitzenden (Allgemeiner Studierendenausschuss, Anm.d.Red.) inne hatte, durfte ich bereits den Grundstein dafür mit legen: Die Vollversammlungen der Studierendenschaft wurde verbindlich! Und das dies, gut 15 Jahre später immer noch so ist, zeigt, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war.
Sie sind der jüngste Rektor in der Geschichte Norddeutschlands. Sie wurden heute vor 100 Tagen zum Rektor gewählt. Wie hat es sich angefühlt der neue Rektor der TKU zu werden?
Ich war sehr nervös, aber zugleich äußerst glücklich darüber. Es sind natürlich große Schuhe, die ich füllen muss. Auch wenn meine Vorgänger meist Psychologen waren, sehe ich als Politologe viele Möglichkeiten die Uni zu verbessern. Der entscheidende Punkt ist doch, dass wir die Uni gemeinsam voranbringen wollen.
„Bildung und Wissenschaft sollten ein freies Gut sein.“
Bei Ihrer Investitur haben Sie eine Tradition gebrochen: Sie wollten diese unter freiem Himmel veranstalten, damit mehr Studenten dabei sein können. Zeigt das Ihre basisnahe Politik?
Dort haben die Universitätsverwaltung und ich gut zusammengearbeitet. Es war lange geplant, dass wir die Investitur auf dem Marktplatz haben. Dort konnten mindestens 200 Uniangehörige und Studenten Sitzplätze auffinden. Die beiden Leinwände waren besonders für die an den Seiten Stehenden gut. An dieser Stelle noch einmal ein großes Danke an „Die krossenMedien“ für die Liveübetragung und die Berichterstattung. Mir war es sehr wichtig so die erste Grundlage für ein gutes Verhältnis zu der Studierendenschaft zu legen. Und die fünf großen Freibierfässer haben bestimmt ein restliches gemacht (grinst zufrieden).
Ihr Präsidenten-Daumen ist durch den Verkauf von verschiedenen Produkten mittlerweile sehr beliebt. In unseren Archiven findet man Artikel, in denen Sie am Anfang gar nicht so begeistert von der Idee waren. Hat sich das geändert?
Anfangs habe ich mich natürlich sehr gewundert und war dem Projekt sehr skeptisch gegenüber. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass die Kampagne „StuPa greifbarer machen“ große Veränderungen mit sich brachte: Nicht nur, dass die Besucherbänke des StuPa stets gefüllt waren, auch die Wahlbeteiligung ist radikal angestiegen. So konnte bei der letzten StuPa-Wahl (2032) die 60 Prozent-Hürde zum ersten Mal in der Universitätsgeschichte geknackt werden. Darauf bin ich auch als Rektor stolz und nehme es gerne in Kauf, mein Gesicht auf T-Shirts, Basecaps, Postern und anderen Merchandiseprodukten zu sehen. Die damaligen Köpfe hinter der Kampagne haben inzwischen die Rechte daran an die Universität verkauft und somit ein zusätzliches finanzielles Standbein für die Universität geschaffen.
 Wie sehen die Ziele für Ihre Amtszeit aus?
Wie sehen die Ziele für Ihre Amtszeit aus?
Bereits zu meinen StuPa-Zeiten lag mir das OpenAccess-Projekt am Herzen. Bildung und Wissenschaft sollten ein freies Gut an der TKU sein. Wir haben noch ein wenig im Senat zu kämpfen, aber ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen und bin fest davon überzeugt, dass das in den nächsten zwei Monaten spätestens umgesetzt werden kann. Aber auch die Vernetzung im Ostseeraum liegt mir sehr am Herzen. Gerade mit unserer Partneruniversität in Riga möchte ich gerne mehr zusammenarbeiten. Wir könnten noch viel mehr Konferenzen auf die Beine stellen und uns gegenseitig öfter besuchen.
Dieses Interview entspringt der Fantasie der beiden Autorinnen. Milos Rodatos hat die Aussagen nie getätigt und falls er sich durch diese genötigt oder unter Druck gesetzt fühlt, zitieren wir ihn selbst:„YOLO“.
Ein Interview von Natalie Rath & Anne Sammler (die 2033 hoffentlich ihr Studium abgeschlossen haben)

von moritz.magazin | 18.06.2013
 Zukunft! Jeder von uns erwartet etwas anderes. Heute etwas anderes als morgen. Greifswald ist genau die Stadt, die man sich ansehen muss, um die Zukunft abschätzen zu können. Hier studieren die Menschen der Zukunft. Wir sind die Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich? Sollten wir nicht große Angst haben vor dem Ungewissen? Nein, denn Angst lähmt uns und lässt uns an Bestehendem festhalten. Man kann nicht immer alles planen. Einige Dinge ergeben sich einfach. Ich finde, wir sollten leben, wie wir es für richtig halten. Wir sollten tun, was uns Spaß macht. Der Rest ergibt sich von selbst. Ich wurde einmal gefragt: „Wo siehst du dich in zehn Jahren?“ Ich konnte diese Frage nicht beantworten. Gerade jetzt in diesem Abschnitt unseres Lebens kann so viel passieren. Alles kann sich ändern. Wir können uns noch einmal verändern. Zehn Jahre wirkt eigentlich nicht viel aus der Sicht unserer Eltern oder Großeltern. Aber für uns. Was mache ich nun in zehn Jahren? Vielleicht studiere ich immer noch, was ich nicht hoffe. Vielleicht arbeite ich in meinem Traumjob, aber vielleicht bin ich auch Taxifahrer, was bei meinem Studium ganz normal scheint. Das Wichtigste ist doch, dass wir bei dem, was wir tun, glücklich sind und es gern machen.
Zukunft! Jeder von uns erwartet etwas anderes. Heute etwas anderes als morgen. Greifswald ist genau die Stadt, die man sich ansehen muss, um die Zukunft abschätzen zu können. Hier studieren die Menschen der Zukunft. Wir sind die Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich? Sollten wir nicht große Angst haben vor dem Ungewissen? Nein, denn Angst lähmt uns und lässt uns an Bestehendem festhalten. Man kann nicht immer alles planen. Einige Dinge ergeben sich einfach. Ich finde, wir sollten leben, wie wir es für richtig halten. Wir sollten tun, was uns Spaß macht. Der Rest ergibt sich von selbst. Ich wurde einmal gefragt: „Wo siehst du dich in zehn Jahren?“ Ich konnte diese Frage nicht beantworten. Gerade jetzt in diesem Abschnitt unseres Lebens kann so viel passieren. Alles kann sich ändern. Wir können uns noch einmal verändern. Zehn Jahre wirkt eigentlich nicht viel aus der Sicht unserer Eltern oder Großeltern. Aber für uns. Was mache ich nun in zehn Jahren? Vielleicht studiere ich immer noch, was ich nicht hoffe. Vielleicht arbeite ich in meinem Traumjob, aber vielleicht bin ich auch Taxifahrer, was bei meinem Studium ganz normal scheint. Das Wichtigste ist doch, dass wir bei dem, was wir tun, glücklich sind und es gern machen.
Die Welt wird sich ohnehin drastisch verändern. Denkt doch mal zurück. Vor zehn Jahren hatten wir noch keine Smartphones oder Tablets, wir hatten zwar schon den Euro, aber der steckte damals noch nicht in der Krise. Wenn wir einmal ganz krass zurückgehen: Vor 30 Jahren war hier noch keine Demokratie. Warum sollte ich also wissen wollen, wie die Zukunft aussieht?
Willy Brandt sagte einmal: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ Diese Meinung teile ich. Wir haben das nötige Werkzeug in unserer Hand oder besser gesagt in unseren Köpfen. Wir können aus dem Leben das Beste machen. Meinetwegen müssen wir nicht gleich die ganze Welt retten, aber wenn jeder so lebt, dass er ein kleines Stück der Welt verbessert, können wir zufrieden sein.
In diesem Heft seht ihr, wie sich Fachpersonal die Zukunft der Universität, der Wirtschaft und der Kultur vorstellt. Ihr seht aber auch, wie sich unsere Redaktion Gedanken über die Zukunft macht. Ob das alles ernst gemeint ist, sei dahingestellt. Also viel Spaß beim Lesen und schreibt uns doch einfach einmal eine Mail oder bei facebook, was ihr von der Zukunft erwartet!
Anne Sammler
Das neue Magazin findet ihr überall in der Uni oder hier zum Download.
von moritz.magazin | 18.06.2013
 Ob „Tauschen statt Besitzen“, „Swappen statt shoppen“ oder „Teilen statt Konsumieren“ – seit mehreren Jahren scheinen die Deutschen dem Trend verfallen zu sein, weniger selbst zu besitzen und mehr gemeinsam zu nutzen. Handelt es sich dabei nur um einen Medienhype oder führt der Trend zu einem Wandel der Gesellschaft?
Ob „Tauschen statt Besitzen“, „Swappen statt shoppen“ oder „Teilen statt Konsumieren“ – seit mehreren Jahren scheinen die Deutschen dem Trend verfallen zu sein, weniger selbst zu besitzen und mehr gemeinsam zu nutzen. Handelt es sich dabei nur um einen Medienhype oder führt der Trend zu einem Wandel der Gesellschaft?
Bibliotheken, Videotheken, Autovermietungen, Flohmärkte – sie alle haben als Grundsatz, dass ein Gut verliehen oder zur Weiternutzung durch einen Anderen verkauft wird. Allerdings hat sich in den letzten Jahren, besonders nach der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise, der Trend verstärkt und unter neuen Namen bemerkbar gemacht: Man spricht nun von „collaborative consumption“ oder „sharing economy“.
Die letzten Jahre waren geprägt durch neue Möglichkeiten der sozialen Netzwerke und ein verstärkter Austausch auf diesen sowie ein erhöhtes Umweltbewusstsein. Wohl auch deswegen beginnt der kollaborative Konsum, auch KoKonsum abgekürzt, sich in Deutschland zu etablieren. Laut einer Studie der Leuphana Universität Lüneburg ist die Umweltverträglichkeit für die Menschen der drittwichtigste Faktor bei Gütern und Dienstleistungen – nach der Qualität und dem Preis. Und genau darin liegen die Stärken des KoKonsums. Durch ihn werden Rohstoffe besser genutzt und wenig verwendete Geräte besser ausgelastet. Das wiederum kann Unternehmen dazu animieren, Produkte langlebiger zu gestalten.
Zwölf Prozent aller Deutschen nutzen die Möglichkeiten des gemeinsamen Konsumierens – Tendenz steigend. Gerade unter jungen Menschen ist der KoKonsum weit verbreitet: Etwa ein Viertel aller 14 bis 29-Jährigen haben Erfahrungen mit ihm, so die Studie der Leuphana Universität. Allerdings stellt sie auch fest, dass es auffallend viele junge Menschen mit höherer Bildung und Einkommen sind. Sie konstatiert, dass dreiviertel aller Deutschen mit dieser Form des Konsums noch nicht in Berührung gekommen sind. Und genau da sind die Ansatzpunkte: Mit Imagekampagnen soll der alternative Lebensstil weiter verbreitet werden, rechtlichen Grundlagen müssen hierfür geschaffen werden – und vielleicht gibt es auch Steuervergünstigungen, beispielsweise bei der Mehrwertssteuer.
Kein neuer Trend
Ganz neu ist der Trend des gemeinsamen Nutzens jedoch nicht. Schon in den 1970er Jahren kamen die Second-Hand-Läden auf – allerdings waren deren Nutzer als ‚Ökos’ verschrien. In den letzten Jahren hat sich das Image hingegen gewandelt; das Tragen von gebrauchter Kleidung avancierte zum Modetrend und ebnete somit Plattformen wie kleiderkreisel.de den Weg. Seit 2009 kann man auf dem Internetportal Klamotten und Accessoires, die man selbst nicht mehr braucht, gegen Geld oder ein anderes Kleidungsstück tauschen – pro Tag werden laut eigenen Angaben 2 000 Transaktionen getätigt und 3 500 Artikel online gestellt.
In Greifswald finden sich auch Ansätze des kollaborativen Konsums. Seit ungefähr zehn Jahren gibt es den Umsonstladen, bei dem nicht mehr genutzte Gegenstände im Laden gegen andere eingetauscht werden können. „Es ist nur schade, dass es einer Wirtschafts- und Finanzkrise bedarf, um den Gebrauchswert von Gegenständen besser wert zu schätzen“, meinen die Mitglieder des Umsonstladen Greifswald e.V., „Das Funktionieren des Umsonstladens sollte aber nicht nur der Krise zugeordnet werden. Uns gab es ja schon vorher.“ Sie freuen sich über den Trend des Teilens. Auch der Möbelsprinter, der IKEA-Möbel von Rostock nach Greifswald bringt, ist eine Art der „collaborative consumption“ – mietet man doch hier für seine bestellten Möbel den Platz im Sprinter. Während der Umsonstladen sich über Spenden finanziert und damit beispielsweise die Hausmiete zahlt, nehmen die Jungs vom Möbelsprinter durch die Fahrten das Geld für das geliehene Auto ein. „Wir hoffen, dass wir irgendwann ein eigenes Elektroauto haben, mit dem wir die Fahrten erledigen können“, erzählt Philipp Hunsche, der die Idee zum Sprinter hatte. Sie wollen zwar ein gewinnbringendes Unternehmen aufbauen, dabei aber die Umwelt nicht belasten.
Tauschen bringt nicht immer Vorteile
Doch nicht immer ist es sinnvoll, Objekte miteinander zu tauschen. Eine Kurzstudie der Heinrich-Böll-Stiftung und des Naturschutzbundes zeigt, dass durch den Transport oder die Verpackung der Tauschgegenstände das eigentliche Potential der Ressourcenschonung gemindert wird. Auch können die Gegenstände übernutzt werden, wodurch sich der Verschleiß erhöht. Gibt man dann den Erlös für neue Güter aus, wird die Ressourcenschonung wieder zunichte gemacht.
Obwohl um ihn in den Medien gerade ein großer Rummel gemacht wird, hat der KoKonsum das Potential, zu einem Wandel in der Gesellschaft und des Konsumverhaltens beizutragen. Gelingt es, die Vorteile herauszustreichen, ohne die Nachteile unter den Teppich zu kehren, werden in 20 Jahren vielleicht schon über die Hälfte aller Deutschen mit ihm in Berührung.
Feature und Montage von Katrin Haubold; Grafiken: xooplathe (Menschen, Wekrzeug), Michael/FreeVector (Auto), Easyvectors (Banknoten)

von moritz.magazin | 18.06.2013
 Ein Artikel des Los Angeles Time Magazine aus dem Jahre 1988 gibt Aufschluss darüber, welche Zukunftsvisionen damals über das Jahr 2013 herrschten. moritz gibt einen Einblick in den heutigen Alltag, wie er sich vor 25 Jahren ausgemalt wurde.
Ein Artikel des Los Angeles Time Magazine aus dem Jahre 1988 gibt Aufschluss darüber, welche Zukunftsvisionen damals über das Jahr 2013 herrschten. moritz gibt einen Einblick in den heutigen Alltag, wie er sich vor 25 Jahren ausgemalt wurde.
Das Klingeln meines Weckers reißt mich unsanft aus dem Schlaf. Es klopft an der Tür, doch bevor ich überhaupt Gelegenheit erhalte, den Gast hereinzubitten, steht mein Mitbewohner schon im Zimmer. Hierbei handelt es sich nicht um die Art Mitbewohner, die um 8 Uhr morgens dein Zimmer aufsuchen, um nach einer durchzechten Nacht von den jüngsten Mensaereignissen zu berichten. Es handelt sich vielmehr um einen ordnungsfanatischen Roboter namens Ernst, der keine Abweichung vom täglichen Zeitplan zulässt: „Guten Morgen. Höchste Zeit aufzustehen. In 57 Minuten beginnt Ihre Vorlesung. Das Frühstück steht zubereitet in der Küche. Außerdem wäre eine Dusche für Sie äußerst empfehlenswert.“ Widerwillig starte ich in den Tag, bevor Ernst mit dem nächsten Schritt des Weckprogrammes beginnt und einen Eimer kaltes Wasser holt. Schon das erste Nippen am Kaffee zeigt, dass Ernsts Barista-Qualitäten deutliches Steigerungspotential besitzen. Mit diesem Gebräu könnte man Tote zum Leben erwecken – wobei es laut Zeitungstitelblatt nur noch eine Frage der Zeit sei, bis dies der Wissenschaft gelinge. Der herzhafte Schrei aus dem Zimmer meiner Mitbewohnerin verrät, dass Ernst doch auf den Wassereimer zurückgreifen durfte. An der Haustür halte ich Ausschau nach meinem e-Bike. Das aufgebrochene Schloss auf seinem Stellplatz gibt Aufschluss über sein tragisches Schicksal. Ein Glück, dass Ernst mit dem Aufwischen der Wasserpfütze beschäftigt ist, denn für eine Standpauke über akkurate Radsicherung fehlt mir dank des bevorstehenden Fußmarsches die Zeit.
Professor im Schlafrock
Knallrot erreiche ich den Vorlesungssaal. Bei all dem Ärger habe ich vergessen, die Sonnencreme LSF 50+ aufzutragen. Die 3D-Projektion meines Professors bittet darum, die Tablet-PCs schon einmal herauszuholen, während er sich einen Bademantel um seine mit Herzchen bestickte Unterhose zieht. Er bittet um Entschuldigung: Sein Roboter sei noch auf die Semesterferien programmiert. Auch seine Frau scheint in seliger Ruhe verschlafen zu haben und serviert ihm seinen Kaffee. Ich bin verwundert, dass ein Professor des Grades Alpha mit einem Beta verheiratet sein darf. In Huxleys Roman „brave new world“ wäre dies nicht möglich. Während mein Professor nun über das eigentliche Thema „Atommolekularbiologie für den Einsatz von Knochenmarkttransplantationen“ referiert, schalte ich den Kopf aus und mein Tablet an. Fred, ein Kommilitone, sitzt seit bereits acht Monaten in Amerika fest, da Smogwolken aus Asien den Flugverkehr lahm legen. Man wüsste nicht, wie sich das Ganze noch entwickeln würde, schreibt Fred. Daher muss er vorerst in Amerika bleiben, obwohl er für nur ein Semester verschwinden wollte.
Mensaessen 2.0
Der verkorkste Start in den Tag löst fast so etwas wie Vorfreude auf das Mensaessen aus. Die Auswahl der Gerichte ist aber seit den Nahrungsengpässen auf einen Einheitsbrei beschränkt. Endlich Platz genommen, verrät das Transparent meines Sitznachbarn, dass er an der Demonstration zur Herabsetzung des Rentenalters auf 84 teilnahm. Da fällt mir ein, dass ich meiner Oma am Wochenende einen Besuch in ihrer WG abstatten wollte. Glücklicherweise lassen sich keine Ersatzteile für den kaputten Kassettenspieler ihrer Mitbewohnerin finden, sodass mir eine Dauerbeschallung durch die Wildecker Herzbuben erspart bleibt. Eigentlich sollte Ernst in Omas Haushalt arbeiten, doch ihr Misstrauen gegenüber den maschinellen Zeitgenossen führte ihn in meine Studentenbude. Wenn er wüsste, welch Unheil ihm erspart bleibt, würde er seltener auf den Wassereimer zurückgreifen. Nun muss ich mich aber beeilen, um pünktlich zu meinem ersten Arbeitstag als studentische Hilfskraft zu erscheinen.
Als ich das Institut betrete, wundere ich mich schon nicht mehr über die Hightech-Schiebetüren, die sich mir über fünf Korridore bis hin zum Büro von Master Professor Alpha 42 öffnen. Er hat auf alles eine Antwort. Zumindest könnte man diese Vermutung als Fan von „Per Anhalter durch die Galaxis“ haben. Jedoch erhalte ich auf meine Frage, worin meine Aufgabe für heute bestehe, nur die Antwort „42“. Dann werde ich in ein Zimmer mit überdimensionalen Flachbildschirmen geleitet. Ein kleines Deltamädchen versucht mühsam zu erklären, dass ich eine Videokonferenz mit japanischen Wissenschaftlern abhalten werde. JAPANISCH? Aber ich kann doch gar kein japanisch. Das junge Team der Tokyo University of Modern Medicine berichtet von einer Testreihe namens „I am legend“. Das Lachen, welches ich mir bei diesem merkwürdigen Namen nicht verkneifen kann und der mich eher an Will Smith erinnert, vergeht mir bereits im nächsten Atemzug. Die Wissenschaftler erklären, dass in Japan ein Virus ausgebrochen sei. Erkrankte ziehen sich zurück, essen wenig, meiden die Sonneneinstrahlung und entwickeln eine blasse Haut, die teilweise sogar verfaule. In meinem Magen dreht sich der Mensabrei. Die Wissenschaftler berichten von sogenannten I.L.-Tabletten und manövrieren diese über einen Scanner in den Raum. Ich muss hier raus, ehe ich noch aufgefordert werde, diese Dinger zu probieren.
Nah und Frisch
Langsam wird mir die Umgebung immer grotesker. Seit wann sind Supermärkte in Hierarchieklassen unterteilt? Ganz links dürfen die Alphas schmackhafte Delikatessen einkaufen. Ich traue meinen Augen nicht, dass ich richtige Lebensmittel erwerben kann, nachdem es in der Mensa nur diesen Einheitsbrei für uns Studenten gab. Doch sobald ich den Supermarkt betrete, stellt sich die übliche Frage: Was wollte ich einkaufen? Ich zücke mein Smartphone. Ein einziger Klick auf das kleine Kühlschranksymbol gewährt mir Einblick in den WG-Kühlschrank. Er scheint nur noch von Licht gefüllt zu sein. „Vielen Dank für Ihren Einkauf. Auf Wiedersehen“, schallt es nach dem Großeinkauf aus dem Kassenautomaten. Auch, wenn die Roboter weitaus mehr Höflichkeit als ihre menschlichen Vorgänger an den Tag legen, ersehne ich mir doch eine unfreundliche Kassiererin anstelle der kalten Maschine. Wie viele Arbeitsplätze hier wohl verloren gingen? Ich sollte nicht darüber nachdenken.
Umso mehr freue ich mich nun darauf, endlich zu Hause anzukommen. Natürlich koche ich nicht. „Wieso auch?“, schaut mich meine Mitbewohnerin verwundert an, als ich sie frage wo die Kochtöpfe sind,„Ernst macht das schon.“
Doch als Import aus Indien gelingt es Ernst und seinen scharfen Kochkünsten wieder einmal, mir die Speiseröhre zu verätzen. Mir reicht es endgültig. Was für ein Tag. Fluchend verziehe ich mich in mein Zimmer und setze mich vor den Fernseher. Gerade als ich mich zurücklehne um die DVD „Der Aufstand der Alten“ dort weiterzuschauen, wo ich gestern Abend aufgehört hatte, wird meine Aufmerksamkeit zum Fenster gelenkt. Auf der Straße demonstrieren hunderte Menschen gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Ein Anlass für die Polizei, sich in bedrohlicher Angriffshaltung zu formatieren. Der Fernseher vermag wohl die Schreie der Demonstranten zu übertönen, doch finden meine Gedanken keine Ruhe, demn der Film zeigt mir kein wirklich anderes Bild. In der Hoffnung, dass der morgige Tag mehr Raum für Optimismus lässt, lösche ich das Licht.
Das Klingeln meines Weckers reißt mich unsanft aus dem Schlaf. Mit verschwommenem Blick erkenne ich, dass ich das Läuten seit bereits zwanzig Minuten erfolgreich ignoriere. Zu tief war ich in meinen Träumen um das Jahr 2013, wie es hätte sein können, versunken. Auch, wenn es bedeutet, dass ich mein Frühstück selbst zubereiten muss, bin ich doch froh, in dieser Gegenwart zu erwachen.
Ein Blick in eine alternative Realität von Ulrike Günther & Marie Wieschmann
Titelbild: Ausschnitt aus einem Gemälde von Albert Robida

 Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.
Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.

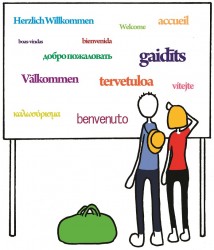 Das Studentenleben besteht nicht nur aus Vorlesungen, Seminaren oder Prüfungen. Dort knüpft man zwar neue Kontakte, allerdings erhöht das Engagement bei einem Verein die Chancen auf noch mehr Bekanntschaften. In Greifswald gibt es einige Möglichkeiten, die das erleichtern: Die Mitarbeit in Vereinen wie GrIStuF, LEI oder Capufaktur.
Das Studentenleben besteht nicht nur aus Vorlesungen, Seminaren oder Prüfungen. Dort knüpft man zwar neue Kontakte, allerdings erhöht das Engagement bei einem Verein die Chancen auf noch mehr Bekanntschaften. In Greifswald gibt es einige Möglichkeiten, die das erleichtern: Die Mitarbeit in Vereinen wie GrIStuF, LEI oder Capufaktur.
 100 Tage ist es her, dass die Toni-Kroos-Universität einen neuen Rektor bekommen hat: Professor Milos Rodatos. Dieser ist nicht nur ein ehemaliger Student der Universität, sondern auch der jüngste Rektor Norddeutschlands. Anlass genug, sich mit ihm persönlich zu treffen.
100 Tage ist es her, dass die Toni-Kroos-Universität einen neuen Rektor bekommen hat: Professor Milos Rodatos. Dieser ist nicht nur ein ehemaliger Student der Universität, sondern auch der jüngste Rektor Norddeutschlands. Anlass genug, sich mit ihm persönlich zu treffen.
 Wie sehen die Ziele für Ihre Amtszeit aus?
Wie sehen die Ziele für Ihre Amtszeit aus?
 Zukunft! Jeder von uns erwartet etwas anderes. Heute etwas anderes als morgen. Greifswald ist genau die Stadt, die man sich ansehen muss, um die Zukunft abschätzen zu können. Hier studieren die Menschen der Zukunft. Wir sind die Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich? Sollten wir nicht große Angst haben vor dem Ungewissen? Nein, denn Angst lähmt uns und lässt uns an Bestehendem festhalten. Man kann nicht immer alles planen. Einige Dinge ergeben sich einfach. Ich finde, wir sollten leben, wie wir es für richtig halten. Wir sollten tun, was uns Spaß macht. Der Rest ergibt sich von selbst. Ich wurde einmal gefragt: „Wo siehst du dich in zehn Jahren?“ Ich konnte diese Frage nicht beantworten. Gerade jetzt in diesem Abschnitt unseres Lebens kann so viel passieren. Alles kann sich ändern. Wir können uns noch einmal verändern. Zehn Jahre wirkt eigentlich nicht viel aus der Sicht unserer Eltern oder Großeltern. Aber für uns. Was mache ich nun in zehn Jahren? Vielleicht studiere ich immer noch, was ich nicht hoffe. Vielleicht arbeite ich in meinem Traumjob, aber vielleicht bin ich auch Taxifahrer, was bei meinem Studium ganz normal scheint. Das Wichtigste ist doch, dass wir bei dem, was wir tun, glücklich sind und es gern machen.
Zukunft! Jeder von uns erwartet etwas anderes. Heute etwas anderes als morgen. Greifswald ist genau die Stadt, die man sich ansehen muss, um die Zukunft abschätzen zu können. Hier studieren die Menschen der Zukunft. Wir sind die Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich? Sollten wir nicht große Angst haben vor dem Ungewissen? Nein, denn Angst lähmt uns und lässt uns an Bestehendem festhalten. Man kann nicht immer alles planen. Einige Dinge ergeben sich einfach. Ich finde, wir sollten leben, wie wir es für richtig halten. Wir sollten tun, was uns Spaß macht. Der Rest ergibt sich von selbst. Ich wurde einmal gefragt: „Wo siehst du dich in zehn Jahren?“ Ich konnte diese Frage nicht beantworten. Gerade jetzt in diesem Abschnitt unseres Lebens kann so viel passieren. Alles kann sich ändern. Wir können uns noch einmal verändern. Zehn Jahre wirkt eigentlich nicht viel aus der Sicht unserer Eltern oder Großeltern. Aber für uns. Was mache ich nun in zehn Jahren? Vielleicht studiere ich immer noch, was ich nicht hoffe. Vielleicht arbeite ich in meinem Traumjob, aber vielleicht bin ich auch Taxifahrer, was bei meinem Studium ganz normal scheint. Das Wichtigste ist doch, dass wir bei dem, was wir tun, glücklich sind und es gern machen. Ob „Tauschen statt Besitzen“, „Swappen statt shoppen“ oder „Teilen statt Konsumieren“ – seit mehreren Jahren scheinen die Deutschen dem Trend verfallen zu sein, weniger selbst zu besitzen und mehr gemeinsam zu nutzen. Handelt es sich dabei nur um einen Medienhype oder führt der Trend zu einem Wandel der Gesellschaft?
Ob „Tauschen statt Besitzen“, „Swappen statt shoppen“ oder „Teilen statt Konsumieren“ – seit mehreren Jahren scheinen die Deutschen dem Trend verfallen zu sein, weniger selbst zu besitzen und mehr gemeinsam zu nutzen. Handelt es sich dabei nur um einen Medienhype oder führt der Trend zu einem Wandel der Gesellschaft?
 Ein Artikel des Los Angeles Time Magazine aus dem Jahre 1988 gibt Aufschluss darüber, welche Zukunftsvisionen damals über das Jahr 2013 herrschten. moritz gibt einen Einblick in den heutigen Alltag, wie er sich vor 25 Jahren ausgemalt wurde.
Ein Artikel des Los Angeles Time Magazine aus dem Jahre 1988 gibt Aufschluss darüber, welche Zukunftsvisionen damals über das Jahr 2013 herrschten. moritz gibt einen Einblick in den heutigen Alltag, wie er sich vor 25 Jahren ausgemalt wurde.

