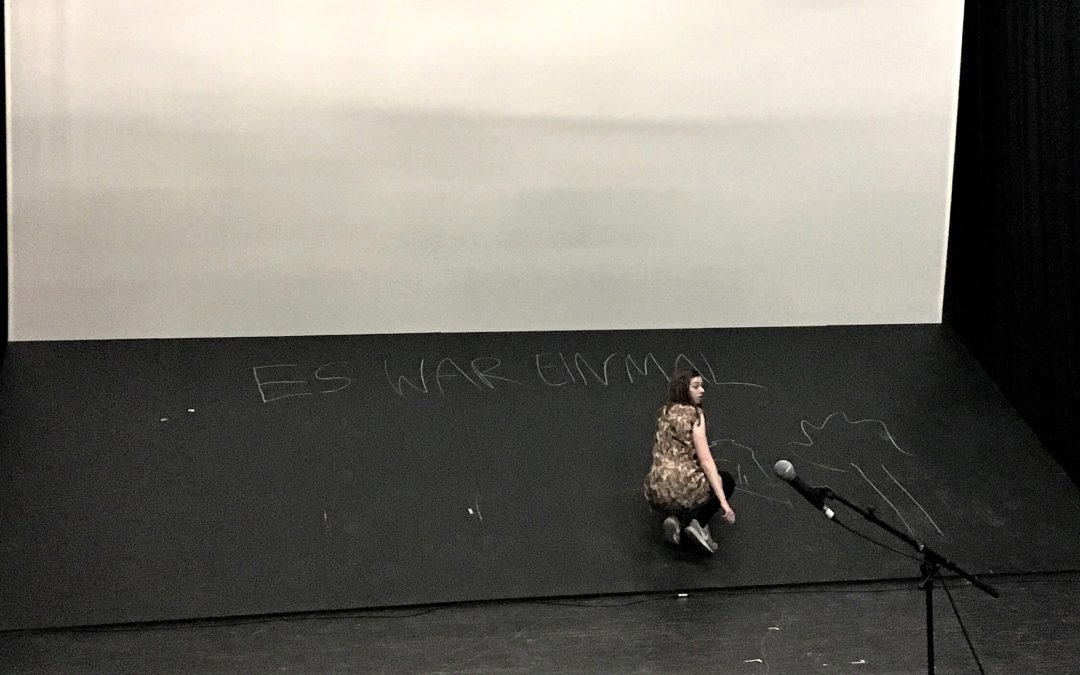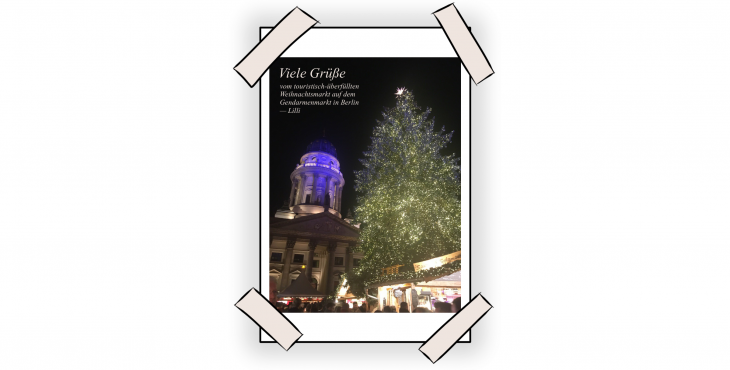Umgekrempelt: 10.000 Schritte am Tag
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt ihr hier.
10.000 Schritte am Tag. Das ist eine Zahl, die man immer wieder hört. Und es macht Sinn: Als eine Spezies des Jagens und Sammelns waren wir ständig draußen unterwegs, einfach das Säbelzahntigerfell über die Schulter geworfen und los, raus in die Kälte, mit Speer in der Hand und bis zur Abenddämmerung herumpirschen. Heute gibt es keine Mammuts mehr, die wir jagen können und ein Stück Fell reicht uns nicht mehr gegen die Kälte – wenn das Wetter draußen schlecht ist, bleiben wir lieber drinnen. Wir sind Stubenhocker*innen geworden – natürlich nicht alle und die meisten von uns nicht freiwillig. Im Grundschulalter war man noch ständig unterwegs, kam oft später wieder nach Hause zurück, als man eigentlich sollte. Jetzt sitzen wir nur noch am Schreibtisch und in der Bib und in der Uni, gerade in der Prüfungszeit.
Ich habe schon lange gemerkt, dass mir dieser Lebensstil nicht gut tut. Zum einen, weil mein hyperaktiver Körper bei dem ganzen Stillsitzen nicht so richtig mitmachen will, zum anderen, weil sich nach rund fünf Minuten in der gleichen Sitzposition mein Rücken lautstark bemerkbar macht. Wir sind ja auch nicht zum Sitzen gemacht, und viele Wissenschaftler*innen erinnern immer wieder an die 3S und die 3L: Stehen und Sitzen ist Schlecht, Lieber Liegen und Laufen. Aber wie leicht ist es wirklich, das tägliche Laufen, die 10.000 Schritte am Tag, in einen durch Uni- und Arbeitsalltag durchstrukturierten Tagesablauf einzuplanen?

Montag
Das erste, was mir auffällt, ist, dass ich mein Handy überall mit mir herumschleppen muss, damit die Schrittzähler-App ja auch jeden meiner Schritte aufzeichnet. Das ist ungewohnt für mich, und ich vergesse es immer mal wieder – auch die ganze Woche hindurch. Aber so viel kommt zuhause sowieso nicht zusammen. Zwar achte ich penibel darauf, jeden Extragang zu machen, den ich kann, auch wenn das bedeutet, Dinge, die man eigentlich mit einem Weg hätte in die Küche bringen können, eher aufzuteilen und dafür zweimal zu laufen. Aber es sind eben nur 30 Schritte mehr. Trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, schon jetzt etwas Gutes für meinen Körper getan zu haben, wenigstens im Kleinen.
Bis 15:30 Uhr sitze ich zuhause beim Lernen und bin so bisher nur auf knapp 300 Schritte gekommen. Das muss sich ändern. Ich frage meine Schwester nach einem Spaziergang nach Wieck. Wir kommen dabei insgesamt auf 8.000 Schritte, sind dafür aber auch anderthalb Stunden unterwegs. Zeit, die ich sonst zum Lernen hätte nutzen können, werfe ich mir vor. Aber ist das wirklich so? Wäre die Zeit nicht vielleicht viel eher fürs Prokrastinieren draufgegangen, weil ich hier schon seit frühmorgens sitze und mein Kopf langsam platzt? Da scheint mir ein Spaziergang das bessere Prokrastinieren zu sein. Das hat zwar wesentlich länger gedauert als ein 15–30-minütiges YouTube-Video zur Ablenkung zwischendurch. Aber ich fühle mich nach dem Spaziergang frisch ausgeruht und neu ermutigt, um weiterzuarbeiten – zumindest sobald meine Finger wieder aufgetaut sind.
Dienstag
Da ich gestern die 10.000 Schritte nicht ganz geschafft habe, will ich sichergehen, dass ich mein Ziel heute in die Tat umsetze. Wieder muss meine Schwester ran, dieses Mal wollen wir uns zu Fuß auf den Weg zum Elisenpark machen, um einzukaufen. Normalerweise wären wir dafür zu dem nächsten Supermarkt gegangen oder wenigstens mit dem Fahrrad gefahren, um Zeit zu sparen. Aber der Spaziergang tut gut, das Wetter ist schön, wenn man vom schlammigen Boden einmal absieht, und als wir nach knapp zwei Stunden wieder zurückkommen, haben wir bereits das Tagesziel erreicht.
Aber langsam merke ich, wie sich leichte Gewissensbisse in mir ausbreiten. Jeden Tag zwei Stunden fürs Spazierengehen ist sicher eine Zeit, die man sich nehmen sollte, aber kann ich mir die auch erlauben mit einer Modulprüfung in einer Woche? Mein routinemäßiges Prokrastinieren zwischen den Lerneinheiten fülle ich mit Nachgrübeln. Wer hat eigentlich entschieden, dass Lernen wichtiger ist, als auf unseren Körper aufzupassen und etwas für unsere Gesundheit zu tun?

Mittwoch
Das erste Mal, dass ich vollkommen an der Challenge scheitere. Trotz StuPa-Sitzung am Abend komme ich nicht einmal auf 1.000 Schritte. Ich fühle mich schlecht, weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, die Zeit zum Spazieren aufzubringen, und weil mein Körper sich mal wieder über den Bewegungsmangel beschwert. Für den nächsten Tag nehme ich mir fest vor, wieder mehr Willensstärke zu zeigen.
Donnerstag
Morgens sammle ich bereits ein paar Schritte, als ich in der Bib auf Lehrbuchsuche gehe. Ich gehe im Anschluss außerdem noch mal zu Fuß hinüber zum Domcenter, anstatt zu fahren. Ein bisschen Schwung in die Hüften bekommen.
Gegen Mittag setze ich das Ganze fort. Wieder ein Spaziergang nach Wieck und trotzdem immer noch neue Dinge zu entdecken (selbst als gebürtige Greifswalderin). Trotzdem bleibt der Schrittzähler danach irgendwo bei 7.000 Schritten stehen und verändert sich auch nicht mehr großartig, während ich wieder beim Lernen sitze. Aber ich hatte mir am Vortag etwas vorgenommen und das will ich auch durchziehen.
Es ist kurz nach 10, als ich hinaus in die Kälte trete. Ein seltsames Gefühl, um diese Uhrzeit unterwegs zu sein. Die einzigen, denen ich unterwegs begegne, sind eine Hundebesitzerin samt Hund und viele unzuordbare Geräusche. Mein Weg führt mich noch einmal hinunter zum Wasser, weil ich sehen möchte, wie es nachts aussieht, und weil mich die Dunkelheit irgendwie anzieht. Um zum Wasser zu gelangen, wandere ich durch ein kleines Waldstückchen, das vom Licht des benachbarten Wohngebiets kaum mehr erreicht wird. Aus Skepsis vor einer Begegnung mit womöglichen Bekannten wie der kleinen Wildschweinfamilie hier in der Gegend, mache ich die Taschenlampe meines Handys an. Ich begegne keinem Wildschwein, werde aber trotzdem von einem bedrohlichen Knurren aus dem Gebüsch begrüßt. Zwar trennt uns beide ein großer Zaun, aber vorsichtshalber, und um den Hund nicht unnötig zu verärgern, lösche ich trotzdem das Licht. Den Rest des Weges bis zum Wasser laufe ich also in Dunkelheit.
Es ist ein merkwürdiges Erlebnis, diese Stille. Oder eben die Nichtanwesenheit von Stille. Denn gerade weil ich allein unterwegs bin, weil kein Licht über mir oder aus meinem Handy heraus leuchtet, weil ich keine Stimmen und keinen Autolärm höre, nehme ich jedes Geräusch war. Das Rauschen in den Blättern, das Knacken der Bäume, kleine Tiere, die über den Boden huschen, den Wind und das Meer. Die Welt ist wie ein Orchester.
Das Meer sieht erschreckend unspektakulär aus. Natürlich, was hatte ich auch anderes erwartet, es ist immerhin mitten in der Nacht! Aber als ich eine Weile hinaus aufs Wasser sehe, bemerke ich das Licht eines Leuchtturms in der Ferne, das mir vorher noch nie aufgefallen ist, obwohl ich schon etliche Male nachts hier war. Nur nie allein.
Die Einsamkeit macht einen Unterschied. Und die Langsamkeit der Bewegung, das merke ich, als ich wieder zurück nach Hause gehe (dieses Mal vorsorglich durchs Wohngebiet, um den knurrenden Hund nicht noch einmal zu wecken). Ich bin es gewohnt, diese Strecke zu joggen oder mit dem Fahrrad hier entlangzufahren, oder wenn ich doch einmal gehe, dann habe ich immer jemand anderes bei mir. Jetzt allein, langsam Schritt für Schritt, habe ich das Gefühl zum ersten Mal die Umgebung wirklich wahrzunehmen. Ich entdecke noch nicht abgehangene Weihnachtsbeleuchtung in einigen Fenstern (ist aber auch erst zwei Monate her), mit Ranken zugewucherte Eingangstüren, einen Briefkasten mit einem Ritter darauf – was wohl die Leute gedacht haben müssen, die um knapp halb 11 aus dem Fenster gesehen und eine Gestalt in ihrer Einfahrt bemerkt haben, die in völliger Dunkelheit ein Foto von ihrem Briefkasten macht?
Aber ich sehe. Ich nehme wahr. Ich lasse meine Gedanken kreisen, um das um mich herum, um diesen Artikel hier, um Uni und Prüfungen. Trotzdem fühlt es sich frei an. Einmal zu sich kommen, allein mit sich selbst. Irgendwann konzentriere ich mich sogar mehr auf die Umgebung als auf die Uniaufgaben, die noch vor mir liegen. Und auf die Kälte, die meine Beine hinaufkriecht. Es ist verdammt kalt geworden. Da hilft der hübsche glitzernde Reif auf dem Gras und auf der Straße auch nicht, um mich aufzumuntern. Außerdem habe ich meine 10.000 Schritte mittlerweile sowieso erreicht. Zeit, nach Hause zu kommen.

Freitag und Samstag
Ich scheitere erneut. Zwar versuche ich, so oft ich kann, zu Fuß zu gehen – zur Redaktion, zu Gleis 4 und wieder zurück – aber es bringt nichts. Bis abends komme ich auf etwas mehr als 2.000 Schritte, an beiden Tagen. Dieses Mal merke ich es nicht nur am Körper, sondern auch im Kopf. Ich bin beim Lernen abgespannt, kann mich zwar konzentrieren, aber bin nervlich ziemlich am Ende. Das Spazierengehen fehlt mir auch irgendwie bereits, die frische Luft, die Zeit zum Nachdenken, um den Kopf frei zu bekommen. An diesen beiden Tagen sehe ich aber kaum etwas von draußen, nur meinen Laptop-Bildschirm, meine MÜP-Notizen und Lehrbücher, bis die Schrift irgendwann schon vor den Augen verschwimmt. Aber obwohl mir mein Körper eindeutige Signale sendet, dass er eine Pause hätte gebrauchen können, habe ich keine Gewissensbisse. Ich brauchte die Zeit zum Lernen. Für meinen Körper tut es mir trotzdem ein wenig Leid, und ich wünschte mir, dass es auch anders ginge.
Sonntag
Heute, am letzten Tag der Challenge, möchte ich mir noch einmal beweisen, dass es anders geht. Ich frage meine Schwester, ob sie Zeit und Lust auf einen Ausflug hat und wir fahren nach Ludwigsburg. Das Wetter ist wundervoll, als wir durch den Wald und am Feld entlang bis nach Loissin gehen und dann am Strand wieder zurück, dem Sonnenuntergang entgegen. Nach den beiden letzten Tagen drinnen, bekomme ich richtige Glücksgefühle. Das Lernen und die Angst vor der Prüfung sind komplett vergessen, ich freue mich einfach nur riesig über jeden Sonnenstrahl, der durch die Bäume fällt, über das Rauschen des Meeres und über die voluminösen Wolken am Himmel. Ich habe wieder richtig Lust am Leben, oder zumindest nehme ich das Leben wieder richtig wahr. Ein kathartisches Gefühl, dieses Rausgehen.

Fazit
Ein wenig schwermütig werde ich schon, als ich abends wieder zurückkomme. Einmal, weil wieder die Lehrbücher vor mir auftauchen, die ich doch gerade vergessen hatte, aber vor allem auch, weil ich weiß, dass ich mir so einen Ausflug in den nächsten drei Tagen bis zur Prüfung nicht nochmal gönnen werde. Danach sicherlich, das nehme ich mir fest vor.
Aber warum immer danach? Warum immer das, was uns gut tut, aufschieben, bis wir irgendwann hoffentlich mehr Zeit dafür haben? Ein Ausflug, ein kleiner Spaziergang kostet nichts, und es müssen ja nicht gleich die 10.000 Schritte sein.
Einfach zu lernen, dass es keine Zeitverschwendung ist, wenn man auf sich selbst Acht gibt und auf den eigenen Körper hört. Dass man selbst eben auch einmal an erster Stelle vor dem Lernen, vor der Uni, vor der Arbeit stehen darf. Trotz aller Dinge, die ich in der letzten Woche beim ganzen Lernen verinnerlicht habe – diese eine Sache habe ich noch nicht so ganz kapiert.
(An dieser Stelle noch ein kleines Dankeschön und eine riesige Entschuldigung – oder anders herum – an meine Schwester. War ja auch für deine Gesundheit.)
Beitragsbild: Franziska Schlichtkrull
Banner: Julia Schlichtkrull