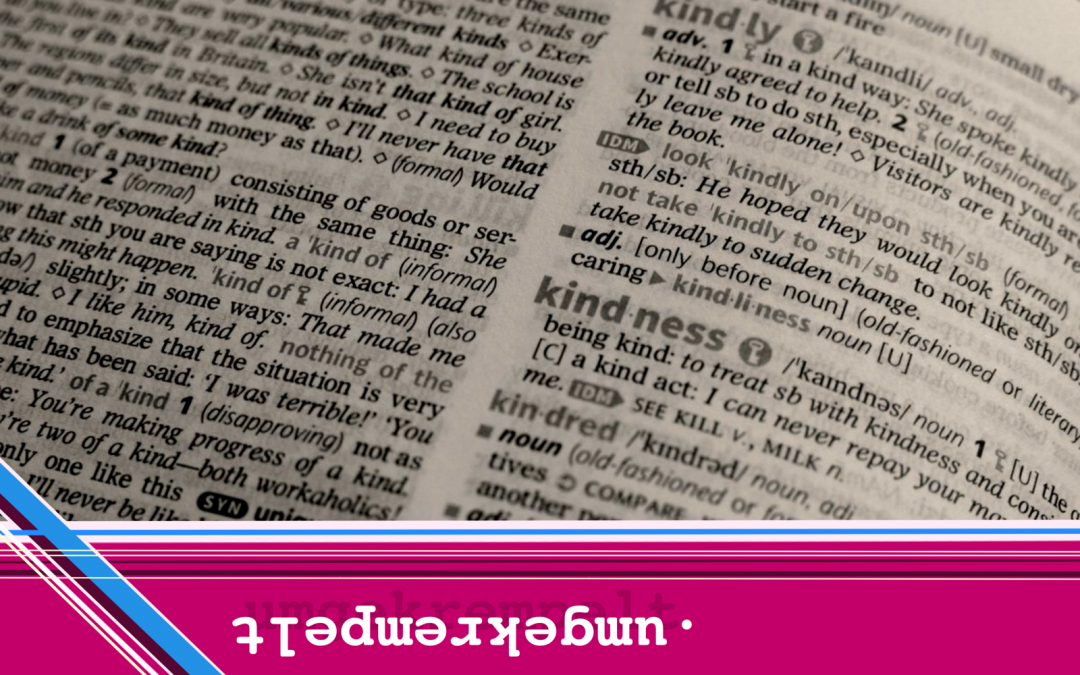von Annabell Hagen | 19.02.2020
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt ihr hier.
Wer trinkt ihn nicht? Morgens zum Frühstück oder gleich als erste Flüssigkeit überhaupt am Tag. Der Kaffee. Wir Deutschen lieben unser schwarzes Gebräu, nicht umsonst besitzen wir eine richtige Kaffeekultur.
Die einen brauchen ihn, um überhaupt in den Tag starten zu können, die anderen lieben ihn einfach zum Frühstück, bei der Arbeit oder eigentlich überall.
Ich darf mich wohl selbst zu den Leuten zählen, die ihren Kaffee, genauer gesagt ihren Latte Macchiato, jeden morgen zum Frühstück genießen und gerne auch mal im Café den einen oder anderen trinken.
Und trotzdem habe ich mich entschieden, eine Woche auf Kaffee in all seinen Variationen zu verzichten.
Der erste Tag stellte sich als besonders schwer heraus. Normalerweise trinke ich jeden morgen zum Frühstück einen Latte Macchiato oder einen Milchkaffee. Heute gab es einen Orangensaft. Das hat mich innerlich irgendwie sehr gestört. In der Bibliothek musste ich unweigerlich auch immer wieder daran denken, wie gut das schwarze Gebräu jetzt wäre. Als es in der Mittagspause in die Mensa ging und im Anschluss noch einmal ins Grüne, kam es gleich zum nächsten Verzicht. Statt eines Cappuccinos gab es eine Ginger-Mate. Ich glaube, ich habe meine Freundinnen etwas neidisch angesehen, während sie ihren Kaffee tranken.
Der nächste Morgen verlief schon etwas besser. Ich hatte zwar immer noch das Verlangen, einen Kaffee zum Frühstück trinken zu wollen, aber es war schon deutlich weniger stark als am Tag zuvor. Trotzdem vermisste ich ihn bei der Mittagspause im Grünen. Gewohnheiten abzusetzen ist nicht so einfach wie erwartet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sich eine innere Unruhe an diesem Tag in mir breitmachte.
Am nächsten Morgen ging es zum Frühstücken zur Bäckerei Junge. Dort holte ich mir eine Schlemmertasche. Auf dem Weg nach Hause ging ich am Café Küstenkind vorbei, wo ich mir normalerweise noch einen Latte Macchiato mitgenommen hätte. Etwas wehleidig bin ich am Café vorbei und dann nach Hause. An diesem Tag hat sich der Entzug richtig auf meine Laune übertragen. Eigentlich hatte ich durchgängig schlechte Laune und war von allem und jedem genervt. An diesem Tag habe ich auch auf das Mittagessen in der Mensa verzichtet.
Der Donnerstag jedoch begann merkwürdigerweise richtig gut. Ich hatte zuhause gefrühstückt und war später mit einer Freundin im Café Küstenkind verabredet. Und da kam auch die Gewohnheit zum Vorschein, denn ohne weiter darüber nachzudenken und vertieft in das Gespräch mit einer Freundin, bestellte ich mir einen Cappuccino. Der Fehler wurde mir erst klar, als wir das Café verließen. Ich muss ehrlich gestehen, es hat mir nicht sonderlich leid getan. Trotzdem habe ich etwas darüber nachgedacht, wie süchtig ich eigentlich nach Kaffee bin. Wobei ich glaube, mit zwei bis drei Kaffee am Tag noch zum allgemeinen Durchschnitt zu gehören. Meine Laune war dafür wieder richtig gut und ich würde sogar meinen, dass mich auch alles deutlich weniger stresste im Vergleich zu den vorherigen Tagen. Deshalb beschloss ich an diesem Punkt, das Experiment zu beenden.
Ich hatte eigentlich angenommen, dass es mir leichter fallen würde auf Kaffee zu verzichten. Aber letztlich hat mich der Entzug gestresst und meine Stimmung beeinträchtigt. Ich glaube, dass es nicht mal am Kaffee selbst gelegen hat, sondern vielmehr daran, dass er seit Jahren fest in meiner Routine verankert ist. Frühstück – Kaffee, im Grünen – Kaffee. Oder im Café – Kaffee. Und plötzlich ohne einen richtigen Grund darauf zu verzichten führt unweigerlich zu Stress. Zumindest in meinem Fall. Trotzdem finde ich, dass es ein spannendes Experiment gewesen ist. Wiederholen würde ich es jedoch nicht.
Beitragsbild: Annabell Hagen
Banner: Julia Schlichtkrull

von Nina Jungierek | 05.02.2020
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues
ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt
das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen
Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage
als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten
Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile
auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt
ihr hier.
Für die nächste Woche nehme ich mir vor, jeden Tag zehn Minuten zu meditieren. Allerdings bin ich schon, bevor mein Selbstexperiment überhaupt startet, überfordert. Denn was Meditation eigentlich genau ist und wie man nun richtig meditiert, davon habe ich keine Ahnung. Zwischen all den Meditations-Apps und nullachtfünfzehn Youtube-Anleitungen fühle ich mich schon nach dem ersten Mal Googeln verloren. Wie soll man sich denn da auch zurechtfinden? Ich schlage also wohl oder übel den Weg in die Bibliothek ein und werfe einen Blick in die Fachliteratur. Ich lerne, dass es beim Meditieren vordergründig gar nicht, wie laienhaft von mir angenommen, um Entspannung und Stressbewältigung geht, sondern darum, Einsichten in unser Sein zu bekommen. Nach einer Dreiviertelstunde Bücher wälzen beschließe ich schließlich, dass für meine Zwecke ein nullachtfünfzehn Video auf Youtube wohl doch ausreichen wird.
Montag
Da sitze ich nun im Schneidersitz und mit geschlossenen Augen vor meinem Fernseher auf dem Boden. Viel mehr passiert auch nicht, als ich mir eine zehnminütige geführte Meditation für Anfänger auf Youtube anhöre. Meine Gedanken schweifen natürlich hin und wieder ab. Trotzdem kann ich mich überraschenderweise die allermeiste Zeit auf mich konzentrieren und am Ende der Meditation durchströmt mich ein seltsames Gefühl der Zufriedenheit.
Dienstag
Leider komme ich heute erst später am Abend zum Meditieren. Aber ich muss sagen, ich habe mich schon den ganzen Tag auf diesen Moment gefreut. Wieder begleitet mich ein Youtube-Video bei meiner Meditation. Es ist alles so wie am Tag davor. Am Ende bin ich zufrieden und verwundert darüber, wie schnell zehn Minuten vorbeigehen können.
Mittwoch
Fast hätte ich das mit dem Meditieren heute vergessen. Ich habe echt viel zu tun diese Woche – umso besser, dass ich mich für ein paar Minuten nicht mit den Problemen des Alltags sondern nur mit mir beschäftigen muss. Und das klappt bisher unerwartet gut. Noch kann ich aber nicht feststellen, ob das Meditieren irgendeine positive Auswirkung auf den Rest meines Lebens hat.
Donnerstag
Am heutigen Tag probiere ich eine geführte Meditation für mehr Selbstvertrauen aus. „Du bist gut genug! Sei so, wie du bist!“ und andere nette Dinge sagt mir eine Stimme immer und immer wieder. Ich bin noch unschlüssig, ob mir das gefallen hat oder nicht. Und ob ich dadurch den Tag mit mehr Selbstvertrauen als üblich meistere, dabei bin ich mir auch eher nicht so sicher.
Freitag
Nach meinem gestrigen Ausflug zur Meditation für mehr Selbstvertrauen, wende ich mich heute dann doch wieder einer normalen Anfängermediationen zu. Und das gefällt mir auch deutlich besser: weniger Worte, die mich ablenken können.
Samstag
Heute ist eigentlich nichts anders als die letzten Tage. Meditieren klappt so gut, wie es eben klappt. Ab und zu kommen mir währenddessen sprunghafte Gedanken, aber trotzdem habe ich das Gefühl, im Laufe der Woche Fortschritte gemacht zu haben, was das angeht.
Sonntag
Für den letzten Tag meines Selbstexperiments habe ich mir noch einmal etwas Besonderes überlegt. Da ich ja jetzt schon etwas geübter in Sachen Meditation bin, will ich versuchen, mal ganz allein ohne irgendeine leitende Stimme zu meditieren. Ich mache mir also entspannende Musik an und stelle einen Wecker auf 10 Minuten. Leider habe ich meine Fähigkeiten dann doch etwas überschätzt, währenddessen frage ich mich nämlich ständig, wie viele Minuten wohl noch übrig sind und kann mich nicht wirklich konzentrieren. Aber wie sagt man so schön: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Fazit
Um wirklich in die Tiefen meines Seins abzutauchen, muss ich wohl noch viel üben. Trotzdem hat mir die letzte Woche Spaß gemacht. Es fühlte sich gut an, sich bewusst ein paar Minuten am Tag nur Zeit für sich selbst zu nehmen. Ist schon komisch, dass das bei mir normalerweise nicht der Regelfall ist. Zwar haben mich die letzten sieben Tage nicht zu einem vollkommen neuen Menschen gemacht, aber mein Selbstexperiment hat mich hier und da entschleunigt und vom Stress um mich herum wenigstens für einen kurzen Moment befreit. In Zukunft werde ich mich wohl öfter, wenn auch nicht jeden Tag, dazu zwingen, mir bewusst Zeit für mich zu nehmen und meine Meditationskünste weiter ausbauen.
Und damit: Namasté!
Beitragsbild: Simon Rae auf Unsplash
Banner: Julia Schlichtkrull

von Lilli Lipka | 22.01.2020
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt ihr hier.
Vor 5 Jahren habe ich noch gesagt: „Niemals könnte ich auf Fleisch verzichten. Ich liebe Pizza und Döner einfach zu sehr“. Inzwischen ernähre ich mich schon seit mehr als zwei Jahren vegetarisch und weiß: Pizza und Döner schmecken auch ohne Fleisch ziemlich geil. Ich hoffe, dass ich diese Erkenntnis in ein paar Jahren auch in Bezug auf vegane Ernährung habe. Ich weiß, wie wichtig der Verzicht auf tierische Produkte für den Schutz unserer Erde und der Tiere ist und eigentlich ist mir auch bewusst, dass ich mein Wohlbefinden nicht über das unserer Umwelt stellen sollte. Trotz allem ernähre ich mich zurzeit liebend gern von tierischen Produkten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass veganer Käse schmeckt, wie man Ei ersetzen oder „echten“ Joghurt durch Sojajoghurt austauschen soll. Trotzdem will ich es probieren, der Umwelt zuliebe. Sieben Tage vegane Ernährung – vielleicht ändert sich meine Meinung ja?
Montag
Der erste Schritt, um mich eine Woche lang vegan zu ernähren, ist, einen Essensplan aufzustellen. Ich weiß, vor allem am Anfang bedarf vegane Ernährung viel Planung. Ich gehe also den Mensaplan durch, der zum Glück fast jeden Tag vegane Gerichte anbietet. Trotzdem muss ich, wenn ich nicht auf Salat ausweichen will, diese Woche öfter mal selbst kochen. Auch nicht schlecht, denn so kann ich mich gleich in veganen Rezepten ausprobieren. Um im Supermarkt keinen Fehler zu machen, lade ich mir die App „Codecheck“ herunter. Indem man den ISBN-Code eines Lebensmittels scannt, kann man damit unter anderem herausfinden, ob es vegan ist.
Im Supermarkt brauche ich heute also ewig: Das Scannen von jedem einzelnen Produkt ist echt mühselig. Außerdem suche ich bei Aldi lange nach veganer Butter und veganem Joghurt, um schließlich festzustellen, dass das hier leider nicht im Sortiment ist. Ich muss also noch zu Edeka und bezahle für einen Joghurt dann 1,50 Euro mehr …
Ansonsten ist das vegane Essen in der Mensa, das ich auch sonst ab und zu gegessen habe, gut. Außer dem Einkauf entwickelt sich der Tag als stressfrei vegan. Ich probiere abends ein Brot mit veganem Käse und Margarine. An der veganen Margarine habe ich nichts auszusetzen, auch der Käse schmeckt überraschend gut. Ich mag sowieso nur Käse, der eigentlich kaum nach etwas schmeckt. Da scheine ich hier richtig zu sein, denn die vegane Version schmeckt eigentlich wie Gouda. Allerdings gibt die Scheibe beim Essen einen grenzwertig säuerlichen Geruch von sich und ich kann mein Käsebrot nur bedingt genießen. Apropos Brot: Online kann man Listen mit Bäckern finden, die auch vegane Brote und Brötchen anbieten. Bei Junge sind diese sogar offiziell mit einem Sticker versehen. Ich fühle mich übrigens wie eine Klischee-Veganerin, als ich frage: „Haben Sie auch veganes Brot?“. Das ist irgendwie unangenehm.
Dienstag
Da ich selten frühstücke (was das Experiment natürlich enorm erleichtert), ist meine erste Mahlzeit das Mittag in der Mensa. Und hier habe ich keine Wahl, ich MUSS das vegane Gericht nehmen, das ich sonst niemals gewählt hätte. Und was soll ich sagen? Obwohl es nicht dementsprechend aussieht, ist es ziemlich lecker! Erfolgserlebnis, würde ich sagen. ich bin voll überzeugt! Auch als ich am Nachmittag Im Grünen statt eines standardmäßigen Latte Macchiato einen Kaffee mit Sojamilch nehme, muss ich zugeben: Die Milch ist zwar dünner und der Geschmack noch ungewöhnlich, aber ich könnte mich damit anfreunden. Bei einem Kaffee bleibt es nicht, ich möchte auch Kuchen. Hier ist die Auswahl auch beschränkt bis winzig. Ich teile mir mit einer Freundin einen mächtigen Karottenkuchen. Der ist wirklich super lecker, aber im Vergleich zu den anderen Backwaren auch ganz schön teuer …
Mittwoch
Ich bin todtraurig: Heute gibt es Milchreis in der Mensa und der wurde sicherlich nicht mit Soja- oder Hafermilch gekocht. Ich muss wieder mit dem veganen Gericht vorliebnehmen und bin erneut völlig von den Socken. Ich hätte dieses Essen normalerweise nicht genommen, aber es ist SO LECKER! Und bestimmt auch gesünder – trotzdem ist es nicht mein geliebter Milchreis.
Zuhause möchte ich mich an mein erstes Experiment wagen: veganen Mozzarella selbst machen. Dafür kaufe ich extra teure Flohsamenschalen und Cashewkerne. Das Ganze ist ziemlich zeitaufwendig und hätte ich keinen Pürierstab, wäre ich aufgeschmissen. Obwohl der fertige Mozzarella ziemlich unansehnlich ist, gebe ich ihm eine Chance. Mit Tomate und Basilikum angerichtet sieht er dann auch echt essbar aus, aber leider werde ich enttäuscht. Die Konsistenz ist glibberig und der Geschmack erinnert nicht ansatzweise an Mozzarella, sondern eher an faden Grießpudding. Also mit weniger Aufwand und Kosten bin ich da mit dem gewohnten Mozzarella besser dran.
Donnerstag
Oft kochen wir in der WG Gnocchi mit Pilzen in Sahnesauce. Weil ich keine veganen Gnocchi finden konnte, gibt es Nudeln. Und statt Sahne aus Kuhmilch nehme ich Hafersahne. Ich stelle fest, dass man in diesem Fall tierische Produkte nicht immer einfach mit pflanzlichen ersetzen kann, um das selbe Ergebnis zu erreichen. Die Hafersahne dickt zum Beispiel nicht automatisch an und am Ende ist von ihr kaum etwas übrig. Mir wird klar, dass ich auf lange Sicht meine alten Kochgewohnheiten ein bisschen umkrempeln muss. Nach der gestrigen Enttäuschung vom Mozzarella möchte ich heute mein Frustessen herstellen. Vegane Bounties sollen es sein. Ich musste mir zwar Silikoneiswürfelförmchen besorgen, ansonsten waren die Zutaten für die Menge jedoch ziemlich günstig und leicht zu finden. Obwohl ich auch hierfür sehr lange brauche und mich das In-(vegane)-Schokolade-tunken der Kokosstücken einen ganzen Nachmittag kostet, ist das Ergebnis echt lecker geworden und hält sich noch Tage lang im Kühlschrank. Ich habe außerdem das Gefühl, dass meine Version „gesünder“ als das Original ist, weil ich hier kaum unnötige Zusatzstoffe drin habe (von der zuckrigen Schokolade abgesehen). Das sehe ich auch als meine Erlaubnis, ganz viel davon zu essen.
Freitag
Heute brunche ich mit Freund*innen. Wir wollen Waffeln machen und meinetwegen müssen wir zu einem veganen Rezept greifen. Das ist zum Glück für niemanden ein Problem. Die Waffeln sind auch echt lecker – vielleicht ein bisschen trocken? Während des Essens ist meine Ernährung großes Thema. Interessiert und kritisch tauschen wir uns über den veganen Lebensstil aus und ich merke: Veganismus ist echt polarisierend. Man kennt ja den Witz: „Woran erkennt man Veganer*innen? – Sie erzählen es dir“. Ich muss dem Ganzen so ein bisschen zustimmen. Gezwungenermaßen musste ich manchmal erwähnen, dass ich mich vegan ernähre, sonst wäre ich nämlich ganz schnell in die Falle getappt und hätte etwas Nicht-veganes gegessen. Ich glaube aber auch, dass man als erfahrene*r Veganer*in solchen Situationen gekonnt aus dem Weg gehen kann. Ich habe außerdem gemerkt, dass das Thema oft gar nicht von mir, sondern von Menschen aus dem Umkreis angeschnitten wird, und – ob ich will oder nicht – es ist dann Gesprächsthema.
Samstag
Heute investiere ich wieder sehr viel Zeit ins Einkaufen. Ich möchte veganes Rührei ausprobieren. Das wird aus Tofu gemacht und mit Kala Namak gewürzt, einem Salz, das nach Schwefel schmeckt und dadurch den typischen Ei-Geschmack schafft. Die Suche nach dem Salz erweist sich in einer kleinen Stadt wie Greifswald allerdings als schwierig. Ich grase also einige Geschäfte ab, bis ich im Bioladen die letzte Packung kurz vor Ladenschluss ergattere.
Mein erstes veganes Rührei ist gar nicht so schlecht geworden. Es hat täuschend viel Ähnlichkeit mit dem Original und der Geschmack geht in die richtige Richtung. Zwar ist das Gemisch noch etwas trocken, aber ich glaube mit ein bisschen Rumprobieren kann das eine würdige Alternative werden!
Abends koche ich vegane Chicken Wings. Das heißt, ich paniere, würze und backe Blumenkohl. Optisch erinnert das Ganze wirklich ein bisschen an Chicken Wings. Ich habe mir dazu vegane Mayo gekauft, die auch super lecker ist. Zwar schmeckt der Blumenkohl nicht wie Hähnchenfleisch, aber das Gericht ist trotzdem super lecker und ein toller, halbwegs gesunder Fast-Food-Ersatz.
Sonntag
Der letzte Tag meiner veganen Woche bricht an und zur Feier
des Tages probiere ich zum Frühstück verschiedene vegane Milchalternativen aus
und gucke mir die Nährwerte an. Nicht alle veganen Drinks schlagen die
Kuhmilch, aber einige sind deutlich gesünder. Hafermilch schmeckt mir
persönlich am besten und macht Kuhmilch wirklich Konkurrenz, allerdings ist die
im Vergleich auch ziemlich ungesund. In Zukunft überlege ich, auf einen
Soja-Reis-Drink umzusteigen, der ganz gut schmeckt und auch nicht so viel
teurer als gewöhnliche Milch ist.
Ich backe außerdem noch einen Kuchen. Käsekuchen ohne
Milchprodukte, das klingt gewagt, oder? Hauptbestandteil des Kuchens ist
Sojajoghurt und ich muss sagen: Der Kuchen ist super lecker geworden. Dass der
vegan ist, würde man kaum schmecken und wenn er mir nicht angebrannt wäre, dann
wäre der Kuchen echt der absolute Renner!
Am Abend, als ich die Challenge fast erfolgreich gemeistert habe, passiert mir dann leider doch noch ein Fauxpas: Gedanklich die Woche schon abgeschlossen und nicht mehr mit kritischem Prüfblick unterwegs, esse ich aus Versehen nicht-vegane Schokolade … Ich lerne: Als Anfänger-Veganerin muss ich aufmerksamer und bewusster durchs Leben wandeln.
Fazit
Die vegane Woche war auf jeden Fall eine Challenge. Sich vegan
zu ernähren ist eine große Umstellung und nimmt erstmal viel Zeit in Anspruch.
Ich glaube aber, dass das nur die Anfangsphase ist und man dann „ein ganz
normales Leben“ führen kann.
Für mich hat sich außerdem bestätigt, dass vegan essen nicht heißt, nur an einer Möhre zu knabbern. Es hat Spaß gemacht, neue Rezepte auszuprobieren und ich habe meinen Horizont extrem erweitert. Leider hat meine Geldbörse auch etwas unter dem Experiment gelitten, denn man kann nicht abstreiten, dass vegane Produkte leider oft teurer als die tierischen sind. Außerdem war es auch sehr interessant, die Gesellschaft aus der Sicht einer Veganerin zu sehen und zu merken, wie polarisierend das Thema oft noch ist und wie kritisch man manchmal beäugt wird. Warum viele Menschen so seltsam reagieren, verstehe ich leider immer noch nicht. Solange ich niemand anderen zu meinem Lebensstil zwinge, ist es doch ‘ne gute Sache, oder?
Ich gehe total motiviert aus dieser Woche. Zwar freue ich mich auf normalen Käse und Nutella, aber nehme mir auch vor, meinen Verzehr von tierischen Produkten deutlich runterzuschrauben und auf Kuhmilch komplett zu verzichten. In der Mensa möchte ich noch öfter das vegane Angebot wahrnehmen, denn ich wurde nicht enttäuscht. Solche Kleinigkeiten sind, denke ich, ein guter Anfang. Und wer weiß, vielleicht eröffne ich in fünf Jahren Gespräche mit dem Satz: „Hey, ich bin übrigens vegan.“
Beitragsbild: Pixabay
Banner: Julia Schlichtkrull
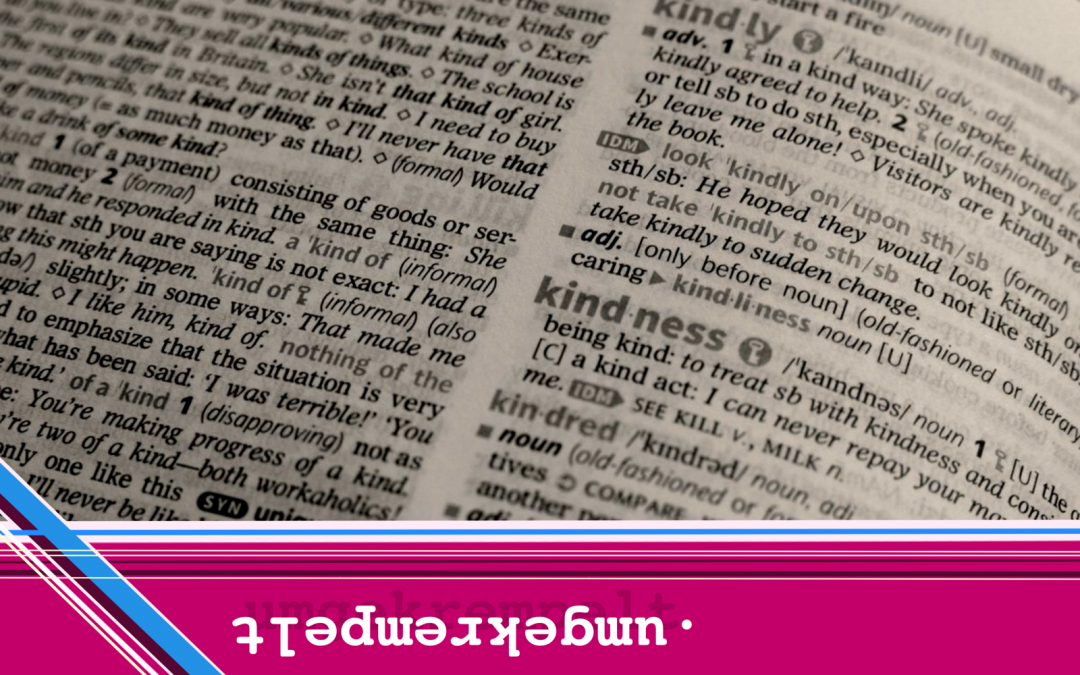
von Lilli Lipka | 18.12.2019
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt ihr hier.
Dieses Mal nehme ich mir vor, sieben Tage „kind“ zu sein. Kindness heißt so viel wie Güte, Liebenswürdigkeit, Gefallen, Nettigkeit. Eine Woche lang „nett“ zu sein, sollte eigentlich keine Challenge, sondern ganz normal sein: Jemandem die Tür aufhalten, kleine Gesten an Freunde und Freundinnen oder Fremden ein Lächeln schenken. Ein bisschen Selbstlosigkeit, ein bisschen Freundlichkeit. Eigentlich doch selbstverständlich, oder? Trotzdem möchte ich versuchen, eine Woche lang besonders freundlich zu sein. So schwer wird das doch nicht sein und ich bin gespannt, ob mir positives Feedback auffallen wird.
Montag
Meine freundliche Woche startet mit Blut spenden. Eine einfache Methode, etwas Gutes zu tun. Man bekommt zwar kein direktes Feedback von den Empfänger*innen, aber Blut wird hier immer gebraucht. Die Krankenschwester betont: „Danke, dass Sie da waren“. Nach einer Dreiviertelstunde gehe ich also mit einem guten Gefühl aus dem Krankenhaus. Für die Woche habe ich mir auch vorgenommen, mehr Komplimente zu machen. Dabei will ich aber ehrlich sein und nicht zwanghaft Honig ums Maul schmieren. Oft denke ich etwas Nettes oder irgendwas fällt mir positiv auf, selten spreche ich das dann aber an. Wir alle freuen uns doch über Komplimente, wieso machen wir so selten welche? Ich schenke einer Freundin also eine liebe Bemerkung über ihr Outfit, sie reagiert daraufhin aber etwas verhalten. Vielleicht ist sie es nicht gewohnt und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll?
Dienstag
Heute nehme ich mir vor, einer fremden Person ein Kompliment zu machen. Als mir also der Stil eines Mädchens in der Mensa gut gefällt, gehe ich zu ihr und sage ihr das. Sie reagiert etwas überfordert, beinahe eingeschüchtert, und irgendwie nicht besonders erfreut. Na klar, ich wäre an ihrer Stelle wahrscheinlich auch völlig überrumpelt und würde vielleicht nach versteckten Kameras gucken. Ich hoffe aber, dass sie sich insgeheim doch gefreut hat. Nach diesem Adrenalinkick brauche ich erst einmal eine Pause vom Komplimente-an-Fremde-verteilen. Ich bin trotzdem weiterhin großzügig mit netten Worten an Freund*innen. Außerdem konzentriere ich mich darauf, an meinem Resting-Bitch-Face zu arbeiten und unbekannte Passant*innen einfach mal anzulächeln. Und – oh Wunder – sehr viele lächeln einfach zurück!
Mittwoch
Ich fahre extra mit dem Auto einkaufen (nicht besonders „kind“ für die Umwelt, ich weiß …), weil mein studierender Nachbar angefragt hat, ob ich nicht demnächst mal seine Bierkästen mitnehmen könne. Klar, ich bin doch jetzt besonders freundlich und freue mich über diese Gelegenheit (natürlich hätte ich das sonst auch gemacht). Außerdem bin ich heute besonders nett zu den Mitarbeitenden im Edeka, sodass mehrere Gespräche entstehen. Vielleicht sind solche Momente ja auch ein kleiner Lichtblick zwischen Tiefkühltruhe und Fleischtheke für die Mitarbeitenden. Außerdem bin ich so „kind“ und bringe meiner Mitbewohnerin aus heiterem Himmel ihre Lieblingschips mit – ich glaube, sie freut sich sehr darüber.
Donnerstag
Den Tag beginne ich wieder damit, einer älteren Dame
zuzulächeln, die sich sichtlich darüber freut. Klingt kitschig, aber ist irgendwie
toll, wie man mit einer Geste einer anderen Person und auch einem selbst den
Tag verschönern kann. Außerdem schicke ich meinen Eltern „einfach so“ online
Blumen nach Hause. Eine kleine Aufmerksamkeit, über die sie sich hoffentlich
noch die nächsten Tage freuen werden. Zusätzlich übernehme ich bewusst mehr
Kleinigkeiten im Haushalt der WG und hänge die Wäsche meiner Mitbewohnerin auf (was
am Ende zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber eine nett gestimmte Mitbewohnerin bedeutet).
Freitag
Natürlich kann man in so einer Selbstexperiment-Woche nicht erzwingen, dass plötzlich eine Oma auftaucht, der man die Einkäufe nach Hause bringen oder über die Straße helfen kann. Trotzdem versuche ich, auch solche Gesten irgendwie vermehrt in meinen Alltag zu integrieren. So achte ich beispielsweise gezielt darauf, Menschen vorzulassen oder so viele Türen wie möglich aufzuhalten. Zwar ist das nicht immer nötig, aber ich ernte dafür oft ein Lächeln oder ein erfreutes „Danke“. Zwischen all den positiven Eindrücken und Rückmeldungen mache ich am Abend doch eine kleine negative Erfahrung: Ich werde von einem jungen Mann, der mir schon bekannt war, um Geld für den Bus gebeten. Ich gehe nicht wie sonst üblich ignorant vorbei, sondern gebe ihm die zwei Euro. Irgendwie fühle ich mich danach aber schlechter und ein bisschen ausgenutzt, weil ich dafür weder ein „Danke“ noch ein Lächeln bekommen habe. Trotzdem soll mich sowas nicht abschrecken, denn dass nicht alle sofort nett reagieren, nur weil man es selbst ist, gehört wohl auch dazu.
Samstag
Ich habe, freundlich wie eh und je, einen Kuchen für meine
Mitbewohnerin und mich gebacken. Aber ausnahmsweise wurde dieses Mal bei den
Nachbar*innen geklingelt und geteilt. Außerdem mache ich seit meiner Kindheit
das erste Mal wieder bei „Weihnachten im Schuhkarton“ mit. Ein Projekt, bei dem
man einen Schuhkarton mit Spielzeugen, Kleidung und Süßigkeiten für ein Kind
aus einer armen Region zu Weihnachten packt. Es macht so viel Spaß, die Kiste
zu packen und sich auszumalen, wie sich ein fremdes Kind über die Geschenke
freut.
Sonntag
Mit einer Freundin lasse ich die sieben Tage „Kindness“ ausklingen, indem wir Müll auf der Straße sammeln gehen. Ich dachte, das wäre in Greifswald schwer, aber ich werde enttäuscht. Nach 20 Minuten müssen wir schon wieder umkehren, weil wir die zwei, mit dem buntesten Abfall und prall gefüllten Mülltüten kaum noch tragen können. Es liegt einfach so viel rücksichtslos Weggeschmissenes herum. Beim Sammeln wurden wir außerdem komisch von den Passant*innen beäugt – warum denn? Das ist doch eine gute Tat, warum wird uns nicht mehr Dankbarkeit entgegengebracht? Und weil ich weiß, dass auf den Greifswalder Straßen und Wiesen noch so viel Müll liegt, bin ich motiviert, auch nach dieser Woche weiterzusammeln.
Das Fazit
Sowieso hat mir diese Woche gezeigt, dass „nett“ sein nicht schwer ist. Ich bin zwar schon vorher davon ausgegangen, recht nett zu sein, aber noch genauer darauf zu achten hat ein größeres Bewusstsein geschaffen und mir gezeigt: Da geht noch mehr! Ich versuche in Zukunft noch großzügiger mit netten und aufmerksamen Worten zu sein und vielleicht traue ich mich auch öfter, Fremden ein Kompliment zu machen. Ich möchte mehr Menschen anlächeln und häufiger Türen aufhalten. Es muss nicht immer materiell sein, aber Freund*innen öfter eine kleine Aufmerksamkeit zu machen, nehme ich mir auch vor. Denn (Achtung, Kitschalarm): Das Lächeln, dass du aussendest, kehrt zu dir zurück. Oder so ähnlich. Also, probiert doch mal aus, noch freundlicher zu sein – so schlimm ist es nicht.
Beitragsbild: Lilli Lipka
Banner: Julia Schlichtkrull

von Carla Koppe | 04.12.2019
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt ihr hier.
Das Experiment
Eine Woche lang jeden Morgen Frühsport treiben – als ich mich in der Redaktion für dieses Selbstexperiment meldete, befand sich Greifswald noch mitten in einem goldenen Oktober und ich mich offensichtlich nicht ganz bei Verstand. Hinter mir lag ein Sommer, in dem ich tatsächlich als Ausgleich zu meiner Bachelorarbeit ab und zu gerne morgens Sport gemacht hatte. Bei warmem Sonnenschein durch die Credner-Anlagen zu joggen, vorbei an entspannt herumstaksenden Störchen, kann einem aber auch ein bisschen den Kopf verdrehen. Im November dagegen ist es wettertechnisch morgens eher unappetitlich und so war ich drei Wochen später, als mein Experiment startete, schon nicht mehr ganz so überzeugt davon. Um nicht gleich nach zwei Tagen erbärmlich zu scheitern, entschied ich großzügig, dass alles vor 11 Uhr morgens für mich als Frühsport durchgehen würde. Über die genauen Sporteinheiten machte ich mir vorher tatsächlich noch nicht allzu viele Gedanken. Ich wollte einfach das, was ich sonst so an Sport machte öfter und eben morgens machen. So schwer konnte das ja wohl nicht sein …
Tag 1: Mittwoch
Der erste Tag meines Selbstexperimentes ist ein Mittwoch, da ich mir die anstrengendsten Tage meiner Woche für den Schluss aufheben will. Ich bilde mir gutgläubig ein, dass ich dann bestimmt schon an den Frühsport gewöhnt sei. Nach dem Frühstück gegen halb neun mache ich mich zu einer lockeren Laufrunde um den Wall und ein Stück den Ryck entlang auf. Insgesamt laufe ich etwa eine halbe Stunde und komme aufgrund des sonnigen Herbstmorgens gut gelaunt wieder zuhause an. Nach dem Duschen fühle ich mich zunächst super. Ein Gefühl, als hätte ich bereits echt etwas geschafft an diesem Tag. Als ich jedoch gegen 14 Uhr in der Uni sitze, fällt mir dann doch etwas Seltsames auf. Ich sitze einfach total zufrieden und leicht schläfrig im warmen Seminarraum und habe nicht das geringste Bedürfnis, mich an den Diskussionen zu beteiligen. Mein Körper ist anscheinend mit seiner Tagesleistung bereits zufrieden und findet es vollkommen ausreichend im Ruhemodus zuzuhören. Okay, mir ist schon klar, dass still und schläfrig in der Uni sitzen jetzt keine Besonderheit unter Studierenden darstellt, auch ich kenne das nur zu gut, aber diese Zufriedenheit dabei ist mir definitiv neu.
Tag 2: Donnerstag
Heute Morgen habe ich mich für ein Yoga-Tutorial auf YouTube entschieden, da ich am Nachmittag bereits zum Bouldern verabredet bin, und mich nicht schon vorher verausgaben möchte. Man sieht, ich habe aus dem gestrigen Tag gelernt. Da ich kein Yoga-Profi bin, gebe ich bei Youtube einfach „Yoga für Anfänger“ ein und wähle das erste Video, in dessen Beschreibung irgendwas mit „Morgenroutine“ vorkommt. Ich habe Glück und bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Innerhalb von 17 Minuten absolviere ich in meinem Wohnzimmer auf der Yogamatte ein kurzes, aber durchaus anstrengendes Training, das mich aufgrund meiner vollkommenen Ungeübtheit ordentlich fordert. Zum Abschluss werde ich in der Entspannungsphase noch aufgefordert, mir ein kleines Ziel für den Tag zu überlegen. Ich fühle mich tatsächlich wach und mental bereit für den Tag, etwas mehr als sonst. Der verläuft danach auch relativ entspannt. Ich bin jedoch heilfroh, dass ich mich morgens für eine so kraftsparende Sportvariante entschieden habe, da ich sonst wahrscheinlich meine Boulderverabredung hätte sausen lassen. Warum sollte man auch abends im Dunkeln nochmal raus in den Regen, wenn bereits ein anstrengendes Sportprogramm hinter einem liegt? Da hätte ich definitiv ein Motivationsproblem gehabt.
Tag 3: Freitag
Heute wird es ernst. Ich habe tatsächlich zwei Freundinnen, die Lust haben, mit mir um 8 Uhr morgens zum Sport zu gehen. Die ambitionierte Uhrzeit kommt dabei allerdings nicht ganz freiwillig zustande. Da wir dieses Semester Teilnehmerinnen des Kraftsportkurses im Rahmen des Hochschulsports sind, wollen wir in den Kraftraum der Uni und der hat morgens leider einen sehr begrenzten Zeitrahmen von 8 bis 9.30 Uhr. Ein guter Plan, doch natürlich sind auch wir nur Menschen und allem Anschein nach nicht ganz so verrückt wie gedacht, denn als ich morgens um 7 Uhr verschlafen auf mein Handy schaue, sehe ich natürlich von beiden Freundinnen eine Absage. Das daraufhin logischerweise einsetzende Motivationstief betäube ich mit ganz viel Kaffee und mache mich tapfer alleine auf den Weg.
Schon der Weg mit dem Rad über den Wall weckt meine Lebensgeister und ich bin positiv überrascht, dass ich nicht die einzige Person im Kraftraum bin. Auf dem Rückweg ist sogar die Sonne rausgekommen und ich bin total high von dem Gefühl, vor halb zehn schon richtig was geschafft zu haben. Voller Tatendrang fahre ich noch bei der Post vorbei und mache einen Wochenendeinkauf im nächsten Supermarkt. Nach dem gemütlichen Belohnungs-Frühstück zuhause kommt jedoch das Tief. Mein Körper ist mal wieder der Meinung, genug für den Tag geleistet zu haben und geht in den Entspannungsmodus. Statt wie geplant in die Bib zu gehen hält er es für viel sinnvoller, gemütlich zuhause zu lernen, was sich leider zu einem der unproduktivsten Tage seit langem entwickelt. Auch abends bin ich absolut nicht motiviert, mich von meiner gemütlichen Couch fortzubewegen und lasse mich nur sehr ungern raus in die kalte Dunkelheit und in die meiner Wohnung am allernächsten liegende Bar mitschleppen.
Tag 4: Samstag
Mein Körper protestiert inzwischen auf ziemlich schmerzhafte Weise gegen das ungewohnte Sportpensum. Ich habe den Muskelkater meines Lebens, anscheinend bin ich echt nicht besonders fit. Auch die paar Drinks vom letzten Abend machen sich etwas bemerkbar und als ich aus dem Fenster schaue, regnet es in Strömen. Für meinen schönen Plan, mal wieder eine lange Runde am Ryck entlang zu laufen, bin ich heute definitiv nicht bereit!
Also muss wieder die Yogamatte her. Das heutige Video mit morgendlichem Yoga-Inhalt ist sehr viel langsamer und meditativer als das letzte, doch ich bin vollkommen zufrieden damit. Um ehrlich zu sein wäre heute definitiv ein Tag, an dem ich mir normalerweise immer eine Pause vom Sport gönnen würde. Muskelkater, wenig Schlaf und leichter Restalkohol, dazu noch ein verregneter Novembermorgen – das schreit ja geradezu nach einem Tag auf der Couch. Ich würde jetzt auch gerne erzählen, wie gut mir das Yoga trotz all dieser Umstände getan hat und wie vital/fit/und so weiter ich mich danach gefühlt habe, doch um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur froh, als es endlich vorbei ist. Der restliche Tag verläuft dann ziemlich unspektakulär, mir fällt jedoch auf, dass ich langsam den Schlafrhythmus eines Grundschulkindes annehme. Ich könnte wirklich jeden Abend um 21 Uhr ins Bett gehen.
Tag 5: Sonntag
Aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund ist mein Muskelkater heute noch schlimmer als gestern. Doch abgesehen davon starte ich komplett anders in den Tag. Aufgrund meines Grundschulkind-Schlafrhythmus war ich früh im Bett und bin noch vor meinem Wecker gegen halb acht wach. Der Himmel ist zwar eine einzige weiße Wolkendecke, doch es ist trocken und höchste Zeit für meinen gestern versäumten Lauf. Voll motiviert trete ich aus der Haustür und habe sofort das Gefühl in eine Wand aus Kälte zu laufen. Es sind knapp 4 Grad draußen und ich bin definitiv falsch angezogen. Da die Versuchung des warmen Bettes drinnen jedoch zu groß wäre, verzichte ich auf wärmere Sachen und laufe Zähne zusammenbeißend los. Dabei rede ich mir ein, ich hätte doch mal irgendwo gelesen, man solle im Herbst sowieso immer Laufkleidung anziehen, mit der man zu Beginn des Laufes friert. Ob das wirklich stimmt oder nicht, in meinem Fall scheint es zu funktionieren, denn nach den ersten fünf bis zehn wirklich nicht angenehmen Minuten hat sich mein Körper tatsächlich aufgeheizt. Trotz klirrender Kälte und anhaltendem Muskelkater absolviere ich einen meiner besten Läufe seit langem. Greifswald ist wie leergefegt und an keiner Straße muss ich stehen bleiben, um Autos abzuwarten, was definitiv ein großer Pluspunkt von Sonntagmorgenläufen ist. Die einzigen wenigen Menschen, die mir begegnen, sind andere Läufer oder Mütter mit Kinderwägen.
Obwohl ich den restlichen Tag mit Lernen verbringen muss, geht es mir eigentlich ganz gut. Dass ich bereits draußen gewesen bin und mich dazu auch noch ordentlich bewegt habe, macht sich positiv bemerkbar. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir, allerdings auch schon wieder um halb zehn im Bett.
Tag 6: Montag
Langsam muss ich mir eingestehen, dass der von mir erhoffte Effekt, nämlich eine Gewöhnung oder sogar Wertschätzung des Frühsports, wohl nicht mehr eintreten wird. Klar, auf irgendeine Weise habe ich mich daran gewöhnt. Ich stehe morgens inzwischen resigniert auf anstatt mit meinem inneren Schweinehund um 5 Minuten mehr Schlafenszeit zu feilschen, aber es nervt langsam, sich jeden Tag zu überlegen, was am nächsten Morgen für ein Sport gemacht werden könnte. Man will und kann ja nicht jeden Tag dasselbe machen. Dazu ist es etwas umständlich, dass dieser Sport dann immer morgens stattfinden muss. An vielen Tagen, wie zum Beispiel heute, würde es mir abends oder nachmittags nach der Uni nämlich viel besser passen, wenn man genug Zeit hat und den Kopf frei bekommen möchte. Aber leider heißt das Experiment nicht „Jeden Tag Sport machen“, sondern „Jeden Tag Frühsport machen“ und so hilft mir nur der Gedanke, dass es morgen vorbei sein wird.
Heute fahre ich wieder um acht in den Kraftraum der Uni. Auf dem Weg dahin fällt mir trotz meiner Genervtheit dann doch etwas Positives auf. Tatsächlich ist es im November um 8 Uhr morgens schon hell, ganz im Gegensatz zum Nachmittag oder Abend, da es bereits ab halb 5 dunkel wird. Ich kann im Hellen zum und vom Sport nach Hause fahren und habe tatsächlich mehr Licht, als wenn ich nachmittags gehen würde. Diese zugegeben sehr späte Entdeckung begeistert mich, da Dunkelheit durchaus eine große Rolle bei meiner Motivation spielt. Ich nehme mir vor, auch nach dem Experiment einmal die Woche morgens Sport zu treiben, um von dem neu entdeckten Lichtbonus zu profitieren.
Tag 7: Dienstag
Zur Feier meines letzten Tages erhöhe ich den Schwierigkeitsgrad. Da mein Stundenplan dieses Semester sehr gnädig mit mir ist und ich tatsächlich keine einzige 8-Uhr-Vorlesung habe, will ich heute ausprobieren, wie eine Frühsporteinheit aussehen könnte, wenn man Uni im ersten Block hat.
Als mein Wecker klingelt, ist es diesmal natürlich noch stockdunkel. Nicht mal der Hauch eines Sonnenaufgangs ist zu sehen und die Anziehungskraft meines Bettes verhundertfacht sich auf der Stelle. Natürlich spiele ich mit dem Gedanken, das Ganze zu verwerfen. Wer braucht bei diesem Experiment schon eine Schwierigkeitserhöhung, als ob Frühsport generell nicht schon ambitioniert genug wäre?! Doch dann schleppe ich mich trotzdem auf die zum Glück bereits am Vortag ausgerollte Yogamatte.
Zu sehen, wie es hell, wird war definitiv nett, alles andere eher mau. Ein halbstündiges Pflichtprogramm an Bewegung zu absolvieren, nur um sich danach beim Frühstück und unter der Dusche zu stressen, ist es mir auf jeden Fall nicht wert. Da würde ich immer lieber in Ruhe abends eine richtige Sporteinheit vorziehen. Auch bin ich morgens nicht besonders ehrgeizig bei der Auswahl meiner Bewegung und erwische mich dabei, wie ich eher zu den meditationsartigen Yoga-Videos tendiere als zum Beispiel zu einem anstrengenden Krafttraining. Vielleicht wäre das im Sommer anders, wenn man um die Uhrzeit bereits draußen im Hellen sein kann, aber in diese kalte Dunkelheit kriegt mich niemand raus.
Den restlichen Tag
bin ich trotz acht Stunden Uni ziemlich gut gelaunt. Es ist zwar etwas traurig
zuzugeben, aber der Grund dafür ist leider das Ende des Experimentes. Ich bin
wirklich erleichtert. Ein bisschen so wie das Wochenendgefühl am Freitag, nur
dass heute Dienstag ist.
Das Fazit
Rückblickend war es auf jeden Fall eine Woche mit Höhen und Tiefen. Ich denke meine Erleichterung am Ende kam vor allem daher, dass ich nun nicht mehr täglich Sport machen musste. Ich bewege mich eigentlich gerne, mir ist aber auch klar, dass ich nicht sieben Tage die Woche ein anstrengendes Krafttraining absolvieren kann. Da kriege ich dann nach drei Tagen vor Muskelkater die Kühlschranktür nicht mehr auf. Also musste ich mir Yoga-Regenerationstage zuhause einbauen. Die habe ich allerdings meist eher etwas schlapp abgearbeitet und mich geärgert, dass ich dafür früher aufstehen musste. Auch hatte ich danach im Gegensatz zu den Lauf- und Krafttrainingstagen selten das Gefühl, bereits wirklich etwas geschafft zu haben. Für mich persönlich kann ich daraus schließen, dass ich einfach nicht der Typ Mensch für tägliche Sportaktivitäten bin. Wenn ich es dreimal die Woche schaffe, bin ich mehr als zufrieden mit mir und ehrlich gesagt ist das auch die Anzahl der Tage, an denen ich innerhalb des Experimentes wirklich gute Trainings hatte. Mein Problem lag also eher bei den täglichen Einheiten und nicht so sehr bei dem frühmorgendlichen Sport. Trotzdem will ich nicht behaupten, dass das frühere Aufstehen mir großen Spaß gemacht hätte. Ich hatte Glück, dass in der Woche feiertechnisch wenig los war und meine Univeranstaltungen nie vor zehn Uhr begannen. Wäre das anders gewesen, hätte ich bestimmt nicht die komplette Woche durchgehalten. So aber konnte ich meinen Grundschulkind-Schlafrhythmus richtig ausleben. Die Entdeckung, dass es um 8 Uhr morgens im November deutlich heller als am Nachmittag ist, begeistert mich tatsächlich immer noch. Trotzdem war ich in den zwei Wochen seit dem Experiment natürlich nicht ein einziges Mal um diese Uhrzeit beim Sport. Ich gehe jedoch weiterhin gerne sonntagmorgens durch die menschenleere Stadt laufen und genieße danach das Gefühl, so früh am Tag schon richtig was geschafft zu haben.
Grundsätzlich erkenne ich also durchaus die Vorzüge des Frühsports, doch ich will ihn nicht machen müssen nur um des Machens Willen. Wenn es mir zeitlich nicht passt oder ich mich nicht so fit fühle, verzichte ich lieber darauf oder verschiebe ihn auf später als irgendetwas Halbherziges zu machen, aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Vielen hilft es wahrscheinlich gerade an solchen Tagen, sich morgens kurz Zeit zu nehmen und den Körper mit Bewegung in Gang zu bringen. Abschließend will ich nur noch sagen, dass es mir durchaus einigen Stress erspart hätte, die einzelnen Sporteinheiten genauer durchzuplanen und dass dieses Experiment vermutlich in einem Sommersemester sehr viel positiver ausgefallen wäre, wenn es draußen warm und die Credner-Anlagen voller Störche gewesen wären.
Beitragsbild: Carla Koppe
Banner: Julia Schlichtkrull

von Lilli Lipka | 20.11.2019
Kennt ihr das, wenn man mal was Neues ausprobieren will, aber am Ende alles beim Alten bleibt? Uns jedenfalls kommt das sehr bekannt vor, deswegen haben wir uns für euch auf einen Selbstoptimierungstrip begeben. In dieser Kolumne stellen wir uns sieben Tage als Testobjekte zur Verfügung. Wir versuchen für euch mit unseren alten Gewohnheiten zu brechen, neue Routinen zu entwickeln und andere Lebensstile auszuprobieren. Ob wir die Challenges meistern oder kläglich scheitern, erfahrt ihr hier.
Ich muss gestehen: Ich bin abhängig. Süchtig nach meinem Smartphone. In einer festen Beziehung mit meinem Handy. Ich liebe es, dem Alltag zu entfliehen und in die Tiefen von Instagram abzutauchen; ich liebe es, jederzeit meine Freunde erreichen zu können und ich liebe die Vielfalt an Möglichkeiten, die einem die Apps bieten. Trotzdem glaube ich, dass mein Handy mir auch viel kaputt macht.
Unsere Eltern sagen doch selbst: „In eurem Alter sind wir auch ohne diese technischen Geräte ausgekommen!“ – das stimmt, selbst ich konnte vor zehn Jahren noch ohne Podcast auf den Ohren einschlafen oder mich verabreden, ohne dieses kleine elektronische Ding zu verwenden. Aber könnte ich es heute noch? In diesem ersten Teil der Selbstexperiment-Reihe möchte ich versuchen, sieben Tage auf meinen liebsten Begleiter und Helfer in der Not zu verzichten: mein Smartphone. Mich komplett von der Außenwelt abzukapseln traue ich mich aber noch nicht, deswegen habe ich ein altes Tastenhandy rausgekramt, sodass ich auch das Leben meiner Mitmenschen nicht allzu schwer mache.
Montag
Es fängt gut an. Eine Freundin soll mich aus der Heimat mit nach Greifswald nehmen. Normalerweise kriege ich kurz vorher eine WhatsApp-Nachricht mit „Fahre jetzt los“ und weiß Bescheid. Jetzt mussten wir im Vorhinein fest planen, wann sie herkommt – wie unflexibel ist das denn bitte? Die zweistündige Autofahrt kann ich nicht wie sonst damit verbringen, am Handy zu spielen. Altbackene Sachen wie aus dem Fenster zu schauen oder sich zu unterhalten sind jetzt angesagt. Aber irgendwie kann ich auch das überstehen, Mecklenburg-Vorpommern sieht ja eigentlich ganz nett aus.
Zuhause angekommen geht es mit meiner Mitbewohnerin in den Supermarkt. Normalerweise tragen wir unsere gemeinsamen Ausgaben in eine App ein, aber jetzt muss ich doch tatsächlich die Kassenbons sammeln und die Ausgaben mit einem echten Stift auf einem echten Blatt Papier festhalten … Um unsere Lebensmittel zu verbraten, würde ich jetzt normalerweise eine meiner Koch-Apps verwenden. Einfach Stichworte eingeben, durch den Feed scrollen und vor allem die Bewertungen von anderen User*innen beachten. Aber jetzt können meine eingestaubten Kochbücher zum Einsatz kommen. Und ich muss sagen, ein Buch mit vielen schönen Bildern durchzublättern ist ja auch voll inspirierend – fast so wie ein Real-Life-Koch-App-Feed!
Im Seminar am Nachmittag, in dem ich normalerweise schnell
die Konzentration verliere, bin ich heute überraschend konzentriert. Ich kann
nicht zwischendurch auf mein Smartphone gucken und so schneller den Faden
verlieren und habe daher auch nicht die ganze Zeit die Uhr im Blick. Apropos
Uhr: Ich glaube, ich muss mir für die folgende Woche angewöhnen, eine
Armbanduhr zu tragen. Für mich ein Relikt aus alten Zeiten, das heute
eigentlich nur noch als Accessoire dient.
Abends vorm Fernseher fällt mir auf, wie ich ganz komisch mit meinen Fingern spiele – normalerweise würde ich jetzt mein Smartphone in der Hand halten. Was sind das für unterbewusste Angewohnheiten, die mein Körper da an den Tag legt? Es tut aber irgendwie gut, meine volle Aufmerksamkeit nur einer Sache zu widmen und einen Film zu gucken ohne nebenbei Instagram zu checken.
Am meisten Angst habe ich vor dem Einschlafen.
Einschlafprobleme hatte ich schon immer und ich weiß auch, dass elektronische
Geräte abends ein Tabu sein sollten. Trotzdem wiege ich mich immer in den
Schlaf, indem ich so lange am Handy bin, bis mir die Augen zufallen. Und dann
ist trotzdem noch nicht Schluss, dann höre ich immer einen Podcast, um endgültig
wegzunicken. Jetzt lese ich seit Ewigkeiten mal wieder ein Buch vorm
Zubettgehen und denke einfach nach. Aber ohne diese gewohnte Dauerunterhaltung
einzuschlafen kostet mich zwei Stunden.
Dienstag
Heute bin ich nach dem Weckerklingeln (ich musste mir doch tatsächlich einen analogen Wecker stellen!) sofort aufgestanden und habe nicht wie üblich eine halbe Stunde am Handy verdattelt. So viel Zeit am Morgen zu haben ist ungewohnt, was fange ich damit an?
Im Spanischunterricht würde ich eigentlich die ganze Zeit meine Übersetzer-App benutzen. Jetzt muss ich Vokabeln im Buch nachschlagen. Klar ist das auch kein Problem (mit einem Wörterbuch kann ich gerade so noch umgehen), aber es ist deutlich zeitaufwändiger.
Später sitze ich in einer Vorlesung ganz alleine da. Meine Freunde (die auch meine Motivation waren, überhaupt zu erscheinen) tauchen einfach nicht auf. Später höre ich: „Ich hab‘ dir doch ’ne SMS geschrieben!“ – die ist aber leider nie angekommen … Ich selber verschicke im Laufe des Tages auch die eine oder andere SMS. Für 20 Zeichen brauche ich circa fünf Minuten (ohne Zeichensetzung).
Mittwoch
Heute habe ich super geschlafen und bin wieder gut aus dem Bett gekommen. Ich hatte wieder ein langweiliges Seminar, aber bin durch die fehlende Versuchung der Ablenkung erneut am Ball geblieben. Und zwischen den Veranstaltungen bin ich gezwungen, mich zu unterhalten – sogar das überstehe ich ganz gut. Schon öfter ist mir vorher aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, in den Minuten vor Beginn einer Lehrveranstaltung Gespräche anzufangen, weil sich alle in ihr Handy flüchten. Es ist schwer, Unterhaltungen aufzubauen, wenn jede*r ihren*seinen Fokus auf das Smartphone legt. Diese Möglichkeit, sich gewissen Situationen zu entziehen, kann zwar auch echt praktisch sein, aber ich glaube, dass die sozialen Kontakte im echten Leben dadurch häufig zu kurz kommen.
Später verabrede ich mich persönlich mit einer Freundin zum Mensaessen. Normalerweise hätten wir das ganz spontan per WhatsApp geklärt. Jetzt müssen die Uhrzeiten wieder genau festgelegt werden. Diese Spontanität vermisse ich ein bisschen. Und was wäre, wenn ich unzuverlässige Freund*innen hätte?
Donnerstag
Kleines Zwischenfazit: Mein Handy fehlt mir gar nicht, denn wenn die Versuchung nicht da ist, spiele ich gar nicht erst mit dem Gedanken, es zu benutzen. Allerdings erwische ich mich dabei, mein Tastenhandy öfter anzuklicken, in der Hoffnung, mal eine „Mitteilung von draußen“ zu bekommen.
Trotzdem beschäftigt mich die komische Frage, was man früher
eigentlich in „Überbrückungszeiten“ gemacht hat. Zum Beispiel: Die Dusche ist
besetzt, in fünf Minuten kann ich ins Badezimmer. In der Zeit kurz mal die News
oder Facebook checken geht nicht. Mein Zimmer ist aufgeräumt, ein neues Kapitel
im Buch möchte ich jetzt auch nicht anfangen. Was macht man jetzt? Aus dem
Fenster gucken? Nachdenken? Oder einfach mal nichts tun? Ich glaube, das mache
ich eigentlich viel zu wenig. Vielleicht ist das auch mal ganz gesund.
Heute erwische ich mich dabei, wie ich meine Freund*innen frage, was denn so Interessantes in den sozialen Medien abgeht. Welche Memes verpasse ich und welche*r Blogger*in hat eine neue Duschbadkollektion rausgebracht? Richtige Breaking News bekomme ich höchstens in der Tagesschau mit und bin dann super überrascht, während alle anderen in ihrer News-App schon zwölf Stunden vorher davon erfahren haben.
Freitag
Am Freitag ist eines der ersten Dinge, die ich normalerweise tue, auf Spotify die neuen Musikerscheinungen zu checken. So sehr haben mir Musik-Apps bis jetzt nicht gefehlt: Ich höre einfach die ganze Zeit CD oder ein bisschen Radio. Aber für unterwegs und zwischendurch lobe ich mir doch meine Streamingdienste.
Ich gehe einkaufen und schreibe mir eine echte Einkaufsliste. Wieder mit Papier und Stift und so. Unterwegs fällt mir ein, dass ich eine Tarte backen wollte, aber mir gar kein Rezept rausgesucht habe. Mal schnell googeln kann ich jetzt nicht, also muss ich Zutaten auf gut Glück kaufen und hoffen, dass das hinkommt. Zuhause fehlt mir dann auch noch eine Tarteform. Eigentlich würde ich schnell meine Nachbarin per WhatsApp fragen, ob sie eine hat. Jetzt muss ich doch tatsächlich persönlich klingeln.
Wenn es Dinge zu klären gibt, schreibe ich jetzt öfter Mails am Laptop oder überwinde teilweise meine Telefonierphobie. Das macht auch mehr Spaß: weniger sinnlose Kurznachrichten, sondern ein kleiner Text, der das Wichtigste enthält oder ein Telefonat von zwei Minuten, anstatt über mehrere Stunden zehnsekündige Sprachnachrichten und Emojis zu verschicken.
Später bin ich am Ryck verabredet. Ich komme ein paar
Minuten zu spät und kann das nicht mal eben per WhatsApp mitteilen.
„Hoffentlich glaubt sie nicht, ich hatte einen Unfall, nur weil ich nicht da
bin oder mich nicht melde“, denke ich mir.
Samstag
Ich gehe mit einer Freundin Sport machen. Vorher war ich schon echt produktiv, denn dieses „Ich bleib noch kurz liegen und check Social Media“-Ding fällt weg. Deshalb stehe ich inzwischen direkt auf und überlege mir etwas Sinnvolles, was ich stattdessen tun kann.
Beim Sport stehe ich vor einem Problem: Wie tracke ich meine sportlichen Ergebnisse? Wie viele Kilometer waren das jetzt? Wie lange waren wir unterwegs und wie viele Kalorien habe ich verbrannt? Muss ich jetzt echt einfach nach Gefühl gehen und nicht darauf achten, wie eine kleine Maschine mich einschätzt?
Sonntag
Ich brauche eine Taschenlampe! Wer hat denn heutzutage in einem Studierendenhaushalt noch eine Taschenlampe? Das macht doch sonst mein Smartphone! Muss ich jetzt echt mit einer Kerze unter das Regal leuchten?
Ich muss trotzdem zugeben: Mir fehlt mein Smartphone gar nicht so sehr. Ich, die normalerweise drei bis vier Stunden Bildschirmzeit am Tag hat, bin erstaunt, wie leicht mir der Verzicht fällt. Noch erstaunter bin ich, wie einfach es sich ohne Instagram und Co. lebt. Ich hätte gedacht, dass das eine größere Hürde für mich wird. Aber eigentlich ist es ja auch nur eine Beschäftigung, die ich mir suche, wenn ich nichts Besseres zu tun habe.
Am meisten hat mich gestört, dass die Kommunikation so schwierig war. Das hat nicht nur mich selbst, sondern auch mein Umfeld genervt. Schließlich war es auch für alle anderen eine Umstellung, mich nicht auf dem gewohnten Wege erreichen zu können. Klar muss man nicht immer 24/7 am Smartphone hängen, aber es ist schön zu wissen, erreichbar zu sein. WhatsApp und Gruppenchats können die Organisation einfach ungemein erleichtern.
Außerdem haben mir Podcasts zum Einschlafen gefehlt. Ja, es ging irgendwann auch ohne. Und wenn ich länger üben würde, könnte ich mich auch daran gewöhnen, so einzuschlafen. Aber ob ich dieser Versuchung länger widerstehen kann, weiß ich nicht.
Und dann hat mir mein Handy einfach in den alltäglichsten Situationen gefehlt. Es ersetzt so viele Dinge, die man nicht mehr bei sich tragen muss: Taschenrechner, Wörterbuch, Taschenlampe, Stoppuhr, Laptop, Karten, Uhr, Tickets, Bücher etc.
Trotzdem hat mir diese Woche gezeigt: Es geht auch ohne. Wenn ich will, kann ich auf mein Smartphone verzichten. Dann hätte ich mehr Zeit, wäre konzentrierter und würde mich mehr mit dem Nichtstun und meinen eigenen Gedanken beschäftigen.
23.59 Uhr: Okay – ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich daran denke, mein Handy wieder einzuschalten. Meine Hände zittern und meine Herzfrequenz ist erhöht. Wer hat mir geschrieben? Welche Bilder wurden geliked? Welche Trends hab ich verpasst? Ist neue Musik rausgekommen? Gibt es eine neue Challenge im World Wide Web? Und ehe ich mich versehe, bin ich wieder von meinem festem Freund, dem Smartphone verführt worden …
Photo von Марьян Блан auf Unsplash
Banner: Julia Schlichtkrull
Seite 6 von 6« Erste«23456