von moritz.magazin | 22.03.2014
 Sex and the City, Feuchtgebiete, Shades of Grey – man wird nur so überschüttet mit Geschichten über die schönste Nebensache der Welt. Sex sells – das gilt besonders für die Medien. Doch sprechen die Menschen wirklich so offen über ihr Intimleben, wie es in Serien oder Reportagen dargestellt wird? Oder ist das Thema Sex gerade deshalb so interessant und populär, weil es in der Gesellschaft immer noch Tabus gibt?
Sex and the City, Feuchtgebiete, Shades of Grey – man wird nur so überschüttet mit Geschichten über die schönste Nebensache der Welt. Sex sells – das gilt besonders für die Medien. Doch sprechen die Menschen wirklich so offen über ihr Intimleben, wie es in Serien oder Reportagen dargestellt wird? Oder ist das Thema Sex gerade deshalb so interessant und populär, weil es in der Gesellschaft immer noch Tabus gibt?
Sex ist omnipräsent – selbst wenn man ihn nicht hat oder auch noch nie hatte, wie schätzungsweise zwei Millionen Deutsche. In dem Buch „Und wer küsst mich?“ von Maja Roedenbeck geht es um Menschen, die noch nie Sex hatten – nicht, weil sie alle keine Lust hätten, sondern weil der erste Schritt manchmal zu schwer ist und mit der Zeit auch nicht leichter wird. Knapp 2 000 aktive „Absolute Beginners“, wie sie sich selbst nennen, versuchen mithilfe eines gemeinsamen Online-Forums Gleichgesinnte zu finden und sich auszutauschen. Die Angst, nicht mitreden zu können, nicht normal zu sein – ausgegrenzt zu werden, kann belastend sein. Wer mit über 30 noch keinen Sex gehabt hat, wird wahrscheinlich gerade durch die Freizügigkeit im deutschen Fernsehen eher unter Druck gesetzt als aufgeklärt.
Aber auch auf der anderen Seite gibt es Scham und Druck: Rund 65 Prozent aller Männer und 56 Prozent aller Frauen haben auf die Frage, ob ihre sexuellen Wünsche in ihrer Partnerschaft erfüllt werden, mit „Nein“ geantwortet. Ein ziemlich frustrierendes Ergebnis.
Unerfüllte Wünsche kennt auch Miss Decadoria – von ihren Kunden. Die junge Frau ist seit einigen Jahren in Berlin unter diesem Namen als Domina tätig und versucht, die erotischen Fantasien ihrer ausschließlich männlichen Kundschaft zu erfüllen – Fantasien, die die Männer in einer Beziehung nicht ausleben könnten, da sie Angst vor der Reak-tion ihres Partners haben. Sie kennen zwar ihre Neigungen, verschweigen diese aber lieber, weil sie befürchten, als abnormal zu gelten und die Beziehung dadurch zu gefährden. „Ich finde das allerdings sehr bedenklich, die Frau versucht dann ihrem Mann ein erfülltes Sexualleben zu bieten und sie kann im Normalfall natürlich nichts von den geheimen Fantasien wissen“, wendet Miss Decadoria ein, „Das ist für beide Seiten sehr schade, die Frau erhält nicht mal die Möglichkeit, die Fantasien zu befriedigen und der Mann erzeugt dann selbst ein geheimes sexuelles Doppelleben.“
Insbesondere betrifft das natürlich Menschen, die einen ungewöhnlichen Geschmack haben, der deshalb auch nicht in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Vibratoren, Gleitgel, Handschellen – das sind Gegenstände, die man gut und gerne in der Schublade haben darf. Immerhin nutzen laut der „Durex Global Sex Survey 2012“ ein Drittel aller deutschen Paare Dildos oder andere Sexspielzeuge. Anders sieht das jedoch bei Fetischen aus, die in der Gesellschaft nicht als massentauglich gelten. Doch wer bestimmt, welche Vorlieben legitim sind und welche nicht?
Windeln als Sex-Accessoire
„Mir macht es Spaß, Menschen zu treffen, die anders ticken und mir ‚quasi‘ ihre Abgründe offenlegen. Außergewöhnliche Fantasien und Ideen sind auch immer eine Herausforderung und diese liebe ich! Es ist so, dass bei vielen Fetischen Gegenstände oder Körperteile aus ihrem normalen Kontext gerissen werden. Je extremer das ausfällt, desto mehr wird ein Fetisch tabuisiert.“ Beispielsweise werden Windeln im Normalfall mit Babys assoziiert; ein Fetischist würde jedoch durch das Tragen von Windeln sexuell erregt, was für die Außenstehenden auf den ersten Blick seltsam erscheint. Ein Grund für viele, ihre intimsten Wünsche und Gedanken vor dem Partner zu verschweigen, weil sie Angst haben, als Perverser abgestempelt zu werden. Bereits jedes dritte Pärchen hatte laut einer Umfrage der Zeitschrift „Elle“ wegen unterschiedlicher Bedürfnisse Streit. Theoretisch könnte man also einwerfen, dass so etwas wie Windeln tragen oder Toilettenerziehung wie Miss Decadoria sie anbietet, so spezielle und „anormale“ Wünsche sind, dass man sie dem Partner zuliebe verschweigen sollte. Wenn aber in jeder zweiten Beziehung sexuelle Fantasien verschwiegen werden, ist das dann „normal“?
Da stellt sich die Frage, ob Sex überhaupt ein Thema in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit sein muss, sodass Vorstellungen und Wünsche erst „normiert“ werden können? Schließlich ist Sex ein intimer Austausch zwischen zwei Menschen und kein Volksereignis. Wie er abläuft, sollte eigentlich jedem selber überlassen und nicht durch die Medien kommentiert und bewertet werden. Doch dass das nicht der Fall ist, erkennt man, wenn man sich den Fall des ehemaligen Wetterexperten ins Gedächtnis ruft. Fast täglich wurden neue Details seines Liebeslebens in der medialen Öffentlichkeit debattiert – unabhängig vom Prozessverlauf. Eine pikante Information – eine riesige Schlagzeile. Mit Sex wird Quote gemacht. Während in Russland ein Verbot der „Werbung“ für Sex unter Jugendlichen und der „nicht-traditionellen“ Beziehungen beschlossen wurde und damit weiter zu Tabuisierung beigetragen wird und Homosexualität im deutschen Fußball scheinbar noch immer verheimlicht werden muss, kann zumindest in den deutschen Medien von Tabus keine Rede sein. Gummipuppen, Fesselspiele, Swinger-Clubs – je ausgefallener, desto besser. In Reportagen wird über ungewöhnliche Berufe im Erotikbereich berichtet; Pornodarsteller in Aktion, Bordellbesitzer oder SM-Liebhaber – nach elf Uhr fällt jede Tabugrenze. Serien wie „Sex and the City“ handeln von Problemen rund um die schönste Nebensache der Welt und Bücher á la „Shades of Grey“ erreichen Bestseller-Status. Aber kann man deshalb auch von einer offenen und toleranten Gesellschaft sprechen? Jemand, der mit über 30 noch keinen Sex gehabt hat, bestimmte Fetische besitzt oder eine ungewöhnliche Berufswahl getroffen hat, wird zwar in den Medien thematisiert – wenn man aber seinen Chef im Swinger-Club trifft, kann es mit der Offenheit schon wieder ganz anders aussehen. Auch Miss Decadoria weiß, dass die Wahl ihres Berufs ein „beliebtes Tratsch-und Lästerthema“ im größeren Bekanntenkreis ist. Von ihren Freunden und ihrer Familie jedoch gab es jedoch statt Skepsis eher ein paar neugierige oder ungläubige Blicke – „gerade wenn es ins Detail einiger Tätigkeiten geht“, erzählt sie.
Sex sells – Sexspielzeug als Life-Style-Produkte
Für Frau Werth gehören pinke Vibratoren, Pornos oder nach Schokolade schmeckendes Gleitgel zum Alltag – schließlich ist sie Besitzerin des Beate-Uhse-Laden in der Innenstadt Greifswald. Am meisten Spaß machen ihr die Kundengespräche und die Beratung. Allerdings scheinen die Greifswalder nicht besonders kaufkräftige Kunden zu sein – während es vor mehreren Jahren noch drei Sex-Shops gab, findet man in den Gelben Seiten nun nur noch einen – wobei man vermuten kann, dass viele Interessierte lieber online und anonym bestellen. Schließlich gibt es im Internet ein großes Angebot an qualitativ hochwertigen Waren. Egal ob Massageöle, Liebeskugeln, erotische Dessous, Spielzeuge für Männer, Handschellen oder Lederpeitschen – im Internet findet man alles, was das Herz begehrt. Zu größten Herstellern zählt das deutsche Unternehmen Fun Factory. Sexspielzeuge gelten mittlerweile als Life-Style-Produkte und die Industrie versucht alles, um ihren Kunden den Kauf so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Denn Sexspielzeuge mal ins Liebesleben einzubeziehen, wünschen sich laut dem FirstAffair.de-Sexreport 25,5 Prozent der Deutschen. Deshalb bieten Unternehmen mittlerweile sogenannte „Dildo-Partys“ an, die speziell an Frauen gerichtet sind. Wie bei einer „Tupper-Party“ kommt ein Vertreter, in diesem Fall eine „Dildo-Fee“ nach Hause, die in entspannter Atmosphäre verschiedene Produkte vorstellt. Denn mit Freundinnen bei einem Gläschen Sekt lässt es sich gleich viel besser shoppen. Für manche kein Problem, andere finden dies schon wieder zu freizügig.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?
Auch Miss Decadoria hängt ihre Wünsche und Vorstellungen nicht an die große Glocke: „Ich finde das ist eine Frage der Notwendigkeit. Muss ich meiner Familie oder meinen Kollegen wirklich mitteilen, wo meine persönlichen Vorlieben liegen, besonders wenn man dann negative Reaktionen zu erwarten hat? Ich finde, dass man da im Zweifelsfall lieber seine Privatsphäre wahren sollte.“ Lediglich vor seinem Freund oder seiner Freundin wäre Schweigen und Scham fehl am Platz. Dennoch haben in Beziehungen knapp 70 Prozent Hemmungen, mit ihrem Partner über Sex zu reden, wie eine Umfrage der „Elle“ ergab. Auch von Miss Decadorias Kunden gehen die wenigsten wirklich offen mit ihren Neigungen um. Ein Kunde habe sein Gesicht sogar schon mit einer schwarzen Maske verdeckt, bevor er zum gemeinsamen Treffpunkt kam, um von niemandem erkannt zu werden.
Frustrierend ist dies auch für denjenigen, der die Wünsche umsetzen soll, wenn er nicht wirklich weiß, was sich der andere wünscht – oder nicht einmal weiß, dass der andere sich etwas wünscht. „Ich kann niemanden in den Kopf schauen“, erklärt Miss Decadoria, „manchmal scheinen das einige nicht ganz zu verstehen und erwarten quasi ein Wunder von mir. Das ist so, als würde ich zum Friseur gehen und sagen „Schneide mir die Haare“ und dann erwarten, dass mein Wunschhaarschnitt dabei rum kommt.“
Sex gehört zu den intimsten Kommunikationsformen zwischen zwei Menschen. Auf der einen Seite kann das ständige Reden darüber dem Sex die Romantik und den Zauber nehmen, auf der anderen Seite kann man sich fragen, inwieweit Zauber und Romantik zwischen zwei Menschen existieren, die sich nicht trauen, dem Liebsten oder der Liebsten zu sagen, was sie wirklich wollen.
Scham und Lust – zwei Gefühle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, die aber durch erotische Fantasien miteinander verbunden sein können. Möglicherweise sind manche Wünsche in der Fantasie auch besser aufgehoben, doch das sollte jeder für sich selbst entscheiden und nicht von der Gesellschaft abhängig machen.
Sabrina v. Oehsen schrieb diesen Artikel und zeichnetete das Bild.
von moritz.magazin | 22.03.2014
 Seit gut einem Jahr ist Professor Johanna Eleonore Weber im Amt als Rektorin der Universität Greifswald. moritz sprach mit ihr über das vergangene Jahr, die anstehenden Projekte und die nächsten Schritte im Umgang mit dem Haushaltsdefizit.
Seit gut einem Jahr ist Professor Johanna Eleonore Weber im Amt als Rektorin der Universität Greifswald. moritz sprach mit ihr über das vergangene Jahr, die anstehenden Projekte und die nächsten Schritte im Umgang mit dem Haushaltsdefizit.
Wie ist Ihnen das letzte Jahr als Rektorin der Universität Greifswald vorgekommen?
Ich kann es kaum glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist. Die Zeit ist schnell verflogen, weil die Tage so ausgefüllt sind. Auch früher hatte ich volle Tage, aber nun sind viele unterschiedlichste Aufgaben hinzugekommen, die volle Aufmerksamkeit fordern. Ich hatte erwartet, dass das Rektorat lebhaft und anstrengend werden wird, aber dass die Aufgaben so vielfältig sind, das hat mich positiv überrascht.
Welche Projekte haben Sie, die Sie 2013 nicht verwirklichen konnten, aber 2014 in Angriff nehmen wollen?
Wenn ich erlebe, wie andere Hochschulen bei bestimmten Themen mit gutem Beispiel vorangehen, wünsche ich mir oft, dass wir das auch möglichst schnell in Greifswald umsetzen können. Aber dann wird mir schnell bewusst, dass die Realisierung viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Zum Beispiel sehe ich beim Thema Gleichstellung oder Internationalisierung, was wir alles verbessern könnten, weiß aber, dass Veränderungen vorbereitet und schrittweise umgesetzt werden müssen. Das erfordert eben Geduld und Zeit. Als wir beispielsweise kürzlich die Universität Lund besucht haben, konnten wir erleben, wie strategisch dort im Hinblick auf Internationalisierung gedacht wird und welch hoher Stellenwert eine auf internationale Gäste abgestimmte Willkommenskultur hat. Mein Wunsch ist es, auch für Greifswald mehr internationale Studierende zu gewinnen und internationale Partnerschaften und Forschung voranzubringen.
Wann muss der Hochschulentwicklungsplan fertig sein?
Der Hochschulentwicklungsplan (HEP) muss am 30. Juni 2014 beim Bildungsminister vorliegen. Wir haben mit den Zuarbeiten bereits im Herbst 2013 begonnen, damit der Senat die Möglichkeit hat, über unseren Entwurf ohne Zeitdruck zu diskutieren und abstimmen zu können. Wir besprechen derzeit einen ersten Entwurf des Hochschulentwicklungsplans in der Rektoratsberatung und in der Dienstberatung. Ab März beziehungsweise April wird der Senat in mehrmaliger Lesung den HEP diskutieren und abschließend darüber abstimmen.
Was sind die neuen Ziele in dem Hochschulentwicklungsplan?
Das ist ein Prozess, der gemeinsam von den beteiligten Gremien der Universität getragen werden soll. Wir gehen mit einem Entwurf in die Diskussion. Da diese Diskussion erst begonnen hat, möchte ich einzelne Vorschläge noch nicht erläutern.
Denken Sie über einen Forschungsschwerpunktwechsel nach?
In der Januarsitzung des Senats wurde darüber schon spekuliert, ob wir eine Änderung in den Forschungsschwerpunkten vornehmen möchten. Unser generelles Bestreben muss es sein, dass der Hochschulentwicklungsplan Änderungen abbildet, die in unserer Forschung erfolgt sind. Dort, wo sich neue Schwerpunkte gebildet haben, wo erfolgreiche Forschung betrieben wird, die auch attraktive Lehre nach sich zieht und Studierende anlockt, tun wir gut daran, solche Entwicklungen im Hochschulentwicklungsplan aufzugreifen.
Wie hat sich die Gleichstellung im letzten Jahr entwickelt?
Auf der einen Seite sehe ich die Entwicklung sehr positiv. Wir diskutieren viel häufiger und offener über Gleichstellungsfragen. Wir haben durch unsere Mentoring-Programme sehr gute Angebote für die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen etablieren können. Aber wir sehen auch, dass Gleichstellung Hand in Hand mit einer ausgeprägten Familienfreundlichkeit gehen muss. Die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Eltern sind, müssen stärker darin unterstützt werden, Beruf und Familie miteinander verbinden zu können. In der Hinsicht ist schon sehr viel geschehen. Nach wie vor dramatisch gering ist die Anzahl der Hochschullehrerinnen an der Universität, mit Ausnahme der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Der Anteil an Frauen ist jedoch nur langsam zu steigern, da wir in jedem Jahr nur eine geringe Anzahl von Professuren neu besetzen können. Und zudem sind wir nicht die einzigen, die sich um Wissenschaftlerinnen bemühen. Wir befinden uns gerade in einem fröhlichen Wettkampf um Frauen. Da Hochschulen mit höheren Frauenanteilen auch höhere Förderungschancen haben, sind diese strategisch besser organisiert. Wir müssen aktiv werden, indem wir Frauen gezielt ansprechen, beispielsweise über entsprechende Netzwerke und Fachgesellschaften. Was mich erschüttert hat, ist der geringe Anteil an Frauen in der Gruppe der Hochschullehrer/innen in den neu gewählten Fakultätsräten: In drei Fakultäten, der Theologischen und der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät sowie in der Universitätsmedizin gibt es keine einzige Professorin in den Fakultätsräten, in der Philosophischen Fakultät eine und in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zwei. Welches Bild vermitteln wir damit nach außen?
„Wir befinden uns gerade in einem fröhlichen Wettkampf um Frauen.“
Was wird als nächstes beim Haushaltsdefizit unternommen?
In diesem Jahr steht uns eine Prüfung durch den Landesrechnungshof bevor. Das ist das Ergebnis im Streit mit dem Minister, der bezweifelt hatte, dass die von uns angegebenen Daten korrekt sind. Nun sollen die beiden Universitäten Rostock und Greifswald vom Landesrechnungshof geprüft werden. Der Landesrechnungshof wird demnächst an die Arbeit gehen. Wir sind überzeugt, dass wir richtig rechnen, und gehen davon aus, dass die Ergebnisse Grundlage für künftige Verhandlungen sind. Ideal wäre es, wenn wir – korrekte Zahlen vorausgesetzt – für die von uns genannten Bedarfe auch entsprechend mehr Geld erhalten würden.
Wann rechnen Sie mit einem Ergebnis?
Das weiß im Moment niemand. Wir hoffen, dass das Ergebnis so schnell wie möglich kommt.
Glauben Sie daran, dass weitere finanzielle Mittel fließen, wenn das Ergebnis des Landesrechnungshofs positiv ist?
Ich würde mich sehr freuen, wenn es so kommen würde. Es wäre die logische Konsequenz einer Prüfung. Die Frage ist dann nur, ob und wie die zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden. Der Doppelhaushalt 2014/15 wurde ja im vergangenen Dezember verabschiedet; weitere Mittel müssten dann in irgendeiner Form den Universitäten zur Verfügung gestellt werden.
Was wären denn die nächsten Schritte, wenn keine weiteren finanziellen Mittel vom Land kämen?
Zunächst haben wir jetzt alle Rückstellungen, die wir noch hatten, unter anderem auch die Mittel für die Sanierung der alten Physik, in den laufenden Haushalt eingespeist. Das heißt, wir haben dadurch in diesem Jahr ein bisschen Luft bekommen, die Personalstellen einigermaßen ausfinanzieren zu können. Ohne die Rückstellungen hätten wir auslaufende Stellen nicht verlängern können; das hätte nach dem Gießkannenprinzip Stellen getroffen, die gerade frei werden. Aber ab dem kommenden Jahr wird es wirklich eng! Dann hilft nur die Hoffnung auf zusätzliche Mittel und den neuen Doppelhaushalt mit den entsprechenden Zuwächsen für die Hochschulen. Also wir retten uns jetzt sozusagen über die nächsten beiden Jahre mit allem, was wir noch haben, und dann wissen wir selbst nicht weiter, wenn keine Unterstützung kommt.
„Das Rektorat verfügt nicht über Professoren. “
Trotzdem bangt das Casper-David-Friedrich-Institut um die Schließung, da eine Professorenstelle nicht besetzt werden soll.
Die Stelle ist nicht aktuell gestrichen worden. Es gibt einen früheren Beschluss der Fakultät, die Anzahl der Stellen von drei auf zwei Professuren zurückzuführen. Die Frage ist, wann diese Rückführung von drei auf zwei erfolgt, bereits jetzt im Hinblick auf die Nachfolge von Professor Puritz oder später nach Ende der befristeten Professur von Professor Müller. Die Studiengänge sind nicht bedroht. Es ist Aufgabe der Fakultät, dafür zu sorgen, dass das in der Studienordnung vorgesehene Lehrangebot erhalten bleibt, und sei es durch Vertretungen.
Auf der institutsinteren Vollversammlung der Studierenden war Dekan Wöll dabei und meinte, dass man beim Rektorat beantragen will, dass eine neue Stelle geschaffen werden soll.
Wir können keine zusätzliche Professur außerhalb des Stellenplans der Universität schaffen. Die Fakultät muss ihre Professuren im Rahmen ihres Stellenplans verteilen. Das Rektorat verfügt nicht über Professuren.
Die Zahl der Studierenden an der Universität hat sich in den letzten zwei Jahren verringert. Was wollen Sie dagegen unternehmen?
Wir sehen den Rückgang natürlich mit Sorge. Auf der einen Seite folgen wir darin dem Bundestrend: Der vorübergehende große Andrang durch doppelte Abiturjahrgänge und Wegfall der Wehrpflicht geht zurück, auch bundesweit. Dennoch müssen wir uns die Frage stellen: In welchen Studienfächern ist der Rückgang besonders stark? Für welche Fächer müssen wir gezielt mehr Studierende gewinnen? Wir haben einige Fächer mit einer unterdurchschnittlichen Auslastung, für die besondere Anstrengungen nötig sind. Das betrifft eine Reihe von Fächern in der philosophischen Fakultät, aber auch die Physik. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir diese Fächer attraktiver machen und sie noch gezielter bewerben können.
Was, glauben Sie, sind die Ursachen für den Rückgang?
Ich weiß es nicht. Wir müssen nach den Ursachen forschen, alles andere ist Spekulation. Leider können wir diejenigen, die NICHT nach Greifswald kommen, nicht nach ihren Gründen fragen, denn genau diese kritische Gruppe kennen und erreichen wir nicht. Wir können uns nur indirekt darum bemühen, an solche Informationen zu kommen, indem wir zum Beispiel mit Hilfe der Qualitätssicherung unsere Erstsemester befragen, was sie bewogen hat, nach Greifswald zu kommen – und was in ihren Überlegungen auch gegen Greifswald gesprochen hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir Universitäten mit vergleichbaren Studiengängen anschauen, ob dort die Studierendenzahlen auch zurückgehen. Dann erfahren wir, ob der Rückgang für Greifswald spezifisch ist oder ein Fach allgemein an Attraktivität verloren hat. Und das ist eine wichtige Information, denn dann können wir fragen, was unseren Studiengang von dem in anderen Universitäten unterscheidet. Solche Analysen sind der Schlüssel zu den nötigen Änderungen, durch die Studiengänge wieder an Attraktivität gewinnen.
Das Interview führten Angela Engelnhardt, Anne Sammler und Simon Voigt. Simon Voigt schoß auch das Bild.
von moritz.magazin | 17.01.2014
Die Kerzen sind erloschen und der Baum liegt schon auf der Straße. Der Hund vergräbt die letzten Knochen der Weihnachtsgans im Garten und der Weihnachtsmann ist längst an den Nordpol zurückgekehrt. Eine Enthüllungsgeschichte.
Von: Lisa Klauke-Kerstan
 Jährlich fordert uns ein schwedisches Möbelhaus dazu auf, unsere Weihnachtsbäume aus dem Fenster zu werfen und Platz für Neues zu schaffen. Doch bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das nadelnde Bäumchen wieder loswerden, sollten wir erst einmal wissen, warum es während der Weihnachtszeit bunt geschmückt unsere Geschenke beherbergt.
Jährlich fordert uns ein schwedisches Möbelhaus dazu auf, unsere Weihnachtsbäume aus dem Fenster zu werfen und Platz für Neues zu schaffen. Doch bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das nadelnde Bäumchen wieder loswerden, sollten wir erst einmal wissen, warum es während der Weihnachtszeit bunt geschmückt unsere Geschenke beherbergt.
Der Brauch, seine Haustür während der kalten Jahreszeit mit grünen Zweigen zu schmücken, ist uralt. Einen ganzen Baum ins Haus zu schleppen hingegen recht neu. Zur Zeit der Römer und im Mittelalter sollten Äste immergrüner Pflanzen Schutz bieten und die Geister vertreiben. Das Großbürgertum und der Adel setzten dem Ganzen dann die Krone auf, indem sie, dekadent wie sie waren, gleich den gesamten Baum fällten und prunkvoll geschmückt in die heimische Stube stellten. Nach und nach konnte sich auch der Pöbel ein Bäumchen leisten und so kam es, dass heute fast weltweit alle westlichen Kulturen mit einer Tanne die Feiertage begehen. Heute gilt das Grün aber nicht mehr als Zeichen des Lebens, wie es in den heidnischen Traditionen Brauch war, sondern steht für Frieden, Familiensinn und Innigkeit. Eine christliche Erklärung für die Tradition der Tanne gibt es übrigens auch noch. Sie soll bei Krippenspielen als Ersatz für den Paradiesbaum aus dem Alten Testament gedient haben. Doch wer´s glaubt, wird selig.
Oh, Tannenbaum
So, nun zu der Geschichte mit dem Baby. Klar, Jesus wurde irgendwann geboren und Krippenspiele bezeugen diese Begebenheit jedes Jahr aufs Neue. Fest steht allerdings, dass wirklich niemand weiß, ob der Sohn Gottes tatsächlich am 25. Dezember das Licht der Welt erblickte. Höchstens die gute Maria hätte wohl einen Tipp parat. Gefeiert wird am 25., weil ein wichtiger Mann das im Jahr 354 so wollte. Er beschloss, dass an diesem Tag nicht mehr römische Kaiser, sondern Christus verehrt werden sollte. Natürlich gibt es auch zahlreiche Hinweise darauf, dass der kleine Knabe tatsächlich an diesem Tag im Stroh geboren wurde, doch Beweise gibt es keine. In Deutschland und anderen Ländern sitzt man allerdings schon eine Nacht vorher unterm Weihnachtsbaum, da viele Feste im römischen Reich bereits mit einer Nachtwache begannen. Praktischerweise fiel das Ganze auch noch in die germanische Tradition der zwölf heiligen Nächte der Sonnenwende und so war das Datum besiegelt. Die „ze wihen nahten“ sind übrigens auch für den Namen des Festes der Besinnlichkeit verantwortlich.
Denkt man an die schönen Stunden im Kreise der Familie bei Kerzenschein zurück, kommt einem automatisch auch ein gern gesehener Gast dieser Tage in den Sinn. Die gesuchte Person ist ein lieber, leicht dicklicher alter Mann. Er trägt meistens einen roten Anzug, der mit weißem Pelz besetzt ist. Nicht zu vergessen sein markantestes Merkmal: der Rauschebart. Auf einem Schlitten kommt er durch die Luft gefahren und ein ziemlich erkältet scheinendes Rentier leuchtet ihm den Weg. Die Rede ist natürlich vom Weihnachtsmann. Der Volksmund sagt, er habe sein Aussehen von der bösen und kapitalistischen Coca-Cola-Company übergestülpt bekommen, doch das stimmt nur zur Hälfte. Denn die ersten Beschreibungen des heutigen Stereotyps finden sich bereits in dem Gedicht „A visit from St.Nicholas“ von Clement Moore aus dem Jahr 1822. Erst seit 1931 wirbt der Getränkehersteller mit dem klassischen Weihnachtsmann. Doch die Geheimzutat für den Postboten der ganz besonderen Art kam tatsächlich aus dem Christentum.
Zunächst wurde nämlich der Heilige Nikolaus von Myra an seinem Namenstag, dem 6. Dezember, gefeiert. Er gilt als Schutzpatron der Kinder und bringt noch heute Süßigkeiten. Doch Martin Luther wollte, dass sich im Dezember alle Gläubigen auf die Geburt Christi konzentrieren. Also mussten die Geschenke passend zum 25. vom Weihnachtsmann geliefert werden. Seit 1535 ist das so und wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Je nach Region kommen statt dem Weihnachtsmann immer noch der Nikolaus oder eben ganz klassisch das Christkind. Doch egal, wer da mit rot gefrorenem Näschen vor der Türe steht, artig muss man immer sein, um mit Äpfeln und Nüssen belohnt zu werden.
Aufgrund der Verschiebung der Bescherung dehnte sich natürlich auch die Wartezeit für die Kinder aus. Es musste also etwas her, dass die Wochen vor der großen Bescherung versüßt – der Adventskalender. Ob als Postkarte, selbstgebastelt, riesig groß oder kunterbunt, 24 Türchen muss er haben und mit Überraschungen, die die Vorfreude jeden Tag bis zum Heiligen Abend erhöhen, gefüllt sein. 1908 wurde der erste Kalender dieser Art von einem Buchhändler gedruckt, damals noch ganz ohne Süßigkeiten. Vor dieser Erfindung wurden aber bereits selbstgebastelte Uhren oder zunächst leere Krippen, die Tag für Tag gefüllt wurden, genutzt um die Weihnachtszeit zu strukturieren und den Kindern das Warten zu erleichtern.
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt

Für die Erwachsenen gibt es eine ganz ähnliche Tradition. Adventskränze sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Einen mit vier Kerzen erleuchteten Kranz verzeichnet die Geschichte zum ersten Mal 1839 in Hamburg. Die grünen Zweige waren zunächst nur ein Beiwerk und schmückten den Raum, in dem der Kranz stand. Erst 1860 wurden dann Tannen- oder Fichtenreisig direkt am Adventskranz festgezurrt. Die runde Form dient als Symbol für den Erdkreis. Die grünen Zweige sollen, ähnlich wie der Weihnachtsbaum, Leben und Hoffnung darstellen. Das Licht, das mit jeder Kerze entfacht wird, soll die Angst vertreiben. Die leuchtenden Flammen sind auch ein Symbol für Jesus Christus, das Licht der Welt.
Zum traditionellen Weihnachtsfest gehört neben den schönen Geschenken und Bräuchen auch das gute Essen. Jährlich ergeben Umfragen, dass jeder Dritte Deutsche den Heiligen Abend mit Kartoffelsalat und Würstchen feiert, doch auch Gans oder Karpfen erfreuen den Magen. Das liegt daran, dass am 11. November zum Martinstag die kirchliche Fastenzeit beginnt und erst wieder am 25. Dezember endet. Also isst man vorher und nachher noch schnell eine Gans. Am letzten Fastentag, dem Heiligen Abend, ist also noch kein Fleisch erlaubt, deswegen muss der Karpfen aus dem Gartenteich dran glauben. Warum eine Gans und kein anderes Federvieh oder gar ein Vierbeiner auf dem Teller liegt, rührt allerdings aus einem weltlichen Umstand her. Der gute St. Martin war nämlich Lehnsherr und verlangte von seinen Vasallen zu Beginn der Fastenzeit einen Vogel als Lehnspflicht. Die Tradition der Weihnachtsgans verbreitete sich schlussendlich durch die Industrialisierung, die der gesamten Bevölkerung zu einer Steigerung des Wohlstands verhalf. Also hat doch der böse Kapitalismus gesiegt.
Neben dem ganzen Kaufen, Essen und Laufen soll ja eigentlich die Liebe oder zumindest die Nächstenliebe während der Feiertage im Vordergrund stehen. Da das so mancher aber vergisst, während er sich selbst mit Klebeband fast selbst stranguliert oder wochenlang das Internet nach Geschenken durchforstet, gibt es ja noch den Brauch des Mistelzweiges. Dieser zwingt Menschen kurz inne zu halten und in einem ruhigen oder auch peinlichen Moment einen Kuss auszutauschen. Als Pausenknopf war der Ast am Türrahmen aber nicht immer gedacht. Eine nordische Göttersage hat das ewige Geknutsche zu verantworten. Denn die Liebesgöttin Frigga verlor durch tragische Umstände ihren Sohn, der durch einen Mistelzweigpfeil erschossen wurde. Die Menschen machten fortan unter dem bösen Bäumchen, von dem der tödliche Ast stammte, Halt, um durch einen Kuss die gebrochene Liebe zwischen Mutter und Sohn zu würdigen und das Höchste der Gefühle zu feiern. Auch hiermit hat das Baby in der Krippe also wenig zu tun.
Nun ist es ja fast noch ein ganzes Jahr bis das nächste Mal Weihnachten vor der Tür steht. Doch keine Angst, spätestens wenn wieder „Last Christmas“ von Wham! aus dem Radio schallt, weiß jeder: es weihnachtet sehr.
Hohl wie ein Schokoweihnachtsmann
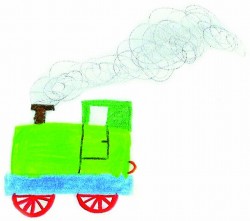 Ein Kommentar von Anton Walsch
Ein Kommentar von Anton Walsch
Neulich kam mir eine wohl zeitgenössische Weihnachtsbotschaft zu Ohren: Wenn wir alle so lieb und großzügig wie der Weihnachtsmann werden, wird die Welt ein Stück besser und friedlicher. Das klingt plausibel, aber ist es das, was wir am 25. Dezember feiern? Nein. Als Christ feiere ich zu Weihnachten die Geburt – nicht den Geburtstag – Jesu Christi. Gott wird selbst Mensch, begibt sich mit uns auf Augenhöhe. Gott schenkt uns seinen Sohn, den Messias. Wenn das nicht ein Grund zur Freude ist! Und es ist auch ein guter Grund, anderen eine Freude zu machen.
Für einen großen Teil der Bevölkerung spielt der christliche Glaube allerdings keine Rolle mehr. Das Weihnachtsfest wollen sie trotzdem nicht missen. Viele werden dann zu Weihnachtschristen, besuchen das einzige Mal im Jahr einen Gottesdienst – immerhin, könnte man meinen. Für alle anderen müssen Ersatzgründe her, ganz egal, ob sie um den Ursprung wissen oder nicht. Weihnachten wird nun der Familie, der Liebe und den Geschenken gewidmet. Beim übernatürlichen Weihnachtsmann drücken dann auch Alltagspositivisten mal ein Auge zu.
Wenn nun aber statt Gottes Sich-Selbst-Schenken das eigene Geschenk im Mittelpunkt steht, will man nicht kleinlich sein und greift großzügig in die Tasche. Der Einzelhandel empfängt mit offenen Armen. Im Gewand der Großzügigkeit lädt er zu vier Wochen Kaufrausch ein. Und weil es scheinbar auch um Familie, Freunde und Gemütlichkeit geht, folgt eine Weihnachtsfeier der nächsten.
So geht es durch den Advent, der eigentlich die Vorbereitungszeit ist. Die Traditionen verkommen zur Hülle. Besinnlichkeit weicht dem Einkaufsstress, das Christkind in der ärmlichen Grippe dem Weihnachtsmann. Dazu laufen säkularisierte Weihnachtsschlager á la „Last Christmas“ und die Kauflaune bestimmt die Nachrichten. Diese Entfremdung tut mir schon manchmal in der Seele weh. Keine Frage: Schenken und Feiern gehören auch für mich zu Weihnachten, der eigentliche Inhalt ist es aber nicht. Und dennoch möchte ich niemandem das Weihnachtsfest vergönnen. Freude ist angebracht. Dann feiert eben den Weihnachtsmann, den Binnenkonsum, euch selbst.
Christmas is Everywhere – Ein Plädoyer
Ein Kommentar von Fabienne Stemmer
Das Fest, auf das wir als Kinder monatelang hingefiebert haben, ist schon wieder vorbei. Doch dabei sind wir bestens gerüstet für das neue Jahr, mit fünf Kilo mehr auf den Hüften und unzähligen Geschenken.
Genauso wie das heilige Fest jedes Jahr gefeiert wird, finden jedes Jahr aufs Neue ausgedehnte Diskussionen statt: Dürfen Menschen mitfeiern, die nicht an das Christentum glauben? Aus Perspektive einer streng gläubigen Familie ist diese Frage vermutlich leicht zu beantworten: Nein! Die Begründung ist plausibel: An den Weihnachtsfeiertagen wird die Geburt Jesu Christi zelebriert, ein christlicher Brauch, mit dem Nicht-Gläubige ursprünglich nichts zu tun hatten.
Die Betonung liegt hierbei auf ursprünglich. Seien wir doch mal ehrlich, im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier steht für den Großteil der deutschen Bevölkerung längst nicht mehr der religiöse Gedanke. Vielmehr geht es uns um das familiäre Zusammensein, das endlose Essen und vor allem das Schenken.
Exemplarisch lässt sich diese Entwicklung in der Kommerzbranche wiederfinden. Ginge es tatsächlich für die meisten um das Andenken an Christi Geburt, dann hätte sich die uralte religiöse Tradition wohl nicht so leicht in einen einzigen Akt der Kommerzialisierung verwandelt. Den Brauch des Schenkens macht sich vor allem die Werbebranche zu Nutzen. Coca-Cola suggeriert ab November in der Werbung „Santa Claus is coming to town“. Jedes Jahr, immer und immer wieder. Seit einigen Jahren macht auch das Online-Shoppingportal Zalando Weihnachtswerbung, indem der Paketbote zum Zalando-Santa mutiert.
Und es funktioniert. Die Menschen verenden in einem heillosen Kaufwahn und schenken, schenken, schenken. Dazu noch jede Menge schallende Weihnachtsmusik aus dem Radio, der Duft von frisch gebackenen Plätzchen und köstlichem Essen, eventuell ein Gang zur Christmesse – das ist dann Weihnachten. Es ist dennoch falsch, das Weihnachtsfest auf Essen, Geschenke und Coca-Colas Santa Claus zu reduzieren. Ein wichtiger Aspekt ist nämlich noch erhalten geblieben: Weihnachten als das Fest der Liebe. Das Fest der Nächstenliebe, um genau zu sein. Jeder Christ sollte um die Wichtigkeit des Zweiten Gebotes wissen und aufgrund seiner religiösen Überzeugungen die Menschen in seinem Umfeld, trotz ihres abweichenden Verhaltens, ihres fehlenden Glaubens „lieben“ und wertschätzen. Warum also den anderen, auch wenn sie nur einmal im Jahr, und zwar an Heiligabend, die Kirche betreten, nicht dieses Zusammensein in der Familie gönnen?
Gerade aufgrund des christlichen Wertes der Nächstenliebe, wäre es da nicht schöner, den unreligiösen Nachbarn oder Freunden ein paar selbstgebackene Plätzchen oder ganz traditionell Mandarinen und Nüsse als kleine Gabe der Aufmerksamkeit zu bringen, anstatt sich über ihre „Unchristlichkeit“ zu mokieren?
Wen das nicht überzeugt, sollte den vorangegangen Artikel „Ausgepackt“ noch einmal sorgfältig inspizieren. Daraus geht hervor, dass Weihnachten kein rein christliches Fest ist. Das germanische sowie keltische Fest zur  Wintersonnenwende, auch als Julfest bezeichnet, existierte bereits vor Christi Geburt und weist überraschende Ähnlichkeiten zum heutigen Weihnachtsfest auf: Das große Festmahl in der Familie, die Tradition des Beschenkens genauso wie der besinnliche Gesang und die geschmückten Nadelbaumzweige charakterisierten seit jeher die Festlichkeit. Einige Quellen gehen noch weiter und suggerieren, dass die Kirche selbst im 4. Jahrhundert das germanische Julfest durch das christliche Weihnachtsfest ersetzen lies, um dem Ganzen seinen christlichen Hauch zu verleihen.
Wintersonnenwende, auch als Julfest bezeichnet, existierte bereits vor Christi Geburt und weist überraschende Ähnlichkeiten zum heutigen Weihnachtsfest auf: Das große Festmahl in der Familie, die Tradition des Beschenkens genauso wie der besinnliche Gesang und die geschmückten Nadelbaumzweige charakterisierten seit jeher die Festlichkeit. Einige Quellen gehen noch weiter und suggerieren, dass die Kirche selbst im 4. Jahrhundert das germanische Julfest durch das christliche Weihnachtsfest ersetzen lies, um dem Ganzen seinen christlichen Hauch zu verleihen.
Weihnachten ist folglich alles andere als ein den gläubigen Christen vorbehaltenes Fest. In diesem Sinne ein erfolgreiches Jahr 2014, bis es wieder heißt „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“
Bild: Lisa Klauke-Kerstan & Kim-Aileen Kerstan
von moritz.magazin | 12.12.2013
 Vor über einem Jahr stieß die Landesregierung eine Reform der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern an. Nach den Wünschen von Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) sollte es sogar zum Ende des letzten Jahres eine Entscheidung bezüglich der Umgestaltung geben. Auf diese wartet man aber immer noch.
Vor über einem Jahr stieß die Landesregierung eine Reform der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern an. Nach den Wünschen von Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) sollte es sogar zum Ende des letzten Jahres eine Entscheidung bezüglich der Umgestaltung geben. Auf diese wartet man aber immer noch.
Das halte ich für völlig unrealistisch.“ So reagierte der Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, im November 2012 auf die Pläne der Landesregierung, bis zum Ende des Jahres eine Entscheidung über den Fortbestand der Theater gefällt zu haben. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und in den Verhandlungen hat sich etwas getan.
Das Land möchte die Theater und Orchester zusammenlegen, um Geld einzusparen. Dazu ließ es von einer Managementberatung neun Modelle entwickeln, wie die Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft aussehen könnte (moritz berichtete im Heft 102). Im November einigte man sich auf zwei Modelle, die weiter verfolgt werden sollten: Beim ersten Modell sollen zwei Staatstheater gebildet werden; die Häuser in Schwerin und Rostock sowie Greifswald/Stralsund und Neubrandenburg/Neustrelitz würden miteinander fusionieren. Beim zweiten Modell würden jeweils nur die Musiktheatersparten zusammengelegt. Die kleineren Theater in Anklam, Güstrow, Parchim und Wismar müssen auch einsparen, sind aber von Zusammenschlüssen nicht betroffen. Die beiden Modelle wurden den Trägern der Theater vorgelegt, sodass diese sich entscheiden konnten, ob sie mit den Varianten einverstanden sind, beziehungsweise welche Änderungen sie als wünschenswert erachten.
Rostock stellt sich gegen Fusion mit Schwerin
Die Kunstschaffenden und die Träger der Theater heißen die Modelle aber nicht unbedingt gut. So schwelt seit Anfang des Jahres ein Streit zwischen der Hansestadt Rostock und dem Kultusministerium. Die Rostocker Bürgerschaft, die im März darüber zu entscheiden hatte, stellte sich gegen eine Fusion. Sie suchen nach einer Variante, bei der die Autonomie des Theaters weitestgehend erhalten bleibt. „Wenn es dem Minister nicht gelingt, die wesentlichen Partner eines solchen Projektes an einen Tisch zu bekommen, wie soll das dann erst später laufen? Der Stil des Ministers zerstört die Grundlage für eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit“, sagte Stefan Rosinski, der Chef des Volkstheaters dem Norddeutscher Rundfunk im März diesen Jahres. „Das wird die Rostocker darin bestärken, hier einen eigenen Weg zu gehen.“
In Greifswald wurde im Februar auf einer Bürgerschaftssitzung ein erster Entwurf vorgelegt, der die Vorraussetzungen für eine Neustruktur der Theater im Osten des Landes zum Inhalt hatte. Schon damals schafften es die Vertreter der Theaterträger, an einem Tisch zu sitzen und über ein gemeinsames Grundlagenpapier zu beraten. Allerdings musste dieses durch die Ablehnung durch Rostock an die veränderte Situation im westlichen Teil des Landes angepasst werden. Anfang November wurde nun erneut ein Konzept für die Grundlagen vorgelegt. Wichtig ist, dass bei ausbleibenden Änderungen der Theaterstrukturen im Westen des Landes die Häuser im Osten keine Nachteile davontragen. Nun soll die Managementberatung mit den Trägern und dem Land die Konzepte des Landesorchesters beziehungsweise des Staatstheaters weiterentwickeln, damit später entschieden werden kann, welches Konzept von allen Beteiligten bevorzugt wird.
Nachdem eine Fusion zwischen Schwerin und Rostock nicht mehr verhandelt wird, soll nun ein Staatstheater Mecklenburg aus den Standorten Schwerin und Parchim hervorgehen. Im Juli 2013 gab es erste Gespräche, im August machte das Land das Angebot, zu dem Brodkorb erklärte: „Mit dem vorliegenden Angebot geht das Land weit über sein bisheriges Engagement hinaus. Zum ersten Mal seit 1990 erklärt das Land seine Bereitschaft, in die Trägerschaft von Theatern einzutreten.“ Allerdings sei dies an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das Land sei bereit, in anderen Landesteilen ähnliche Angebote zu machen, jedoch müssen die Theater und Träger den Willen zeigen, ihre Struktur zu reformieren. Dies kritisiert der kulturpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Torsten Koplin, aufs Schärfste: „An den Anfang der Reformbemühungen hatte die Landesregierung einen tatsächlich notwendigen Dialog gestellt. Nunmehr schwingt selbst der Regierungschef alleinig die Finanzkeule als Druckmittel.“ Die Linksfraktion hatte im Frühjahr dieses Jahres ein eigenes Konzept vorgelegt, welches jedoch vom Landtag abgewiesen wurde.
Innerhalb des letzten Jahres gab es bezüglich der Theaterstrukturen viele Debatten, bei denen auch der Ton schon mal etwas schärfer wurde. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. Jetzt müssen erst einmal die Konzepte für den Osten des Landes mit Greifswald/Stralsund und Neustrelitz/Neubrandenburg sowie für Rostock abgewartet werden.
Ein Text von Katrin Haubold mit einer Karikatur von Martin Grimm.
von moritz.magazin | 04.10.2013
Es gibt Wochen, da frisst die Uni einem alle Zeit weg. Seminar, Vorlesung, schnell in die Sprechstunde, noch ein Seminar, dann noch eine Besprechung wegen der anstehenden Gruppenhausarbeit, Jobben gehen und schon ist der Tag vorbei. Freizeit ist in solchen Wochen ein Fremdwort, und die ausgewogene Ernährung versteckt sich meist hinter Bergen aus Nervennahrung. Woher soll man denn noch die Zeit zum Kochen nehmen?!
Zum Glück gibt es auch einige Gerichte, die sich schnell zubereiten lassen. Nein, ich meine nicht Tiefkühlpizza, Fertiggerichte und Nudeln mit Pesto, sondern „frisches“ Essen. Einige Suppen, Bratreis oder eben Nudeln mit Schafskäsesoße. In 15 Minuten fertig und deutlich leckerer als Fertiggerichte oder gar Mensaessen.
Am längsten dauert eigentlich das Kochen der Nudeln. Also zuerst reichlich Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen. In der Zwischenzeit schneidet ihr die Frühlingszwiebeln in Ringe und presst die Zitrone aus. Falls ihr Biozitronen habt, könnt ihr auch noch etwas Schale reiben und zum Saft geben. Zuletzt zerbröselt ihr noch den Schafskäse, fertig sind die Vorbereitungen.
In der Zwischenzeit dürfte das Wasser kochen. Gebt die Nudeln hinein und erhitzt dann eine Pfanne. Sobald die etwas warm ist, kommen ein Schuss Olivenöl und der Schafskäse hinein. Etwas anschmelzen lassen und dann gleich mit der Sahne übergießen. Auf mittlerer Hitze aufkochen lassen. Bevor ihr die Nudeln abgießt, würzt ihr die Soße mit Pfeffer, etwas Muskatnuss und Salz, und gebt den Zitronensaft dazu. Kurz vor dem Servieren noch die Frühlingszwiebeln dazu und fertig. Wenn ihr die Zwiebeln zu früh dazu gebt, werden sie schlaff und recht gräulich, also nicht sehr appetitlich. Schmecken tun sie trotzdem. Sofort servieren und genießen. Falls ihr nicht mehr viel tun müsst für die Uni, gönnt euch noch ein Gläschen Weißwein dazu.
Um vier satt zu kriegen braucht ihr:
2 Packungen Schafskäse/Hirtenkäse
2 Becher Sahne
1 Biozitrone/ein Schuss Zitronensaft
1 Bund Frühlingszwiebeln
500g Nudeln
Etwas Pfeffer, Salz, Olivenöl und Muskatnuss
Ein Rezept von Erik Lohmann, mit Bildern von Milan Salje.

von moritz.magazin | 04.10.2013
 Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.
Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.
„Warum ich mich engagiere? Ich brauchte ein Hobby und eine Tätigkeit, die mich erfüllte. Ich war rastlos und das Studium stresste sehr. Das Radio ist mein Ausgleich“, erklärt Fanny Pagel, die stellvertretende Chefredakteurin des radio 98eins‘ ist. Chefredakteurin Franziska Hain kann diese Aussage nur bestätigen: „Die ganze Arbeit im Sender macht Spaß! Vom Schreiben bis zum Einsprechen – und außerdem trifft man immer nette Leute.“
Laut einer Studie der Hochschul-Informarions-System GmbH, die 4 000 deutsche Studenten befragt haben, engagieren sich rund zwei Drittel in sportlichen, politischen, sozialen oder kulturellen Vereinen – so auch die beiden Radioredakteurinnen. Zu ihren Aufgaben im Radio gehören neben dem Einsprechen von Nachrichten oder dem Schreiben von Artikeln auch das Organisieren von Sendeplänen, die Qualitätssicherung der Sendungen sowie die Verwaltung der Musik. Doch trotz des hohen zeitlichen Aufwandes würden die Geschichtsstudentinnen, die aufgrund der Suche nach einem Praktikum auf radio 98eins gestoßen sind, ihre Arbeit nicht aufgeben wollen.
Kultur macht Spaß
Auch Isabella Metelmann, Clubmeisterin im Rotaract Greifswald, nimmt die Vereinsarbeit nicht als Belastung wahr. Besonders der Gedanke, anderen Menschen helfen zu können, gefällt der Medizin- und Politikwissenschaftsstudentin am Rotaract Greifswald „Egal, ob es sich dabei um Aufräumaktionen im Wald, das Kleidersammeln für die Greifswalder Tafel oder Benefizpartys handelt“, erklärt sie.
Durch genau solch einen Benefizabend ist Isabella vor vier Jahren auf den Verein aufmerksam geworden und war von Anfang an vom Rotaract und seinen motivierten Mitgliedern begeistert. Eine sehr beliebte Form der Spendenparty ist Profs@turntables, das auch in diesem Wintersemester wieder stattfinden wird. Das Besondere an Profs@turntables ist, dass die Dozenten am DJ-Pult sitzen und den Takt vorgeben. Im vergangenen Jahr konnten so insgesamt 4 500 Euro an das Projekt „Polio Plus“ gespendet werden, dieses Jahr soll der Erlös an „Schulbausteine für Gando e.V.“ gehen. Das Projekt wurde von Francis Kéré organisiert, der ein Architekt aus Burkina Faso ist und dort sozial und ökologisch nachhaltige Bildungseinrichtungen baut, erzählt Isabella. „Und es wird mal wieder hochprominent“, verrät die 21-jährige dann noch. „Prorektor Professor Schumacher hat zugesagt, dieses Jahr Platten aufzulegen! Und auch fünf weitere Dozenten sind mit dabei: Professor Kischel, Professor Steinmetz, Professor Heckmann, Doktor Radau und Doktor Söhnel.“
Neben dem Helfen gehört aber auch das gemütliche Beieinandersitzen dazu: Alle zwei Wochen treffen sich die Rotaractmitglieder, wie der Name schon sagt, zu einem rotierenden Stammtischtreffen „zum entspannten Quatschen und Zusammensitzen – das klappt natürlich am Besten in den verschiedenen Bars in Greifswald“, erklärt Isabella mit einem Augenzwinkern. Auch Ulrike Kurdewan, die sich seit drei Jahren im Vorstand des StudentenTheaters engagiert, schätzt die Zusammenarbeit und das Gemeinschaftsgefühl. „Mein letztes eindrucksvolles Erlebnis mit StuThe war ein Projekt mit unserem Partnertheater Teatr Brama im Juli. Wir waren auf dem Land in der Nähe von Stettin und haben zwei Wochen lang nichts anderes gemacht als Theater, Musik und Artistik. Am Ende gab es eine große Performance auf der Freilichtbühne in Goleniow. Das Schöne an dem Projekt ist, dass ich weiß, dass das erst der Anfang einer zukünftigen Zusammenarbeit ist. Im letzten Sommer haben wir auch schon zusammengearbeitet und im nächsten Sommer geht es sicher weiter“, erzählt die 26-jährige, die Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Eher durch Zufall ist Ulrike mit dem StudentenTheater in Greifswald in Berührung gekommen. Dadurch dass alle Mitglieder kleinere Aufgaben übertragen bekommen, würde man schnell in die Vereinsarbeit einbezogen, erklärt sie. Mittlerweile möchte sich Ulrike aus dem Vorstand zurückziehen, um Platz für neue engagierte Studenten zu schaffen, denn diese Arbeit, in der es darum geht, neue Akteure zu gewinnen, Erstsemesterveranstaltungen oder das wöchentliche Theatertraining zu organisieren, nimmt wie jede ehrenamtliche Tätigkeit einige Zeit in Anspruch.
Zeitmangel als Grund für Nichtengagement
So ist der Mangel an Zeit laut einer Umfrage der Prognos Arbeitsgemeinschaft als häufigster Grund für Nicht-Engagement genannt worden. Auch Studenten fehlt häufig die Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Denn obwohl zwei Drittel aller Hochschüler Ehrenämter wahrnehmen, beispielsweise als Nachhilfelehrer oder Basketballtrainer, sind die wenigsten von ihnen regelmäßig mehrmals in der Woche aktiv, so die Studie der Hochschul-Informations-System GmbH. Genügend Anreize, sich neben dem Studium freiwillig und unentgeltlich zu engagieren, scheint es für Studenten demnach nicht zu geben.
Auf der Vollversammlung der Studierendenschaft 2012 forderten Milos Rodatos, Henri Tatschner und Erik von Malottki neben der Wertschätzung von ehrenamtlichen sozialen, politischen oder sportlichen Tätigkeiten eine besondere Aufmerksamkeit in Form eines Preises für „herausragendes studentisches Engagement“ sowie Credit Points. Aber braucht es für ehrenamtliches Engagement wirklich einen Preis?
Isabellas Antwort ist eindeutig: „Nein, denn ehrenamtliche Arbeit braucht keine Vergütung. Das ist ja gerade das Schöne daran: dass es Menschen sind, die motiviert sind, weil sie Lust haben, etwas zu tun und nicht, weil es ihnen einen Vorteil verschafft.“ Und auch Radioredakteurin Fanny empfindet diese Art von Anreiz als ein Wettbewerb, der in Ehrenämtern fehl am Platze sei: „Man sollte ehrenamtlich arbeiten, weil man Spaß an der Sache hat und nicht irgendwelchen Punkten oder Preisen nachjagt.“
Eine kleine Auszeichnung oder Anerkennung für alle ehrenamtlichen Studenten fänden Franziska und Ulrike allerdings gar nicht verkehrt. „Es gibt Universitäten, an denen das StudentenTheater in die Lehre so eingebunden wird, dass eine Inszenierungsarbeit über ein Semester als Lehrveranstaltung fungiert“, erklärt Ulrike. „Das wünsche ich mir für unsere Universität auch.“
Punkte fürs Helfen?
Tatsächlich gibt es diese Art der Integration von ehrenamtlichem Engagement in das theoretische Studium schon seit längerer Zeit in den USA. Seit 2003 gibt es dies auch an der Universität Mannheim, an der der Pädagoge Manfred Hofer das erste deutsche Service-Learning-Seminar angeboten hat. Bei diesen Seminaren soll das theoretisch gelernte Wissen im Umfeld praktisch angewendet werden. Medienwissenschaftler würden demnach beispielsweise ehrenamtlich beim Radio oder in anderen Medien arbeiten und unter Anleitung eines Dozenten Projekte entwickeln, die sie dort verwirklichen könnten. Preise gibt es keine, jedoch werden für das Service-Learning-Seminar wie für andere Seminare im Studium Credit Points angerechnet – und ganz nebenbei hat man sich auch noch gesellschaftlich engagiert.
Zwar gibt es schon von der Universität Greifswald geforderte Pflichtpraktika, die mit Leistungspunkten honoriert werden, doch der Idee, die hinter dem Service-Learning-Seminar steckt, wird man damit nicht gerecht. Denn dieses Praxis-Seminar gibt Studenten die Möglichkeit, sich langfristig – und nicht nur für zehn Wochen während der Semesterferien – für kulturelle, sportliche, naturverbundene oder soziale Vereine in ihrer Umgebung einzusetzen. Dabei werden die Studenten mit der Verantwortung nicht allein gelassen, sondern von ihrem Dozenten betreut.
Um dieses Konzept in den Hochschulen zu verbreiten und zu etablieren, wurde das Netzwerk „Bildung durch Verantwortung“ gegründet. Neben der Universität Duisburg-Essen gehören auch die Universitäten Erfurt, Würzburg und des Saarlandes sowie die Fachhochschule Erfurt zu den Gründungsmitgliedern.
Gemeinschaft, Spaß und die Tatsache, seine Zeit neben dem Studium sinnvoll zu verbringen – das sind die Motive, sich zu engagieren, sei es bei Amnesty International, GreiMUN, Unicef, den moritz-medien, dem Orchester, dem Greifswalder Märchenkreis, den Kunstwerkstätten oder bei der Stadtbibliothek; ehrenamtliche Vereine und Organisationen leben von Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Einen materiellen Preis gibt es dafür nicht, aber darum geht es bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit auch nicht. Stattdessen steht die Tätigkeit im Mittelpunkt und die Möglichkeit sein direktes Umfeld kreativ mitzugestalten, wie Gauck in seiner Rede am 23. März 2012 in Berlin schon sagte: „Ihr seid Bürger, das heißt Gestalter, Mitgestalter. Wem Teilhabe möglich ist und wer ohne Not auf sie verzichtet, der vergibt eine der schönsten und größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins: Verantwortung zu leben.“
Ein Feature von Sabrina von Oehsen.
Seite 1 von 1612345»Letzte »
 Sex and the City, Feuchtgebiete, Shades of Grey – man wird nur so überschüttet mit Geschichten über die schönste Nebensache der Welt. Sex sells – das gilt besonders für die Medien. Doch sprechen die Menschen wirklich so offen über ihr Intimleben, wie es in Serien oder Reportagen dargestellt wird? Oder ist das Thema Sex gerade deshalb so interessant und populär, weil es in der Gesellschaft immer noch Tabus gibt?
Sex and the City, Feuchtgebiete, Shades of Grey – man wird nur so überschüttet mit Geschichten über die schönste Nebensache der Welt. Sex sells – das gilt besonders für die Medien. Doch sprechen die Menschen wirklich so offen über ihr Intimleben, wie es in Serien oder Reportagen dargestellt wird? Oder ist das Thema Sex gerade deshalb so interessant und populär, weil es in der Gesellschaft immer noch Tabus gibt?

 Jährlich fordert uns ein schwedisches Möbelhaus dazu auf, unsere Weihnachtsbäume aus dem Fenster zu werfen und Platz für Neues zu schaffen. Doch bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das nadelnde Bäumchen wieder loswerden, sollten wir erst einmal wissen, warum es während der Weihnachtszeit bunt geschmückt unsere Geschenke beherbergt.
Jährlich fordert uns ein schwedisches Möbelhaus dazu auf, unsere Weihnachtsbäume aus dem Fenster zu werfen und Platz für Neues zu schaffen. Doch bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das nadelnde Bäumchen wieder loswerden, sollten wir erst einmal wissen, warum es während der Weihnachtszeit bunt geschmückt unsere Geschenke beherbergt.
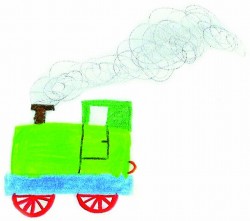 Ein Kommentar von Anton Walsch
Ein Kommentar von Anton Walsch Wintersonnenwende, auch als Julfest bezeichnet, existierte bereits vor Christi Geburt und weist überraschende Ähnlichkeiten zum heutigen Weihnachtsfest auf: Das große Festmahl in der Familie, die Tradition des Beschenkens genauso wie der besinnliche Gesang und die geschmückten Nadelbaumzweige charakterisierten seit jeher die Festlichkeit. Einige Quellen gehen noch weiter und suggerieren, dass die Kirche selbst im 4. Jahrhundert das germanische Julfest durch das christliche Weihnachtsfest ersetzen lies, um dem Ganzen seinen christlichen Hauch zu verleihen.
Wintersonnenwende, auch als Julfest bezeichnet, existierte bereits vor Christi Geburt und weist überraschende Ähnlichkeiten zum heutigen Weihnachtsfest auf: Das große Festmahl in der Familie, die Tradition des Beschenkens genauso wie der besinnliche Gesang und die geschmückten Nadelbaumzweige charakterisierten seit jeher die Festlichkeit. Einige Quellen gehen noch weiter und suggerieren, dass die Kirche selbst im 4. Jahrhundert das germanische Julfest durch das christliche Weihnachtsfest ersetzen lies, um dem Ganzen seinen christlichen Hauch zu verleihen. Vor über einem Jahr stieß die Landesregierung eine Reform der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern an. Nach den Wünschen von Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) sollte es sogar zum Ende des letzten Jahres eine Entscheidung bezüglich der Umgestaltung geben. Auf diese wartet man aber immer noch.
Vor über einem Jahr stieß die Landesregierung eine Reform der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern an. Nach den Wünschen von Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) sollte es sogar zum Ende des letzten Jahres eine Entscheidung bezüglich der Umgestaltung geben. Auf diese wartet man aber immer noch.



 Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.
Was bewegt Studenten sich neben ihrem Studium in kulturellen oder sozialen Vereinen zu engagieren? Vier junge Studentinnen haben moritz eine einfache und dennoch einleuchtende Antwort gegeben: Es macht schlichtweg Spaß.

