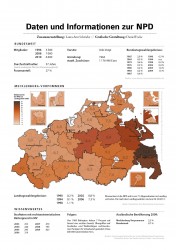von moritz.magazin | 14.05.2011
 Kiek mol wedder in
Kiek mol wedder in
Wohnen, wo andere Urlaub machen – ein erholsam klingender Satz, den sich die Region rund um die Ostseeküste zum Motto gemacht hat. Für die Fahrt nach Hause zur heimischen Familie benötige ich nur eine halbe Stunde. Ein klarer Vorteil, wenn man in seiner Heimat bleibt, um zu studieren! Auch meine Heimatstadt Wolgast rühmt sich mit dem genannten Slogan. Doch jedes Semester aufs Neue haben wir Küstenmenschen mit den ewig gleichen Vorurteilen der neu Zugezogenen zu kämpfen. Ich habe mal jemanden getroffen, der sich Ostvorpommern ungefähr so vorstellte: An einer Ecke kann man Fischbrötchen käuflich erwerben und gegenüber stehen die Nazis und warten auf ihren nächsten Auftritt. Ein guter Ruf sieht doch anders aus und während einige Urlaub machen, marschieren ein paar andere zur Demonstration auf. Am ersten Mai gaben sich die Faschisten wieder die Ehre ihre Parolen zu verbreiten. moritz sprach mit engagierten Organisationen und Vereinen, die gezielt Gegenaktionen vorbereiteten. moritz-Redakteure waren zudem live vor Ort und lassen euch an ihren Eindrücken auf den Seiten 26 bis 27 teilhaben.
Eine derartige Nazidemonstration hat sich am ersten Mai hier „oben“ schon etabliert und jedes Jahr versuchen die Rechten erneut Fuß zu fassen. Doch nicht überall läuft es so wie in unserer ländlichen Region. In Berlin sind weniger derartige Demonstrationen bekannt, dafür jedoch die üblichen Maikrawalle sehr präsent. In den Medien wird der erste Mai immer als Tag der linken Unruhestifter auseinander genommen. Selten wird mit ihm etwas Positives verbunden. Doch welche Geschichte verbirgt sich hinter diesem Aufruhr erzeugenden Tag? Der Artikel auf Seite 29 soll für Aufklärung sorgen.
Ein gewisser Teil an Studierenden hat dann doch mal die Nase voll von der rauen Küstenluft oder will einfach mal andere Erlebniseindrücke gewinnen und entscheidet sich für einen Aufenthalt in der Ferne. Auslandssemester sind mittlerweile keine Seltenheit mehr, sie werden ja auch häufig für einen qualifizierten Lebenslauf erwartet. Wie man sich alleine in einem anderen Land fühlt und welchen Problemen man durchaus ausgesetzt sein kann, könnt ihr in unserer Parisreportage auf Seite 19 bis 21 verfolgen.
Wenn es dann wieder ruhiger wird in der Hansestadt, die letzten Demonstranten ihre Transparente einrollen und der alte Trott zurück kehrt, dann sorgt doch mal für neue Abwechslung und „kiekt mol wedder in“ am Dienstag um 20 Uhr bei unserer Redaktionssitzung in der Rubenowstraße 2. Wir freuen uns auf eure kreativen Köpfe!
Laura-Ann Schröder
Das aktuelle Heft könnt ihr euch hier als pdf herunterladen, einzelne Artikel natürlich auch online lesen und kommentieren.
von moritz.magazin | 12.05.2011
In Zeiten politischer Verwirrtheit fällt es nicht leicht einen klaren Kopf zu bewahren. Der Anklamer „DemokratieLaden“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie Demokratie umgesetzt werden sollte und den Weg in unsere Köpfe zurückfinden kann.
Die Ankunft in Anklam war alles andere als eine herzliche Begrüßung. Keine fünf Minuten vom Bahnhof entfernt wurden wir von geschätzten 25 Plakaten der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) und zehn Postern einer freien Kameradschaft begrüßt. Unfassbarer ist es noch, dass sich direkt daneben eine Kindertagesstätte befindet. Die Plakate wurden sauber angebracht und niemand hat versucht auch nur eines davon abzureißen. Fassungslosigkeit beherrschte diese Minuten des Betrachtens und skeptische Einwohner beobachteten, was wir denn da vor den Aufmachungen trieben. Mehrmals waren wir gezwungen Bewohner nach dem Weg zu fragen und nicht jeder schien uns gut gesonnen zu sein, wenn er unser Reiseziel erfuhr. Schlussendlich erreichten wir dennoch unseren Bestimmungsort: den „DemokratieLaden“. Dieser wurde am 21. März 2011 eröffnet und ist vom Marktplatz nur einen Katzensprung entfernt.

Demokratieladen in Anklam - hier soll Demokratie erlebbar gemacht werden
Freundlich wurden wir von Annett Freier und Tina Rath, den beiden Mitarbeiterinnen des Ladens, empfangen. „Demokratie erlebbar machen“, so lautet das Motto. Der Laden soll als Anlaufstelle für interessierte Anklamer dienen. Darüber hinaus fungiert er zudem als Veranstaltungs, Ausstellungs- und Begegnungsstätte. Hier findet Demokratie nah am Bürger statt. „Dieses Bildungsprojekt wurde ganz bewusst in Anklam angesiedelt, weil hier eben nichts war, wo man sagen könnte, hier hat sich bereits Zivilgesellschaft wehrhaft gegen die rechtsextremen Entwicklungen organisiert“, erklärt Annett. Jedoch sind Tina und Annett nicht allein. Der Laden finanziert sich aus Fördergeldern der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern (LpB) und wird von vielen kreativen Köpfen der Stadt mitbestimmt. Hier erwachen Projekte, bei denen Annett und Tina als tatkräftige Berater zur Seite stehen, damit viele der Ideen eine mögliche Umsetzung finden können. „Es geht auch darum Schlüssel zu finden. Das Projekt sagt nicht, wir wissen wie bestimmte Schlüssel aussehen und in welches Schloss sie passen, sondern es ist Teil der Aufgabe den Schlüssel gemeinsam mit den regionalen Akteuren so zu bauen, dass er passt“, sagt Tina. Als Geschäftsstelle des Bildungsprojektes zur Entwicklung demokratischer Kultur und dem „Demokratisches Ostvorpommern – Verein für politische Kultur e.V.“ soll hier eine Alternative zur rechten NPD geschaffen werden, die die Stadt selbst als „nationalen Leuchtturm“ betitelt. Demokratie und Toleranz sollen den Weg zurück in die Köpfe finden, ohne dabei mit dem erhobenen Zeigefinger daher zu kommen. Annett erzählt: „Da hängen die großen Naziplakate, die sind für alle Welt sichtbar, die nach Anklam kommt, aber das demokratische Engagement nicht und warum sollen wir uns verstecken und ihnen die Öffentlichkeit überlassen?“ Anklam eignet sich zudem als gewählte Geschäftsstelle, da sie zum einen als Kreisstadt fungiert und zum anderen durch die Verkehrswege als ein Knotenpunkt agiert.
Wie Demokratie „erlebbar“ gemacht werden kann, zeigt das entstandene Festival „Voices“, welches für Jugendliche und Familien dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. Am 7. Mai 2011 wird auf den Usedomer Peenewiesen von 12 bis 23 Uhr ein Spektakel für alle Altersklassen veranstaltet. Hier zeigt sich Demokratie und Akzeptanz von seiner besten Seite. Der Verein möchte den Menschen auf diese Weise nahe bringen, was Demokratie in seiner eigentlich Form heißt: „nämlich ich gestalte eine Gesellschaft mit“, so Annett und Tina. Gemeinsam konnten sie mehrere Projekte, vor allem mit der Anklamer Jugend auf den Weg bringen. Zum Beispiel wurde das örtliche Jugendzentrum durch gemeinsame harte Arbeit endlich neu renoviert. Genau diese Erfolge verschönern unter anderem das Stadtbild. Der „DemokratieLaden“ sollte als Vorbild gesehen werden, welchem weitere Landkreise und Städte folgen sollten!
Ein Bericht und Foto von Laura-Ann Schröder.
Richtigstellung:
Dieser Text entspricht nicht ganz der Heft-Version des Artikels. Er wurde an einer Stelle korrigiert. Wir schrieben im Heft „Nationalsozialististische Partei Deutschlands (NPD)“. Das ist nicht korrekt. Korrekt ist „Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)“. Auch die hier verfügbare PDF wurde an entsprechender Stelle geändert.
von moritz.magazin | 12.05.2011
Am 1. Mai versammelten sich rund 3 500 Protestler, um den demonstrierenden Nationalsozialisten zu zeigen, dass für sie in der Hansestadt Greifswald kein Platz ist. Am Ende des Tages hatten viele Einwohner der Stadt allen Grund zu jubeln.
Ich hoffe, dass ich den NPD-Demonstrationszug nicht sehen muss, dann haben wir erfolgreich blockiert – Yvonne Görs spricht aus, was sich viele Vereine am 1. Mai erhofften. Als eine von mehreren Mahnwachen stand sie stellvertretend, gemeinsam mit anderen, für das „Jugendzentrum Klex“ und dem „Stadtjugendring“ an der Anklamer Straße Ecke Schönwalder Landstraße. Schon am Morgen kamen bereits fünfzig Leute aus Stralsund, um sich zu informieren.
Der Tag begann sonnig, doch kalter Wind sorgte für relativ niedrige Temperaturen. Die ersten Demonstranten sammelten sich morgens am Rubenowplatz, um kurze Zeit später gemeinsam mit weiteren Protestierenden ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Sowohl die Stadt Greifswald, als auch Universität und Schulen sowie zahlreiche andere Organisationen und Vereine engagierten sich im Vorfeld stark für eine friedliche, aber bestimmte Demonstration gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Der gut gelaunte Demokratiezug setzte sich Richtung Rigaer Straße in Bewegung und lief zielgerichtet zum dort stattfindenen Demokratiefest.
Gegen elf Uhr traf der Zug mit den bereits erwarteten Nationalsozialisten ein. Ein Block rasierter Köpfe lief über den Bahnsteig in Richtung Busbahnhof Süd. Die ersten Fahnen wurden unter der Menschenmenge verteilt. Sie reihten sich auf und begannen ihre Flaggen in eine geeignete Position zu bringen. Beim Anblick der Aufstellung lief einem ein kalter Schauer über den Rücken und kopfschüttelnd konnte man fast nicht glauben, dass das alles wirklich erlaubt war.
Gleichzeitig hatten sich bereits die ersten Sitzblockaden, sowohl in der Schönwalder Landstraße als auch in der Heinrich-Hertz-Straße, gebildet. Sie folgten dem Aufruf des Bündnisses „1. Mai – Greifswald Nazifrei“ und waren auch nach mehrmaliger
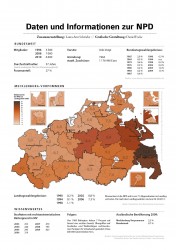
Daten und Informationen zur NPD - inklusive Wahlergebnisse
Aufforderung der Polizei nicht bereit den Weg für die Nazis freizugeben. Die Polizei begann mit der angekündigten Räumung. „Die Polizei ist bis auf einige Ausnahmen relativ vernünftig bei den Räumungen vorgegangen. Die Stimmung unter den Demonstranten war sehr gut“, erklärt Tom Koenig*. Mittlerweile war es schon nach halb eins. Die Protestierenden hatten den Faschisten bereits eineinhalb Stunden ihrer Demonstrationszeit genommen. Dann kam das, was viele schon vermutet hatten. Die Route der NPD wurde geändert und lief die Hans-Beimler-Straße entlang. Das Aufgebot der Polizei sperrte sämtliche Seitenstraßen, um Störungen zu vermeiden. Die Fahnen der Nationalsozialisten waren wieder ordentlich positioniert – es schien bald, als seien Winkel abgemessen worden, wie sie zu halten waren. Aus dem Lautsprecherwagen ertönte „Deutsche Arbeitgeber, Deutsche Arbeitnehmer“. Die dumpfe Parole wurde lautstark von den NPD-Anhängern nachgegrölt. Doch der Buschfunk auf der Gegenseite schien gut zu funktionieren. Egal wohin der NPD-Zug marschierte, es entstanden immer wieder Blockaden. Am Ende blieb ihnen nur eins: der Rückzug. Von allen Seiten blockiert, mussten sie zurück zum Bahnhof Süd. Ein großer Erfolg für alle Gegendemonstranten. Jubelnd standen sie an den Straßenseiten und gaben noch mal richtig Gas mit ihren Gesängen. Sie hatten ihr Ziel erreicht: sie haben die NPD-Demo erfolgreich blockiert und auch Yvonne Görs musste den Zug nicht an ihrer Mahnwache vorbeilaufen sehen. Jedoch ließ man es sich seitens der NPD nicht nehmen, doch noch so etwas wie eine abschließende Kundgebung zu halten. Dabei kamen sie gänzlich von ihrem eigentlichen Demonstrationsthema „Unsere Heimat – unsere Arbeit“ ab und brachten geschichtliche Ereignisse aus ihrer Sicht hervor. Nach Beendigung der Veranstaltung wurden die Straßen zwar leerer, aber die Angst vor Ausschreitungen und Übergriffen stieg. Die Polizei stand jedoch wie eine schützende Grenze zwischen NPDlern und Gegendemonstranten. Schlussendlich hat Greifswald die Nazis in ihre Schranken verwiesen. Hoffen wir, dass dies bei jeder Nazidemonstration Gang und Gebe wird.
Eine Reportage von Laura-Ann Schröder.
Richtigstellung:
Dieser Text entspricht nicht ganz der Heft-Version des Artikels. Er wurde an einer Stelle korrigiert. Wir schrieben im Heft „Nationalsozialististische Partei Deutschlands (NPD)“. Das ist nicht korrekt. Korrekt ist „Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)“. Auch die hier verfügbare PDF wurde an entsprechender Stelle geändert.
von moritz.magazin | 12.05.2011
Während die Zahl der studierten Semester sich dem eigenen Alter nähert, sieht der klassische Langzeitstudent Generationen von Junglernern in Greifswald um sich herum ein- und ausgehen.
… und plötzlich ist man ein alter Sack. Als ich anfing zu studieren war der Internetauftritt der Universität noch gelb und, ganz oldschool-akademisch, in Serifenschrift gehalten. Eine von allen Spirenzchen befreite Textwüste. Eine bollerige Informationsinsel im Meer aus „Under Construction“-Grafiken und spleenigen Mailinglisten – viel mehr gab es damals im www ja nicht.
Der Studierendenausweis war damals noch ein rosa Zettel ohne Foto. Ich erschrak, als mich plötzlich, das mit der Immatrikulation eingereichte, Jugendfoto auf dem neuen Dokument anstarrte. Und das Rausgefummle aus dem Leporello immer: die alternden Gichtfinger haben jedes Mal ihre Müh‘ das Ding da herauszutrennen.
Wo andere in rund drei Jahren durchs Studium gescheucht werden, wie Hühner über den Hof, lebt der bummelfreudige Restmagister stoisch und unbehelligt von irgendwelchen Reformen, seinen eigenen Trott weiter. Früher ging das doch auch. Wieso soll jetzt die Uni-Welt eine andere sein. Man muss doch nicht jeden Modernitätskokolores mitmachen. Dem Universitären haftete doch immer so etwas angenehm angestaubtes, altes, zeitenthobenes an. Gerade in den Geisteswissenschaften, dem klassischen Fach der Bummelstudenten. Jahrelang wurde hier rumgedoktort, wurden eigensinnige Forschungsvorhaben angegangen, das Denken von seinen Grundfesten umgekrempelt und philosophisch tief, bis in den Denkapparat, in der Nase gebohrt – bis man dem Wesen des Wissens irgendwie näher zu kommen glaubte. Heute sammelt man im Studium Punkte wie in einer Spielshow. Coins, die man irgendwo sicher noch mal irgendwie investieren kann.
Der Bummelstudent – ein Urzeitvieh aus dem Pleistozän?
Heute geht es im Studium um Erfolge, weniger um Erkenntnisse. Soft Skills erlernt man nicht mehr auf der Straße, nein, sie werden in Seminaren antrainiert. Wie man Hunden Kunststückchen beibringt. Der Bummler alter Schule hingegen begreift die „General Studies“ auf ganz eigene Art und Weise. Er hat nach all den Jahren zwar noch keinen Abschluss in der Tasche, hat sich aber zu einem wahren Lebensprofi entwickelt. Sich irgendwie durchschlagend, lebt der Bummelant mit Immatrikulationshintergrund durch die Tage und Jahre seiner Wissenswalz. Das gut funktionierende Nachtleben Greifswalds spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die Langzeitfraktion – jene inklusive, die bereits fertig studiert haben, aber immer noch, und das sogar freiwillig, in Greifswald lebhaft sind – sitzt jetzt zusammen mit denen in der Bar, die gerade mal das Windelwirrwarr überwunden hatten, als man selbst schon über den Abiturprüfungen grübelte.
Dauermüde toddelt der Bummelstudent durch den Jungflohzirkus in den Seminaren. Er ist ein Saurier. Ein reptilienhaftes, von Zeit zernagtes Urzeitvieh aus dem Pleistozän. Der Toddelstudent lumpt sich – ohne genau zu Wissen, wann das mit dem Pleistozän eigentlich war – mit fuchshafter Weltschläue und bäriger Gelassenheit durch die Hektik des Lernbetriebes. Zu Toddlers Zeiten war es noch verpönt Laptops im Seminarraum aufzubauen, heute herrscht Elektrosmog im Hörsaal. Nicht gut für das ohnehin schon fahrige Resthirn des Toddlers. Tierpfleger, Fließbandarbeiter oder Blumengießer – das sind die real denkbaren Lebensentwürfe eines Toddlers. Er ist eigentlich ein Kaffeehausgrantler, der irgendwie im akademischen Betrieb gelandet ist. Was hier zur Wissenschaft erhoben wird – sogenannte Geistesangelegenheiten, Kommunikation, Musik und philosophisches Laborieren – beschäftigt auch den Bummelanten in seinen alltäglichen Selbst- und Weltergründungen. Seine Methoden sind jedoch eher eigen und im Allgemeinen in keinem Reader oder Journal zu finden.
„Welcher Wolf, was für eine Nudel?“
Der klassische Langzeitler hat sich um die Jahrtausendwende herum immatrikuliert und in den krudesten Kombinationen so ziemlich alle Fachrichtungen durchprobiert, in die man sich einschreiben konnte. Wohlgenährt durch jahrelange Mensamästung schleift sich der olle Altmagister beim Versuch sein wildes Sammelsurium an Scheinen zu einem vorzeigbaren Abschluss zusammenzukondensieren, durch die Hörsäle und Bibliotheken. Als Kind einer vergangenen Zeit tapert der Trödelstudent auf den wunden Synapsen seines Denkorgans durch die letzten Züge seines ausgedehnten Studiums. Die heutige Verlagerung des Organisatorischen in komplizierte Online-Portale und Neuerfindungen, wie WULVs und Moodle, macht das nicht unbedingt leichter. „Welcher Wolf, was für eine Nudel?“ geht es dem Langzeitler langsam zwischen den Ohren umher. Der Trödelstudent trödelt nicht aus Boshaftigkeit oder Faulheit, es sind tiefere Gleichgültigkeiten, die ihn umtreiben. War ein Studium nicht mal eine wichtige Phase der Menschwerdung, die Zeit der Post-Pubertät, die Zeit der Denkschulung, ein Trimm-Dich-Pfad fürs Gehirn, den die eine eben schneller, der andere etwas langsamer beschreitet? Die Langzeitstudierenden sind schwammhafte, wissensdurstige, mit der Zeit porös gewordene Gehirne auf Krücken. Manische Thementieftaucher.
Natürlich sind es nicht nur Bummelfreuden und vieldimensionaler Müßiggang, die die Dauer eines Studiums dehnen können. Prekäre und familiäre Lebensumstände fordern von den Studierwilligen außeruniversitäre Mehraufwände, die häufig mit den Regeln und Pflichten eines normgerechten Studiums kollidieren.
Ein Gemüsegarten als Lebenslauf
Der klassische Trödelstudent begreift das Studium weniger als Sprosse einer Leiter, sondern vielmehr als Teil etwas Ganzheitlichen. Er scharwenzelt sich als Bauleiter auf verschiedenen Baustellen durch eine Lebensmelange aus Studium, Selbstverwirklichung, Projekten und Passionen. Dem Ewigeingeschriebenbleiber ist es egal, welchen Hipnessfaktor der Arbeits- beziehungsweise viel mehr Praktikumsgeber hat, den man bei facebook zur Schau trägt. Der Lebenslauf eines Langzeitstudenten ähnelt einem gut bestellten Gemüsegarten. Ein Cluster aus Kraut und Rüben. Etwas wonach, in Zeiten der allseits geforderten Vielheitsflexibilität, jeder Arbeitgeber mit Kusshand Ausschau halten sollte.
Der Dauerstudent hat sich ein weites Netz aus Kompetenzen und Connections erarbeitet. Er kann alles: Callcenter, Kellnern, Kreativbüro. Er ist ein mit allen Wassern geweihtes Allround-Genie, ein Essayist im Leben, eine ständige Probe aufs Exempel. Die Langzeitler kleben Kronkorken und erste graue Haare in ihre Studienbücher. Sprechstundenbesuche bei den Professoren ähneln immer mehr Einigungsgesprächen, die der Schadensbegrenzung dienen. Die, mit denen er damals anfing zu studieren, sind bereits Konzernleiter und im Nirvana der Erwachsenheitswelt verflogen; werden zumindest auch langsam fertig oder sind als ziellose Lethargiker in eitlem Zynismus zergangen.
Die Alten Säcke gehen natürlich auch noch gerne abends raus. Durch die üblichen Kulturlokalitäten schleifen sie sich in alterszäher Zeitlupe. Saufsaurier. Um sie herum ein stetig fluktuierende, welpenhafte Tobemeute. Ein flirrendes Gewusel, nächtelanges Gewehe durch rauchigen Zeitverflug. Gegenseitige Befeuerung von jung und älter. Während die Welpen morgens wieder juxfidel in der Vorlesung sitzen, zerrt die Bummlerfraktion ihre tauben Leiber nur mit Ach und Krach hinter die Lernbänke. Man wird nicht jünger. Gemeinsam werden wir alt. Bildet Bummelbanden!
Ein Feature von Ferdinand Toddler.