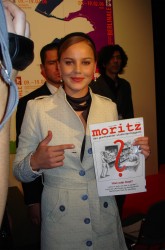von Felix Kremser | 05.04.2011

Für einen ersten Eindruck: Le Flyer
Für acht Studentinnen und einen Studenten des Caspar David Friedrich Instituts (CDFI) geht ihr Studium diese Woche auf die Zielgerade zu. An verschiedenen Orten stellen sie ihre Examensarbeiten für die erste Staatsexamensprüfung aus.
Den Anfang machten am Montag bereits Svea Cichy („was am Ende bleibt“) in der Medienwerkstatt, Andrea Gottlebe („stadtlandmehr“) in den Malsälen des CDFI, sowie Karoline Stade („covers.“), Mirjam Ruckick-Thies („CELEBRITY SKIN“) und David Reichenbach („… wie die Motten das Licht.“) in der Burgstraße 11. Am heutigen Dienstag eröffneten um 18 Uhr Diana Hohenstein („Ich fühle mich beobachtet.“) in der Nexö Passage und Anne Richter („ansichtsache.“) um 20 Uhr in der Fleischerstraße 17 ihre Ausstellungen. Den Abschluss der Feierlichkeiten bilden am Freitag Stefanie Krüger („mechanisch“) mit ihrer Finissage um 18 Uhr im Café Caspar und die Vernisage von Beate Müller („samtgrau“) um 19 Uhr in der Kulturbar. Die Arbeiten umfassen dabei das ganze Spektrum moderner Kunstpräsentationen von Gemälden über Fotografien und Plastiken bis hin zu Installationen.
Wer es nicht einrichten konnte, die Vernissagen zu besuchen, dennoch aber einen Eindruck von den Arbeiten der Studierenden erhalten möchte hat dazu noch an ausgewählten Terminen unter der Woche die Gelegenheit.
Unter folgendem Link könnt ihr auch gleich sehen, wo die Ausstellungen sind:
View Larger Map
Dienstag:
- 14 – 16 Uhr; Medienwerkstatt (Bahnhofstraße 50): Svea Cichy („was am Ende bleibt“)
- 14 – 16 Uhr; Kleiner und Großer Malsaal des CDFI ( Bahnhofstraße 46/47): Andrea Gottlebe („stadtlandmehr“)
- 14 – 17 Uhr; Burgstraße 11: Karoline Stade („covers.“), Mirjam Ruckick-Thies („CELEBRITY SKIN”), David Reichenbach („… wie die Motten das Licht.“)
- 18 Uhr; Nexö Passage: Diana Hohenstein („Ich fühle mich beobachtet.“)
- 20 Uhr; Fleischerstraße 17: Anne Richter („ansichtsache.“)
Mittwoch:
- 8 – 10 Uhr; Medienwerkstatt (Bahnhofstraße 50): Svea Cichy („was am Ende bleibt“)
- ab 11 Uhr; Kulturbar: Beate Müller („samtgrau“)
- 13 – 15 Uhr; Fleischerstraße 17: Anne Richter („ansichtsache.“)
- 14 – 16 Uhr; Nexö Passage: Diana Hohenstein („Ich fühle mich beobachtet.“)
- 14 – 17 Uhr; Burgstraße 11: Karoline Stade („covers.“), Mirjam Ruckick-Thies („CELEBRITY SKIN”), David Reichenbach („… wie die Motten das Licht.“)
- 16-18 Uhr; Café Caspar (Fischstraße): Stefanie Krüger („mechanisch“)
Donnerstag:
- 10 – 12 Uhr; Kleiner und Großer Malsaal des CDFI: Andrea Gottlebe („stadtlandmehr“)
- ab 11 Uhr; Kulturbar: Beate Müller („samtgrau“)
- 13 – 15 Uhr; Fleischerstraße 17: Anne Richter („ansichtsache.“)
- 14 – 16 Uhr; Medienwerkstatt (Bahnhofstraße 50): Svea Cichy („was am Ende bleibt“)
- 14 – 16 Uhr; Nexö Passage: Diana Hohenstein („Ich fühle mich beobachtet.“)
- 16 – 18 Uhr; Café Caspar: Stefanie Krüger („mechanisch“)
Freitag:
- 8 – 10 Uhr; Medienwerkstatt (Bahnhofstraße 50): Svea Cichy („was am Ende bleibt“)
- Ab 11 Uhr; Kulturbar: Beate Müller („samtgrau“)
- Ab 18 Uhr; Café Caspar: Stefanie Krüger („mechanisch“)
- 18 – 20 Uhr; Burgstraße 11: Karoline Stade („covers.“), Mirjam Ruckick-Thies („CELEBRITY SKIN”), David Reichenbach („… wie die Motten das Licht.“)
Die Ausstellung von Beate Müller wird noch bis zum 17. April in der Kulturbar zu sehen sein, alle anderen Ausstellungen enden am Freitag.
Bilder: Flyer – Caspar David Friedrich-Institut

von Christopher Denda | 05.04.2011

Logo von LEI Greifswald
Auch in diesem Semester haben wieder so einige ausländische Studierende den Weg ins schöne Greifswald gefunden. Natürlich sollen diese auch entsprechend empfangen werden.
Empfang für ausländische Studierende im Koeppenhaus am Mittwoch
Deshalb laden das Akademische Auslandsamt der Universität, sowie die Lokale Erasmus Initiative (LEI) Greifswald alle neuen ausländischen Studierenden der Universität herzlich ein, an der Begrüßung im Koeppenhaus (Bahnhofstraße 4) teilzunehmen. Dazu gehören die Austauschstudierende (bilateral/ERASMUS), reguläre Vollstudierende, Studierende aus dem DSH-Kurs (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber), sowie die Studierenden des Studienkollegs.
Der Zeitrahmen ist von 19-20:30 Uhr gesetzt, denn wer anschließend noch Lust hat feiern zu gehen, ist ab 21 Uhr in der Bar „Zur Sonne“ (Steinbeckerstr. 1) noch gerne gesehen. Selbstverständlich sind auch alle anderen Kommilitonen bei beiden Veranstaltungen willkommen.
von radio 98eins | 05.04.2011
Wenn ihr heute Abend noch die perfekte Entspannung für den zweiten Unitag sucht, schaltet 98.1 ein. Am Mikrofon sitzt für euch ab 19 Uhr Mandy Markwordt. Eine Stunde lang erfahrt ihr die Neuigkeiten aus Greifswald und Umgebung und hört nebenbei die beste Musik abseits des Mainstreams. Die neuesten Entwicklungen zum Bologna-Prozess und die Veranstaltungstipps für heute Abend solltet ihr euch nicht entgehen lassen. In unserem Kulturplausch hört ihr mehr zum Todestag von Kurt Cobain und die Mythen, die sich um ihn ranken.
Also, radio98eins, das Magazin von 19-20 Uhr hören :)!
von Gastautor*in | 05.04.2011
Eine Rezension von Arvid Hansmann
Gigantische Luftschiffe über einem zerbombten Labyrinth von Schützengräben, feuerspeiende Drachen im Schlachtgetümmel, futuristische Städte mit High-Tech-Waffen – und fünf leicht bekleidete junge Damen, die auf alles schießen, hauen oder stechen, was sich bewegt – vermeintliche Zuckerpuppen, die sich mit dem Mut der Verzweiflung gegen die Demütigungen ihrer martialisch-patriarchalen Umwelt zur Wehr setzen –und das Ganze vorangetrieben von manisch-wilder Musik. Dies scheinen doch genügend Zutaten zu sein, um einen großen Hollywoodfilm zu schaffen. Und doch bleibt da eine Leere zurück, wenn man die rund 110 Minuten von „Sucker Punch“ (z. dt. etwa „Boxhieb ohne Vorwarnung“) als Kinobesucher durchflossen hat; das trainierte jugendliche Auge benötigt, um die Bildfolge nicht zum psychedelischen Rausch jener Jahre werden zu lassen, auf die der adaptierte Jefferson-Airplane-Klassiker „White Rabbit“ verweist.

Wie Alice im Wunderland?
Wie „Alice im Wunderland mit Maschinengewehren“, so beschreibt Regisseur Zack Snyder sein neuestes Werk. Referenzobjekt wird hier sogleich die jüngste Verfilmung der Geschichte (2010) durch Tim Burton, jenes Meisters des grotesk überzeichneten Leinwandspektakels, der hier durch die Disney-Produzenten zur Mäßigung gedrängt worden war. Jedoch äußerte sich diese Mäßigung nicht in den Bildern: Die Welt die sich für die junge Alice im Kaninchenbau auftat, steht den Szenarien in Snyders Film in ihrer visuellen Fantasie kaum nach. Das, woran es beiden Filmen mangelt, ist der Mut zu einer innovativen, beziehungsweise konsequenten Geschichte.
Es ist das große Dilemma Hollywoods, das man dort nur äußerst selten bereit ist, ein intelligentes Narrativ mit einem entsprechenden audiovisuellen Horizont zu vereinen. Die Bilder besitzen mitunter eine so subtile Mehrschichtigkeit und eine so reiche Semantik, dass man sich immer wieder fragt, warum dies nicht auch auf die Ausgestaltung der Charaktere und den Handlungsverlauf übertragbar ist.
The Dormouse never said „Feed your head.“

In der Irrenanstalt steht Babydoll eine Lobotomie bevor. Wenn sie ihre eingängige Version von "Sweet Dreams" vorträgt, erhält man hier den Quellennachweis.
In „Sucker Punch“ ist die Protagonistin ein junges Mädchen (Emily Browning), das nach dem Tod seiner Mutter vom bösen Stiefvater in eine Irrenanstalt gebracht wird, wo ihr nach wenigen Tagen eine Lobotomie, also die Auslöschung ihrer Persönlichkeit, bevorsteht. In dieser scheinbar ausweglosen Situation lernt sie in der Theatergruppe einer ebenso hilfsbereit, wie hilflosen Therapeutin (Clara Gugino) vier weitere Mädchen kennen. Diese imaginieren die trostlosen Gefängnisräume als Szenerie eines Revuetheaters, in dem der sadistische Anstaltsleiter (Oscar Isaac) zum schmierigen Nachtclubbesitzer wird. Zwischen den Schwestern „Sweet Pea“ (Abbie Cornish) und „Rocket“ (Jena Malone), der dunkelhaarigen „Blondie“ (Vanessa Hudgens) und der Asiatin „Amber“ (Jamie Chung) wird nun der Neuankömmling als „Baby Doll“ zum eigentlichen Star. Zum einen vermag sie durch ihre Tänze die anwesende Männerwelt zu betören und hegt zum anderen konkrete Pläne, aus diesem Verlies auszubrechen, wozu sie auch ihre Freundinnen animiert.
Der eigentliche Reiz des Filmes besteht nun darin, dass sie sich mit jedem Tanz im Geiste in ein gigantisches Kampfszenario begibt. Hier wird nun sowohl im Narrativ, als auch in der Ästhetik in direkter Weise zu einem anderen Medium Bezug genommen: dem Computerspiel. Jeder Kampf bildet ein „Level“, in dem zunächst durch einen Auftraggeber das zu erreichende Ziel vorgegeben wird. Diese Aufgabe übernimmt hier Scott Glenn, der im Betrachter Assoziationen zum mittlerweile zwanzig Jahre alten „Das Schweigen der Lämmer“ weckt, wo er als väterlich-besorgter FBI-Agent die junge Clarice Starling zu Hannibal Lecter schickte.
Nach einem „Einführungslevel“, in dem „Baby Doll“ ihre Ikonographie als „Schulmädchen mit Samuraischwert“ erhält, wobei die blondierten Zöpfe, die melancholischen Augen und der Schmollmund das utopische Schönheitsideal der Mangawelt noch steigern, erwarten die fünf Mädchen gemeinsam drei weitere Level, die sich quasi paradigmatisch in die Genreklassifizierung des „Cyberspace“ einfügen. Dabei ist es diesem Film durchaus positiv anzurechen, wenn er die Kategorien „History“, „Fantasy“ und „Science Fiction“ zunächst in ihrer Fassadenhaftigkeit offen legt: das Prinzip „alles abknallen, was sich bewegt“, ist stets das gleiche. Spannend ist jedoch, zu sehen, wie auf einer zweiten Ebene das Bewusstein für „Geschichte“ ikonographisch kanonisiert wird.
Es mag zumindest den „gebildeten Europäer“ freuen, wenn im Szenario „Erster Weltkrieg“ neben den Schlaglichtern „Schützengraben“, „Zeppelin“ und „Doppeldecker“, sowie der Lokalisierung „Frankreich“ durch die skelettierte Kathedrale (wobei es unsicher ist, ob es sich um die wirklich im Krieg beschädigte in Reims oder die plakativere in Paris handeln soll), die „bösen Deutschen“ auch Pickelhauben und nicht nur Stahlhelme tragen und dass hier höchsten ein Ritter- aber kein Hakenkreuz etwas verloren hat und so vielleicht ein Hauch von einem „didaktischen Erfolg“ die amerikanischen Rezipienten erreicht.
[youtube NbjSfSug9tc]
Im Szenario „mittelalterliche Drachenburg“, in dem geharnischte Ritter auf Orks treffen (die vermutlich Peter Jackson kostengünstig abzugeben hatte), dient den fünf Kämpferinnen ein B-25-Bomber als Transportmittel und im dritten Szenario, durch das ein futuristischer Zug rast, der von technokratisch-sterilen Cyborgs bewacht wird, kommt ein Bell-UH-1-Hubschrauber zum Einsatz. Damit wird auf die beiden weiteren prägenden amerikanischen Kriegsschauplätze des 20. Jh. verwiesen. Ob nun die „Vernichtung des menschenverbrennenden Monsters“ auf Hitler und das „Scheitern der Mission“ auf Vietnam verweist, bleibt Interpretation. Festzuhalten bleib jedoch das diese Akzentuierung in der Geschichtsrezeption, oder besser –konstruktion durch den Film weiter unterstrichen wird.
„Da brauch’n ma Maschinengewehre und Stinger-Raketen, sonst wird das nischt!“
Das Bewusstsein dafür, dass man spätestens jenseits des kommunikativen Gedächtnisses, das mit dem letzten „persönlichen Zeugen“ (der auch alles andere als „objektiv“ ist) stirbt, so etwas wie eine „geschichtliche Wahrheit“ vergeblich sucht, hat Regisseur Zack Snyder bereits 2006 mit „300“ exemplarisch aufgezeigt. Der selbstaufopfernde Kampf der Spartaner gegen die persische Übermacht an den Thermopylen hatte sicher schon in der antiken Überlieferung die Funktion, patriotische Kampfestreue zu beschwören, wurde also aus einer späteren Zeit sinnstiftend interpretiert. Das zynische Grinsen, mit dem Gerald Butler dem König Leonidas ein äußerst einprägsames Gesicht verlieh, gab der Bildfreude am Gemetzel eine Ambivalenz, die zwischen der absoluten Hingabe für eine „höhere Sache“ und blankem Fatalismus schwankte. Die Popularität, die der Film gerade durch seine Parodien erhielt (von denen hier die Synchronisation des Mansfelder Anarcho-Duos „Elsterglanz“ besonders lobend hervorgehoben sein soll), wird auch die Feldlager im Irak und in Afghanistan erreicht haben. Ob dies die Opferbereitschaft für „Heim und Weib“ gesteigert hat, bleibt zu hinterfragen.
-
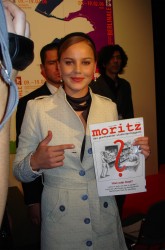
Abbie Cornish bei der Berlinale 2006, wo sie mit Heath Ledger das Drogendrama „Candy“ präsentierte.
Bei „Sucker Punch“, das nicht wie „300“ oder „Watchmen“ (2009) auf einer Comic-Vorlage basiert, sondern von Snyder zusammen mit seiner Frau Deborah ausgearbeitet wurde, wird jene zynische Ambivalenz durch das moralisierend gerechte Finale verwässert. Wenn sich die Heldin dieser Passionsgeschichte als Opferlamm mit Tigerkrallen zur Wehr setzt und sich ihr am Ende das Lobotomiewerkzeug gleich einem Kreuzesnagel nähert, fragt man sich, was denn hier das „Evangelium“ sein soll. Ist die amerikanische Moral von der „Erlösung des Individuums aus dem eigenen Willen heraus“ wirklich tragfähig? Hätte nicht die Konsequenz eines resignativen Szenarios, wie es Frank Miller ja bereits in „Sin City“ (2005) vorgegeben hatte, animierender auf den Zuschauer gewirkt?
Sicher erscheint es völlig am Ziel der Produzenten und wohl auch am Gros der Rezipienten vorbeigeschossen, hier wenigstens einige Züge von Brechts „epischem Theater“ einzufordern (oder zumindest das Rachelied seiner „Seeräuber-Jenny“). Doch hätte Snyder nicht die in ihren Ansätzen und in ihrer ästhetischen Gestaltung dafür prädestinierten Figuren mehr parabelhaft wirken lassen sollen? In den Level-Sequenzen hat er den Zuschauer ja zum passiven „Gegenüber“ gemacht – was den Reiz eines Computerspiels schnell abtötet.
Resümierend bleibt festzuhalten, dass „Sucker Punch“ als „Bildorgie“ durchaus innovatives Potential besitzt, dieses aber durch die inkonsequente Dramaturgie wieder verspielt. Man braucht hier nicht den Vergleich zu Julie Taymors Shakespeare-Verfilmung „Der Sturm“ (2010, in Deutschland leider noch nicht erschienen) zu unternehmen, bei dem die Geschichte auf einer nackten Theaterbühne ebenso gut wirken würde – eben deshalb, weil sie für die Theaterbühne geschaffen wurde. Die Möglichkeiten des Kinos und gerade der digitalen Technik sollten aber auch Dramaturgen animieren, über konventionelle Grenzen hinwegzudenken.
Ob nun – gerade in unseren Tagen – das Thema Krieg unbedingt die Hauptquelle für die phantastische Ausgestaltung sein muss, könnte man anprangern. Gerade hier wäre die Abstraktion das zu ersehnende Ziel. Der Staufer-Kaiser Friedrich II. hatte einst im 13. Jahrhundert auf einem Schachbrett um Jerusalem gekämpft – so erzählt es uns Guido Knopp. Sollten wir ihn bei seiner Welterklärung zumindest in diesem Punkt einmal unterstützen, anstatt aus unserem Elfenbeinturm auf tönernem Fundament verächtlich auf ihn herabzublicken
Fotos: Warner Bros (keine CC-Lizenz), Arvid Hansmann (Abbie Cornish, moritz-Archiv)
von David Vössing | 05.04.2011

Ekatarina Kurakova und Max Willmann zogen ein positives Fazit der Erstiwoche.
„Es hat ganz gut geklappt“, so zog Erstsemesterreferentin Ekaterina Kurakova ein positives Fazit der Ersti-Woche auf der AStA-Sitzung am Montag Abend. Sie beklagte jedoch, dass es weniger Hilfe durch die anwesenden Referenten als bei der Ersti-Woche im Wintersemester gab. Positiv hob sie die Turniere zu Futsal und Volleyball hervor, aber auch das Mutabor-Konzert mit über 300 Studenten, sowie die Stadtführung mit den Tutoren. Beim Markt der Möglichkeiten kamen etwa 100 bis 150 Erstis, weswegen der Markt künftig im Sommersemester kleiner ausfallen soll. Auch soll die Welcome-Party nicht mehr am gleichen Tag stattfinden.
Bei den AStA-Vorträgen in der Erstsemesterwoche, beispielsweise beim Vortrag über Hochschulpolitik, waren kaum Erstis da. „Bei mir waren sieben Studenten, die 70 Fragen hatten“, berichtete Susanne Schultz von einer positiven Ausnahme. Die Ausflüge am Sonntag nach Usedom und in den Hansedom nach Stralsund wurden mangels Anmeldungen abgesagt, nur die Fahrt nach Hiddensee fand statt. Auch Maximilian Willmann, der andere Ersti-Referent, will die Ersti-Woche im Sommer verkleinern und ärgerte sich, dass sich zum Markt der Möglichkeiten eine Gruppe recht spät angemeldet hat und dann doch nicht gekommen ist. Er betonte aber abschließend: „Die Ersti-Woche muss erhalten bleiben.“
AStA unterstützt Demokratiefest und Gegendemonstrationen gegen NPD-Aufmarsch
Ein weiteres Thema der AStA-Sitzung war der bevorstehende Umzug des AStA in die Ecke Loefflerstraße/Wollweberstraße. Der genaue Termin steht noch nicht fest, voraussichtlich bis Ende des Jahres muss der Ausschuss umziehen, so Philipp Helberg, stellvertretender AStA-Vorsitzender. StuPa-Präsident Erik von Malottki ergänzte, dass Kanzler Dr. Wolfgang Flieger einen Raum auf dem neuen Campus Beitz-Platz für den AStA als zusätzlichen Anlaufpunkt sucht, jedoch warte er dort auf ein genaues Konzept des AStA. Weiterhin berichtete Erik von einem Demokratiefest, mit dem sich die Gegner den Nazis entgegenstellen wollen und näher an die Route der Neonazis wollen, die am 1. Mai durch durch Greifswald marschieren wollen. Kilian Dorner, Referent für politische Bildung, kündigte an, dass sich der AStA an Gegenaktionen beteiligen werde.
Wieder Probleme in der Geschichte?

StuPa-Präsident Erik von Malottki hofft, dass die Probleme in der Geschichte nicht zunehmen.
Weiter ging es in der Tagesordnung mit den Berichten der Referenten. Die Vorbereitungen für die Sportwoche vom 16. bis 22. Mai mit Basketball, Badminton, Wassersport, Beachvolleyball und Fußball sollen in den nächsten Tagen abgeschlossen werden, erzählte Ekaterina. StuPa-Präsident Erik hatte eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Er berichtete von Problemen am Historischen Institut. Im LSF-System, über das sich die Studierenden zu Lehrveranstaltungen anmelden müssen, seien Mittelaltermodule schon ausgebucht gewesen und Studenten wegen Überbelegung wieder nach Hause geschickt worden seien. Der Fachschaftsrat sitze am Thema dran. Die gute Nachricht: Von den rechtswidrig erhobenen Rückmeldegebühren wurden bisher 250.000 Euro nicht abgerufen und die Rückforderung verjährt Ende Dezember 2011, sodass dann das Geld in die Verbesserung der Uni gesteckt werden könne, an dessen Verwendung die Studierendenschaft beteiligt werde.
StuThe zieht wahrscheinlich in die Mehring-Straße
Weiterhin berichtete Philipp, dass das Studententheater (StuThe) nicht in der Falladastraße 2 bleibt, sondern wahrscheinlich in die Franz-Mehring-Straße zieht. Am 13. April gebe es einen Termin mit Jura-Professor Wolfgang Joecks und dem Finanzamt, wo es um die Behandlung von Aufwandsentsschädigung der Referenten geht. Referentin für Studienfinanzierung Susann verwies auf eine Veranstaltung mit dem Studentenwerk im Mai, auf der komplizierte Fälle in der Studienfinanzierung dargestellt werden sollen.

Sozialreferent und stellvertrender AStA-Vorsitzender Philipp Hellberg.
Wie wird mit Anträgen verfahren, mit dieser Fragestellung bereitet unter anderem Franz Küntzel, Referent für Hochschulpolitik, das kommende StuPa-Wochenende beispielweise mit Anträgen zum Üben vor. Ökologiereferentin Stefanie Juliane Pfeiffer will demnächst eine Recycling-Station im AStA-Büro einrichten, wo Studenten dann leere Batterien oder nicht mehr funktionsfähige Glühlampen abgeben können. Die Entsorgung werde von den Hausmeistern übernommen.
Vakante Referate nachbesetzt
Ein paar Wahlen rundeten die Sitzung noch ab. Nach den Rücktritten von Jens Pickenhan (Fachschaften und Gremien) und Sabine Wirth (Regionale Vernetzung und Geschichte) wurden die vakanten Referate nachbesetzt. Franz ist jetzt auch für die nächsten Wochen noch für Fachschaften und Gremien zuständig, Stefanie für Sabines Referat. Den durch den Rücktritt von AStA-Vorsitzenden Daniela Gleich freigewordenen Posten vertritt der stellvertretende AStA-Chef Philipp kommissarisch.
Fotos: David Vössing