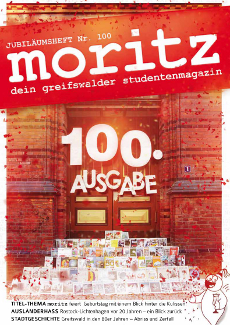von moritz.magazin | 03.12.2012
 Das Landgericht Köln hat in seinem berühmten Urteil vom 7. Mai 2012 die religiöse Beschneidung als rechtswidrige Körperverletzung bewertet. moritz suchte in Greifswald nach verschiedenen Meinungen – diesmal von einem Juristen.
Das Landgericht Köln hat in seinem berühmten Urteil vom 7. Mai 2012 die religiöse Beschneidung als rechtswidrige Körperverletzung bewertet. moritz suchte in Greifswald nach verschiedenen Meinungen – diesmal von einem Juristen.
Professor Sowada, wann haben Sie von diesem Urteil zum ersten Mal gehört?
Ich vermute, dass ich Ende Juni davon in einer Tageszeitung gelesen habe. Also mit Einsetzen der Diskussion in den Medien und der Öffentlichkeit.
Ein Schöffengericht des Landesgerichts hat das Urteil gefällt – wie läuft so etwas ab?
Nachdem in der ersten Instanz das Amtsgericht den Vorgang als straflos bewertete und den muslimischen Arzt freigesprochen hatte, legte die Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil Berufung ein. Zuständig war hierfür die Kleine Strafkammer am Landgericht, die mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Laienrichtern, den sogenannten Schöffen, besetzt ist, die keine Juristen sind. Das Gericht stellte eine rechtswidrige Körperverletzung fest, sprach aber den Beschneider frei, da er sich – wie wir Juristen sagen – im unvermeidbaren Verbotsirrtum befand.
Wie kommt so etwas dann in die Öffentlichkeit?
Teilweise können Gerichte ihre Entscheidungen in juristische Datenbanken einstellen oder an Fachzeitschriften zur Veröffentlichung einsenden. Im vorliegenden Fall ist aber auch die Fachwelt aus den allgemeinen Medien auf das Kölner Urteil aufmerksam geworden. Das könnte in der Weise in Gang gekommen sein, dass das Gericht oder die Staatsanwaltschaft entweder an einen Journalisten oder an einen Rechtswissenschaftler herangetreten ist, der sich zuvor für die Strafbarkeit der Knabenbeschneidung eingesetzt hat. Die juristische Fachdiskussion ist im Jahre 2008 in Gang gekommen; sie wurde vor allem durch einen Beitrag des Strafrechtsprofessors Holm Putzke in der Festschrift für seinen akademischen Lehrer, Professor Rolf Dietrich Herzberg, ausgelöst.
Holm Putzke ist auch medial präsent; wissen Sie warum ihn das Thema so interessiert?
Meines Wissens ist das Interesse an dem Thema aus einem Gesprächskreis um Professor Herzberg hervorgegangen. Hierbei könnte auch der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass die gesetzliche Entwicklung zu einer Stärkung der Kindesinteressen und einer strengeren Beurteilung elterlichen Handelns geführt hat. Vor dem Hintergrund dieser Strenge mag man die fortdauernde Duldung der Beschneidungspraxis als ungereimt ansehen.
Inwieweit ist die Beurteilung elterlichen Handelns verschärft worden?
Im Jahre 2000 wurde mit der Änderung des §1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung festgeschrieben und bestimmt, dass körperliche Züchtigungen durch die Eltern nicht mehr erlaubt sind.
Gab es vor dem Kölner Urteil kein juristisches Interesse an diesem Thema?
Das war doch recht überschaubar. Es wurden einige Fachaufsätze veröffentlicht. Aber es ist wie immer – wo kein Kläger, da auch kein Richter. Wenn die Eltern mit dem betroffenen Jungen im Kölner Fall nach der Komplikation wieder zu dem muslimischen Arzt gegangen wären, hätte dieser das Kind sicherlich gut behandelt und sich aber auch nicht selbst angezeigt. Es muss erst zu einem kultur-übergreifenden Zusammenwirken kommen, bei dem irgendjemand sagt, das geht doch aus Sicht des Kindeswohls nicht. Wenn die Beteiligten kein Problem damit haben, wer sollte es dann auch anzeigen? Es ziehen ja keine Staatsanwälte durch Köln, auf der Suche nach Beschneidungsopfern, das versteht sich.
Welche Wirkung hat das Urteil jetzt eigentlich, wenn doch Gerichte nicht an dieses gebunden sind?
Juristisch hat es bloß die Konsequenz, dass der Arzt in dem konkreten Fall freigesprochen wurde, es hat keine rechtlich verbindliche Leitwirkung. Jedes Gericht in Deutschland müsste für sich seinen Fall anhand der gleichen Rechtsnormen bewerten und könnte natürlich zu einem anderen Urteilsergebnis kommen. Obwohl also eine juristische Bindungswirkung für andere Fälle fehlt, kommt dem Urteil aber dennoch eine gewisse faktische Ausstrahlungswirkung zu. Zunächst einmal wird die Beschneidungsdiskussion aus dem Bereich einer rein akademischen Kontroverse in die Rechtswirklichkeit gehoben. Und in der öffentlichen Wahrnehmung entsteht der Eindruck, durch dieses einzelne Urteil habe sich die Rechtslage in Deutschland gewandelt im Sinne eines Umschwenkens der Rechtsprechung von einem ehemals straffreien Zustand in die Strafbarkeit. Die Richter konnten damals aber nur den ihnen vorgelegten Fall für sich entscheiden und nicht mit Blick auf die Konsequenzen Rücksicht nehmen oder die Konsequenzen scheuen.
Hat Sie die Debatte zu diesem Thema überrascht?
Mich hat das Urteil überrascht. Bislang wurde es geduldet und das war auch internationaler Standard. Mir ist auch kein Urteil bekannt, das die Knabenbeschneidung explizit erlaubt. Das Thema war ein weißer Fleck auf der juristischen Landkarte. In der momentanen Phase nach dem Urteilsspruch ist es eine rechtliche Grauzone.
Der aktuelle Gesetzesentwurf bezieht sich auf das Sorgerecht der Eltern. Wurde aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg gefunden?
Erst einmal kommt die Religion als Rechtfertigungsgrund so nicht mehr vor. Sie ist der Anknüpfungspunkt gewesen, warum der Gesetzgeber überhaupt erst darüber nachgedacht hat. Nun wäre anzunehmen gewesen, dass der Gesetzgeber eine Beschneidung aus religiösen Gründen erlaubt. Inzwischen darf man das grundsätzlich aus allen Gründen. Es sollte so sicherlich der Eindruck einer religiösen Sonderregelung vermieden werden.
Was wäre aus Ihrer Sicht geschehen, wenn der Gesetzgeber sich für eine Strafbarkeit ausgesprochen hätte?
Vermutlich wäre die Zahl der Beschneidungen zurückgegangen, aber wohl nicht auf Null gesunken, was irgendwann ein Strafverfahren nach sich gezogen hätte. Dagegen würden dann die Betroffenen den Rechtsweg ausschöpfen und geltend machen, in ihrem Grundrecht auf Religionsfreiheit und in ihrem Erziehungsrecht beeinträchtigt zu sein. Und das würde ziemlich schnell zum Bundesverfassungsgericht kommen. Die umgekehrte Variante, die sich jetzt abzeichnet, ist ungleich problematischer. Denn wir haben zwar jemanden, der nachteilig betroffen ist – das ist das Kind. Das Kind hat diese Klagemöglichkeit nicht, oder nur vermittelt über die Eltern, welche diesen Schritt aber nicht gehen werden.
Würden Sie dem Urteil zustimmen?
Die Knabenbeschneidung erfüllt unzweifelhaft den Tatbestand einer Körperverletzung, die spannende Frage ist, ob es eine rechtswidrige Körperverletzung ist. Gewiss dürfen Eltern in medizinisch indizierte ärztliche Heileingriffe einwilligen. Um solche handelt es sich bei rein religiös motivierten Beschneidungen aber nicht, da ihnen jegliche Heilfunktion fehlt. Die oft genannten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für eine Beschneidung beziehen sich auf die HIV-Vermeidung. Sie können aber nicht als Argument für die Knabenbeschneidung herangezogen werden, da der sexuelle Übertragungsweg in diesem Alter noch gar nicht gegeben ist. Ein Aufschub wäre also bis zur Entscheidung des Jungen zu Beginn der Pubertät insoweit ohne Weiteres möglich. Nach meiner Einschätzung ist dieser Eingriff schwerer, als ich es früher wahrgenommen habe. Ich hielt es eher für einen „Sturm im Wasserglas“, wenn ich ehrlich bin. Und da würde ich heute sensibler herangehen. Aber ich halte es anderseits – im Gegensatz zur ganz eindeutig unzulässigen Genitalverstümmelung bei Mädchen – nicht für eine so evident schlimme Situation, dass ich sagen würde, es dürfe dort überhaupt kein Zugeständnis geben. Für die Entscheidung des Gesetzgebers spielen ganz sicher auch politische Überlegungen eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang ist der gesamte Fragenkreis einer gelingenden Integrationspolitik berührt. Aber ein schlechtes Gefühl bleibt, da der Preis für die Toleranz, die wir den religiösen Vorstellungen der Eltern entgegenbringen, nicht von Ihnen oder mir, sondern von den betroffenen Kindern zu zahlen ist. Und es sollte auch nicht übersehen werden, dass die Kinder keine politische Stimme haben, ihre Grundrechte zu artikulieren.
Ein Interview von Daniel Focke
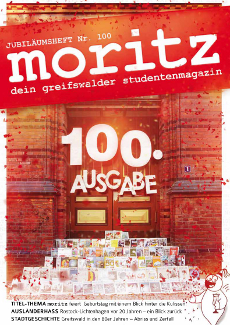
von moritz.magazin | 28.10.2012
Die Sektkorken knallen
 Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Leserinnen und Leser,
vor genau 14 Jahren hat das Studentenmagazin moritz zum ersten Mal die Druckerei verlassen. Es wurden die neuen Erstsemester in Greifswald begrüßt und im jetzigen Heft – der Nummer 100 – können wir das auch wieder tun: Herzlich willkommen, lieber Erstsemster. So schließen sich manchmal die Kreise einfach perfekt, als wenn es geplant wurde. Anlässlich unseres Jubiläums erlauben wir uns ein Magazin, in dem sich zu großen Stücken um uns selbst dreht.
Viele Wechsel in der Redaktion prägten die Geschichte des moritz, sodass es regelmäßig zu Veränderungen kam. Einige Redakteure begleiteten das Magazin sehr lange, wie zum Beispiel der erste Chefredakteur Mirko Gründer, mit dem ihr ein Interview im Heft findet. Seit der Einführung des Bachelorstudiums dreht sich das Personalkarussell allerdings deutlich schneller, da die meisten nur noch einige Jahre in Greifswald zum Studieren verweilen. Aber auch in dieser Zeit finden sich treue Seelen, die den moritz lange prägten oder es noch immer tun. Leute kommen und gehen, genauso die Themen – immer wieder tauchen Themen auf, die Studenten schon vor einigen Jahren beschäftigt haben und jetzt wieder. Ein paar alte Leckerbissen haben wir zusammengesucht und noch einmal abgedruckt.
Deutlich dicker ist das Heft, das ihr heute in der Hand haltet. Mit den Umschlagsseiten kommen wir genau auf die 100 Seiten – passend zum Anlass. Vor allem, damit wir uns erlauben können, soviel über uns zu schreiben, aber auch mit dem Ziel, euch trotzdem Themen über die aktuelle Hochschulpolitik, das Unileben, Ereignisse in Greifswald und aktuelle Rezensionsschmankerl liefern zu können.
Vor zwei Jahren hielt ich selbst zum ersten Mal einen moritz in meinen Händen und bin seit dem begeistert, dass Magazin mit gestalten zu können. Eine deutliche Entwicklung hat in all den 14 Jahren, aber auch alleine in den letzten beiden stattgefunden und ich hoffe, dass es so weiter geht. Es ist schön, dass wir an unserer Universität starke und geförderte studentische Medien haben, bei denen sich viele ausprobieren können. Ein jeder bringt neuen Impulse und davon lebt der moritz. Diese Möglichkeit sollte weiter geboten werden und wir wünschen uns jederzeit viele und neue motivierte Studierende, die ihren Ideen freien Lauf lassen wollen.
Blättert fröhlich durch, auf dass für jeden Geschmack etwas dabei ist und ihr alle gut in das Semester startet. Dem moritz wünsche ich alles Gute für die nächsten 100 Hefte und dass das Personalkarussell immer gut bewältigt werden kann und es weiterhin nie langweilig in der Redaktion wird.
Johannes Köpcke
Das komplette Heft als pdf gibt es hier, einzelne Artikel können wie immer auch online gelesen und kommentiert werden.
von moritz.magazin | 28.10.2012
Einst war Ducherow ein wichtiger Industriestandort der Region, heute verlassen viele Menschen den Ort. Mit der Universität Greifswald startete die bevölkerungsreichste Gemeinde im Amt Anklam nun ein Projekt, das zum bleiben anregen soll.
 Nächster Halt – Ducherow – Ausstieg in Fahrtrichtung rechts“, hört man die blecherne Computerstimme aus dem Lautsprecher des Doppelstockzuges aus Richtung Stralsund ertönen. Kurz bevor der Zug zum Stehen kommt, fährt er an einem ziemlich großen, verrotteten Bahnhofsgebäude vorbei. Einstmals herrschte hier reger Betrieb, schließlich zweigte hier die Hauptbahn nach Swinemünde ab, die 1945 in Folge der Sprengung der Karminer Brücke eingestellt werden musste. Die Bedeutung des Bahnhofes sorgte dafür, dass sich auch der eine oder andere Betrieb ansiedelte.
Nächster Halt – Ducherow – Ausstieg in Fahrtrichtung rechts“, hört man die blecherne Computerstimme aus dem Lautsprecher des Doppelstockzuges aus Richtung Stralsund ertönen. Kurz bevor der Zug zum Stehen kommt, fährt er an einem ziemlich großen, verrotteten Bahnhofsgebäude vorbei. Einstmals herrschte hier reger Betrieb, schließlich zweigte hier die Hauptbahn nach Swinemünde ab, die 1945 in Folge der Sprengung der Karminer Brücke eingestellt werden musste. Die Bedeutung des Bahnhofes sorgte dafür, dass sich auch der eine oder andere Betrieb ansiedelte.
Die vorpommersche Landgemeinde begann, sich in ein kleines Industriedorf zu verwandeln. Doch von all der Bedeutung ist in Ducherow nicht viel übrig geblieben. Die Arbeitslosigkeit stieg, nicht zuletzt, nachdem die Ziegelei schließen musste. Immer mehr Menschen verließen das Dorf. Diejenigen, die blieben, fühlen sich mit ihren Problemen häufig allein gelassen. Viele der Träume, die in Ducherow 1990 geträumt worden sind, wurden inzwischen längst von der Realität eingeholt. Doch den Kopf in den Sand stecken, um sich mit der schwierigen Situation einfach so abzufinden, wollen die Bewohner der Gemeinde auch wieder nicht. (mehr …)
von moritz.magazin | 28.10.2012
Kürzere Studienzeiten, höhere Mobilität und vergleichbarere internationale Abschlüsse waren die Ziele der Bologna-Reform. Diese werden von den Studiendekanen in einer Bilanz begrüßt, aber die Umsetzung lief alles andere als glatt.
Vor etwa zehn Jahren wurde in Deutschland damit begonnen, die alten Diplom- und Magisterstudiengänge in modularisierte Bachelor- und Masterstudiengänge umzustellen, wie sie schon vorher in den USA oder Großbritannien zu finden waren.
Forderung nach mehr Landesmitteln
Es gibt Kritik an der Bologna-Reform. Der Begriff „Bulemie-Lernen“ geht umher. Für Studenten ist der Übergang zwischen Bachelor und einem Master schwierig. So bekam Felix Scharge (Biochemie) erst eine Absage, dann aber doch eine Zusage, weil sich von den auswärtigen Studienbewerbern nur wenige einschrieben. Wie aber sehen die Fakultäten die Bologna-Reform?

Das Logo zum Bologna-Prozess
Die Philosophische Fakultät gehörte zu den Vorreitern der Bologna-Reform. Bis auf das Lehramt wurden alle anderen Studiengänge auf Bachelor und Master umgestellt. Studiendekan Prof. Patrick Donges befürwortet die Reform, „weil sie Lehre transparenter und verlässlicher macht“. Jedoch sieht er als Hauptproblem zur Verbesserung der Studienbedingungen die „immer prekärer werdende finanzielle Ausstattung“ seiner Fakultät mit dem Verlust von zahlreichen Professuren und Instituten. Um die chronische Unterfinanzierung zu bekämpfen, fordert er mehr Landesmittel. Bis 2014 sollen die Bachelor-Teilstudiengänge besser verzahnt, der Master durch integrierte Masterstudienprogramme attraktiver und die modularisierten Lehramtsstudiengänge reibungslos umgesetzt werden. (mehr …)
von moritz.magazin | 28.10.2012
Zwölf Jahre war er der Dekan der hiesigen Universitätsmedizin: Professor Heyo Klaus Kroemer. Er verließ Greifswald zum 1. September und leitet nun die Universitätsmedizin Göttingen. Mit moritz blickt er zurück und nach vorn.

Professor Heyo Klaus Kroemer (52) ist der ehemalige Dekan der Universitätsmedizin Greifswald
Wie sah die Situation der Medizinischen Fakultät aus, als Sie nach Greifswald kamen?
Greifswald war 1998 in der Medizin noch nicht sehr gut aufgestellt, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. In den Kliniken gab es vielfach keine leitenden Ärzte, weil die Berufungsverfahren nicht funktioniert hatten. Die Gesamtbedingungen der Medizin waren sehr, sehr schwierig. Man hat ja 1999 in dieser Not überlegt, diese Medizin zu privatisieren, sich dadurch der Investitionsmaßnahme zu entledigen und die Verantwortung jemand Privatem zu übergeben. Es wurde seinerzeit vom damaligen Rektor, Kanzler und ärztlichen Direktor betrieben. Ich glaube schon, dass man, bei allem Respekt vor den damaligen Kollegen sagen kann, dass die Medizin nur zum kleinen Teil wettbewerbsfähig gewesen ist. Wobei man auch sagen muss, und das ist das kleine Wunder an Greifswald, dass diese Medizin durch die Wende gekommen ist. Da gab es hier ein paar Leute, die es geschafft haben, dass die Landesregierung sagte: Wir machen die Medizin in Greifswald nicht zu, obwohl wir zwei Standorte im Land haben. Das ist das eigentliche, worüber man staunen kann, dass wir das OK aus Schwerin bekommen haben, die Medizin hier weiter zuführen.
Was war Ihre schwierigste Aufgabe als Dekan?
Durch den großen Zusammenhalt in der Medizin und der Universität konnte man Dinge, die sehr problematisch sind, in gemeinsamer Arbeit sehr gut erledigen. Wir haben zweimal die Rechtsformen weiterentwickelt: Früher war die Universitätsmedizin so was wie die Bibliothek. Dann wurde daraus eine Anstalt öffentlichen Rechts, die wirtschaftlich beweglicher war. Und nun im nächsten Schritt die Universitätsmedizin. Das waren schon größere Dinge. Was uns über die ganzen Jahre im Vorstand beschäftigt hat, war der komplette Neubau der universitären Medizin. Wenn Sie sich da in Deutschland umschauen, gibt es nicht so viele Standorte, die einen kompletten Neubau bekommen haben. Was ich auch glaube, was fundamental wichtig war: 1998 war es das Schlimmste, was Ihnen passieren konnte, wenn nach Hause ein Brief kam und sie hatten einen Medizinstudienplatz in Greifswald bekommen. Ja, es war der größte anzunehmende Unfall. Dadurch, dass der Studiendekan Klaus Heideke das ganze Studium sehr schnell umgestellt hat und wir uns wirklich intensiv um die Studierenden bemüht haben, ist die Nachfrage nach Studienplätzen wirklich explodiert. (mehr …)
 Das Landgericht Köln hat in seinem berühmten Urteil vom 7. Mai 2012 die religiöse Beschneidung als rechtswidrige Körperverletzung bewertet. moritz suchte in Greifswald nach verschiedenen Meinungen – diesmal von einem Juristen.
Das Landgericht Köln hat in seinem berühmten Urteil vom 7. Mai 2012 die religiöse Beschneidung als rechtswidrige Körperverletzung bewertet. moritz suchte in Greifswald nach verschiedenen Meinungen – diesmal von einem Juristen.