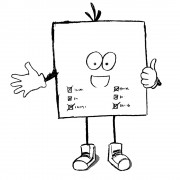von moritz.magazin | 28.01.2013
 „Deutsch für alle!“ – Studenten des Faches Deutsch als Fremdsprache geben für internationale Studierende und Asylbewerbern Deutschunterricht und lernen so die Welt der Integration kennen.
„Deutsch für alle!“ – Studenten des Faches Deutsch als Fremdsprache geben für internationale Studierende und Asylbewerbern Deutschunterricht und lernen so die Welt der Integration kennen.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Beziehungen zu internationalen Studierenden sowie Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, hat die Referentin des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) Christin Weitzmann das Projekt „Regenbogen“ im Dezember 2011 ins Leben gerufen. Nach einem Jahr der Planungs- und Vorbereitungsphase wurde das Vorhaben im letzten Jahr vorgestellt. Das Projekt richtet sich vor allem an Studierende des Faches Deutsch als Fremdsprache (DAF), die sich die Arbeit auch im Rahmen des Bachelor-Pflichtpraktikums anerkennen lassen können.
Unter dem Motto: „Deutsch für alle!“ geben die Studierenden im Lektorat des Studienkollegs und im Flüchtlingsheim Greifswald Deutschunterricht. Im Lektorat werden Konversationskurse angeboten, im Flüchtlingsheim gibt es verschiedene Angebote wie einen Alphabetisierungskurs, ein Deutsch-Anfängerkurs und eine Hausaufgabenhilfe für Kinder.
Sichtstunde im Lektorat
Für die Gestaltung des Deutschunterrichts sind die DAF-Studenten selbst verantwortlich. Sie treffen die Entscheidung über den Inhalt und den Aufbau. Trotz der hohen Eigenverantwortung, die die Studierenden tragen, sind sie nicht völlig auf sich alleine gestellt. So werden ihnen Unterrichtsmaterial und Leitfäden zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter des Lektorats kommen sogar zur Sichtstunde, bewerten die „Deutschlehrer“ und geben Verbesserungsvorschläge. Inhaltlich werden das Studium, der Alltag und die Kultur in Greifswald thematisiert, auch der Umgang mit den Behörden wird besprochen. Gerade für die Kursteilnehmer im Lektorat ist es von Bedeutung, da sie sich entweder auf ein Studium in Deutschland vorbereiten oder erst noch dafür qualifiziert werden müssen.
Neben der Didaktik machen die Studierenden eine ganz andere Erfahrung. Unterschiedliche Kulturformen, wie die Kultur Afrikas oder des Orients, treffen im Flüchtlingsheim aufeinander, dem gegenüber steht die eigene Kultur, die die Studierenden mitbringen – das kann zunächst einmal eine ziemlich beängstigende oder überfordernde Aussicht sein. Aus diesem Grund werden die infrage kommenden Studenten durch das Flüchtlingsheim geführt, bevor sie dort anfangen, Deutsch zu unterrichten. So wird eine erste Vertrautheit mit der Situation der Asylanten hergestellt, die dann eine Vertrauensbasis für die ersten Unterrichtsstunden bietet. Sollten dennoch Berührungsängste bei den Studierenden bestehen, so werde diese durch die freundliche Atmosphäre schnell beseitigt, erzählt Christin. Die Bewohner kommen alleine auf einen zu, vor allem diejenigen, die schon ein bisschen Deutsch können, um sich zu unterhalten.
Nach und nach nimmt das Gefühl der Fremdheit auf beiden Seiten ab. Zu vielen Gelegenheiten bringen dann beide Seiten einander die jeweils unvertraute Kultur nahe, wie durch gemeinsame Feste: Im Dezember organisierte der AStA eine kleine Weihnachtsfeier im Flüchtlingsheim. Hierfür haben die Mitglieder des Regenbogenprojekts Geschenke für die Kinder gesammelt und Plätzchen gebacken. Während die Plätzchen gut ankamen, waren die meisten Bewohner von der klassischen Weihnachtsmusik nicht so begeistert.
Im Flüchtlingsheim herrscht eine familiäre Atmosphäre
Ohne lange zu zögern haben die Bewohner den Studierenden ihre Musik nahe gebracht, die Kinder begannen zu tanzen. Musik verbindet. Bei Augenblicken wie diesen bleibt es nicht, auch in vielen alltäglichen Situationen in den Kursen merkt man deutlich, dass viele Bewohner Interesse zeigen. „Man kann regelrecht sagen, dass nicht die Flüchtlinge integriert werden, sondern wir Deutschen“, erzählt Christin. Aufgrund der familiären Atmosphäre bleiben einige DAF-Studenten nach ihrem Praktikum ehrenamtlich dabei.
Dennoch bleibt es wichtig, dass die DAF-Studenten lernen, das aufgebaute Vertrauensverhältnis auf einer professionellen Ebene zu gestalten. „Man muss nur ab und zu den Punkt finden, wo man sagt, jetzt ist gut. Einige kommen dann auch und wollen etwas erklärt haben oder eine Beratung, das dürfen wir nicht“, so Christin.

Für jedes Kind gab es Geschenke, auch für die Kleinen
Insgesamt kommt das Projekt „Regenbogen“ bei den Bewohnern sehr gut an. Natürlich erreicht man nicht jeden, aber ein Anfang ist gemacht und „eigentlich hätte es mittlerweile zum Selbstläufer werden können“, berichtet die AStA-Referentin. Doch der Betreiberwechsel des Flüchtlingsheims durch European Homecare im November 2012 sorgte bei den Mitgliedern des DAF-Projekts für Unruhe. Das Weiterbestehen des Projektes blieb lange fraglich. Während die Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und früheren Mitarbeitern sehr gut verlief, hat das Programm des DAF-Projekts eine Umstrukturierung erfahren. Die vielen Unsicherheiten haben dazu geführt, dass nicht mehr die Mitarbeiter des Flüchtlingsheims die Unterrichtsstunden für die Studierenden bestätigen. „Der Kontakt zu den früheren Mitarbeitern war ein bisschen familiärer, deswegen konnte man das besser nachvollziehen“, erzählt Christin. Nun handhabt man die Angelegenheit wie im Lektorat, wo die DAF-Studenten von allen Teilnehmern nach jeder Unterrichtstunde eine Unterschrift bekommen. Ist ihre Pflicht erfüllt, können sie damit zum Lektorat gehen und sich eine Praktikumsbestätigung holen; für die Arbeit im Flüchtlingsheim macht das vorläufig der AStA. Auch in Zukunft wird man im Flüchtlingsheim Deutschunterricht geben können, die Kurse zur Hausaufgabenhilfe für die Kinder sollen sogar ausgeweitet werden. Nur um das Lektorat ist es nicht gut bestellt. Die Kurse werden zu wenig besucht. Dafür gibt es erfreuliche Nachricht aus Wolgast: Nach mehrfachen Anfragen hat man beschlossen, dass DAF-Projekt Regenbogen auf das Flüchtlingsheim in Wolgast auszuweiten.
Ein Feature von Preciosa Alberto; Bilder von Charlotte Saebsch
von moritz.magazin | 28.01.2013
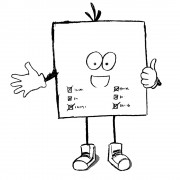 Einige unter uns wissen, wie es sich anfühlt das Studierendenparlament (StuPa) zu wählen, doch wie wirkt dieses Spektakel aus der Sicht eines Wahlzettels? moritz hat exklusiv nachgeforscht und offenbart die Wahrheit. Ein Erfahrungsbericht.
Einige unter uns wissen, wie es sich anfühlt das Studierendenparlament (StuPa) zu wählen, doch wie wirkt dieses Spektakel aus der Sicht eines Wahlzettels? moritz hat exklusiv nachgeforscht und offenbart die Wahrheit. Ein Erfahrungsbericht.
Früher war ich mal ein großer Baum, jetzt bin ich nicht mehr so schön anzuschaun. Als rotes Blatt Papier warte ich hier im Drucker geduldig darauf als Wahlzettel in die große Welt zu ziehen, denn ich bin zu etwas Großem bestimmt: Ich werde ausziehen um dem Volk eine Stimme zu geben.
In großen Kartons verpackt geht es nach dem Passieren der bösen Tintenstrahler Richtung Uni-Hauptgebäude. Ich wäre gerne noch ein wenig weiter gereist, aber als kleiner Zettel hat man da kein Mitspracherecht.
Gott, herrscht hier ein Trubel. Warum sind die denn alle so aufgeregt? Als Zettel kann ich diesen ganzen Tumult nicht so ganz nachvollziehen, geht doch sowieso kaum jemand zu so einer Wahl. Dementsprechend kehrt bereits nach wenigen Minuten die gewohnte Ruhe ein, schließlich wird Konzentration und Ernsthaftigkeit in solch entscheidenden Momenten erwartet. Immer wieder bilden sich kleine Schlangen mit Wahlmutigen vor dem großen Tisch, auf dem ich nun schon eine kleine Weile ausharre, doch eine Massenwahl will sich nicht einstellen. Schlafen die faulen Studenten etwa alle noch oder lockt bereits die Bibliothek? Fehlendes Interesse möchte ich nun wirklich niemandem andichten.
Nach zwei Tagen bin ich endlich an der Reihe. Studierendenausweis und ein Häkchen in der Namensliste, Ordnung muss schließlich sein. Dann werde auch ich endlich in die Wahlkabine getragen. Die Entscheidung fällt nach ein paar prüfenden Blicken scheinbar nicht schwer. Einige der gesetzten Kreuze gefallen mir gar nicht, doch wieder gilt das Schweigegebot der Zettel.
Vor dem nächsten Schritt bangt es mir: Zusammengefaltet in eine dunkle Urne geworfen werden, das ist kein Vergnügen. Langsam aber stetig wird die Luft über mir dünner und der Zettelberg immer größer. Die Menschen um mich herum freuen sich anscheinend darüber. Mir wird es allerdings langsam ein wenig eng. Kurz vor dem Ersticken wird der Deckel geöffnet.
Hui, ist das ein Spaß mit den anderen Zetteln aus der Urne auf einen großen Tisch zu fliegen, fast wie auf den großen Fließbändern in der Papierfabrik, ein bisschen muffig riecht es hier dennoch. Nun ist aber Schluss mit lustig, es geht ans Auszählen. Schweigend und emsig machen sich die Helfer daran Stapel zu bilden, Strichlisten zu führen und über wohl lustig gemeinte Stimmabgaben zu stöhnen. Ein paar meiner Freunde hat es schlecht getroffen, ihr Mensch hat sie zu einem ungültigen Wahlzettel gemacht und das bedeutet Schredder. Manchmal höre ich sie nachts immer noch schreien.
Mir bleibt dieses Schicksal glücklicherweise erspart und das Ergebnis steht nun nach einer aufregenden Woche fest. Mein Job ist erledigt und das StuPa mit einem Prozent mehr Wahlbeteiligung neu besetzt. Ich erhole mich nach diesem Stress erst mal auf den Bahamas und wer weiß, vielleicht trifft man sich ja mal als Recycling-Papier wieder.
Eine Investigativ-Reportage von Lisa Klauke-Kerstan
von moritz.magazin | 28.01.2013
 An der Philosophischen Fakultät wird ein integrativer Master entwickelt: Kultur-Interkulturalität-Literatur mit einem Schwerpunkt in Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Skandinavistik oder Slawistik. Professor Joachim Schiedermair vom Institut der Skandinavistik arbeitet den Master mit aus.
An der Philosophischen Fakultät wird ein integrativer Master entwickelt: Kultur-Interkulturalität-Literatur mit einem Schwerpunkt in Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Skandinavistik oder Slawistik. Professor Joachim Schiedermair vom Institut der Skandinavistik arbeitet den Master mit aus.
Wie kam die Idee auf, einen neuen Master zu entwickeln?
Die Idee kam deshalb auf, weil wir – die philologischen Fächer der Philosophischen Fakultät – qualitativ sehr hochwertige Masterstudiengänge in den Bereichen Slawistik, Skandinavistik und Germanistik anbieten, sie aber nicht so angenommen werden, wie wir uns das wünschen. Wir wollten ein Angebot schaffen, das mehr Studierende nach Greifswald locken kann. Dazu brauchen wir ein Programm, in dem die philologischen Grundfächer in ihrer etablierten Struktur erhalten bleiben, das aber auch noch ein Plus bietet, das an anderen Universitäten nicht vorhanden ist. Deshalb haben wir zwei Komponenten neben der jeweiligen philologischen Säule eingebaut: Zum einen eine Kulturtheorie-Säule. In Gesprächen mit Studierenden haben wir gemerkt, dass diese zu Masterprogrammen abwandern, die Kultur- oder Literaturtheorie beinhalten. Zum anderen eine Interkulturalitäts-Säule. Diese wird vom Fachbereich Deutsch als Fremdsprache (DAF) bestückt, weil wir den Praxisaspekt steigern wollten. Damit bieten wir ein Starterpaket DAF, das die Absolventen befähigt, in verschiedenen Bereichen von Deutsch als Fremdsprache eigenverantwortlich zu arbeiten. Die Idee, DAF mit aufzunehmen, hatte noch einen weiteren Grund: Wir haben beobachtet, dass in Berlin das Masterprogramm DAF unglaublich stark nachgefragt ist. Es bewerben sich 200 junge Leute, aber es werden jährlich nur 20 für das Studium angenommen. Die Idee war, dass man von den 180 Leuten, die nicht angenommen werden, vielleicht 20 bis 30 nach Greifswald locken könnte.
Wer arbeitet an der Erstellung mit?
Zunächst mal die beteiligten Lehrstühle mit literaturwissenschaftlichem Schwerpunkt: Für die Anglistik/Amerikanistik Professor Domsch, in der Germanistik sind es die Professorinnen Schumacher, Unzeitig und Siebenpfeifer, in der Skandinavistik bin ich das und in der Slawistik ist das Frau Jekutsch. Außerdem waren der Mittelbau und die Studierendenvertreter der beteiligten Fächer zu allen Arbeitstreffen eingeladen. Alle Mails gingen immer an Vertreter aller Statusgruppen.
Seit wann arbeiten Sie daran?
Die Idee kam vor ungefähr anderthalb Jahren auf. Der Studiendekan Professor Donges war es, der erstmals Leute an den Tisch brachte, die Interesse an einem integrierten Master hatten. Daraufhin haben die damalige Prodekanin, Frau Unzeitig, und ich ein erstes Konzept für die Philologien erarbeitet: Wie verbindet man die vorhandenen Lehrstühle geschickt in einem Masterprogramm miteinander, sodass es gleichzeitig attraktiv für Studierende ist? Wir wollten mit dem Master auch nicht mit anderen norddeutschen Masterprogrammen konkurrieren, sondern eine Nische besetzen. Daraufhin kamen wir sehr schnell auf den dreisäuligen Aufbau. An die konkrete Ausarbeitung habe ich mich gemacht. Ich habe viele Gespräche geführt, da man erstmal bei den beteiligten Lehrstühlen Überzeugungsarbeit leisten musste. Im letzten Semester habe ich, sowohl mit den Beteiligten aus den Fächern als auch mit meinen Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl, intensiv an den notwendigen Papieren wie der Prüfungs- und Studienordnung gearbeitet.
Eckdaten des neuen Masters:
Beginn: voraussichtlich Wintersemester 2013/14
Einschreibung: jedes Winter- und Sommersemester
Voraussetzungen: kein Numerus Clausus, aber Sprachkenntnisse:
– Anglistik/Amerikanistik: mindestens C1-Niveau
– Skandinavistik: Sprachkenntnisse in mindestens einer skandinavischen Sprache mit mindestens B1-Niveau
– Slawistik: mindestens B2-Niveau
Für: in der Regel Studierende mit Bachelor of Arts-Abschluss in einer der Philologien, nach Absprache mit den jeweiligen Fachvertretern auch aus anderen B.A.-Studiengängen
Aufbau:
– vier Semester, wobei das vierte Semester der Masterarbeit vorbehalten ist
– drei Module und 30 Leistungspunkte (LP) pro Semester: Kulturtheorie 5 LP, Interkulturalität 10 LP, Philologie 15 LP
– drei Säulen im Studium:
Kulturtheorie: fächerübergreifend, Einführung in kulturwissenschaftliche Ansätze ( Inter- und Transkulturalität)
Interkulturalität: verbindet Kulturtheorien mit der Vermittlungspraxis von DAF (z.B. Lehre vom Fremden, Institutionslehre), DAF in der Praxis
Literatur und Kultur (abhängig von der Philologie): literaturwissenschaftliches Fachwissen
zusätzliche Möglichkeit des Austauschs eines Seminars von Literatur und Kultur mit einer praktischen Arbeit (wie der Mitarbeit beim polenmARkt, Nordischen Klang oder einer eigenen kulturellen Veranstaltung)
Ein Interview von Katrin Haubold; Portraitfoto von Katrin Haubold
von moritz.magazin | 28.01.2013
 Die Wahlen zum Studierendenparlament hielten wieder einige Überraschungen bereit. Unter anderem ziehen zwei Erstsemester in das Parlament ein. Welche Vor- und Nachteile sehen die Parlamentarier darin?
Die Wahlen zum Studierendenparlament hielten wieder einige Überraschungen bereit. Unter anderem ziehen zwei Erstsemester in das Parlament ein. Welche Vor- und Nachteile sehen die Parlamentarier darin?
Vom 14. bis 18. Januar fanden wieder die Wahlen zu den studentischen und akademischen Gremien statt. Dieses Mal konnten bis zu 21 Stimmen für den Senat, den jeweiligen Fakultätsrat und das Studierendenparlament (StuPa) abgegeben werden. Mit drei dieser Stimmen konnte jeder Student seinen Vertreter im StuPa wählen. Er konnte dabei aus 37 Kandidaten auswählen, für 27 öffnete sich letztendlich die Tür zum StuPa. Klare Wahlsiegerin, mit 565 abgegebenen Stimmen, wurde Steffi Wauschkuhn. Wie im vergangenen Jahr hat die diesjährige Siegerin noch keine Erfahrung im StuPa. Auch für den Zweitplatzierten Jan-Ole Schulz ist das StuPa Neuland, da er erst seit Oktober 2012 an der Universität studiert. Im zukünftigen StuPa werden nur mit den beiden Erstplatzierten die Universitätsmedizin und die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät vertreten sein. Die restlichen Stupisten kommen aus der Philosophischen oder der Rechts-und Staatswissenschaftlichen Fakultät, aus der Theologischen hatte sich von Vornherein kein Kandidat aufgestellt. An der Wahl beteiligten sich 1 871 Studenten. davon wurden 33 Stimmzettel vom Wahlausschuss als ungültig befunden. Insgesamt gaben 15,54 Prozent der Studierendenschaft ihre Stimme ab.
Mit der Wahlbeteiligung waren der Wahlleiter, Torben Brandt, sowie seine Stellvertreter Ea Warnck und Jan-Christoph Heins zufrieden: „Das ist ja eine Steigerung zum letzten Jahr“, so Torben. Schließlich war das Ziel, die 10-Prozent-Hürde zu knacken. Dieses Ziel hatten sie schon am Mittwoch erreicht und somit war die Wahl ein guter Erfolg. Natürlich hätte sich die Wahlleitung eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht, schließlich studieren an der Universität Greifswald mehr als 11 500 Studenten. Probleme gab es auch. „Für uns als Erstsemester war die Organisation des Ganzen schwieriger als für jemanden, der schon länger an der Uni studiert, denn wir kannten keinen anderen und auch keine Zuständigkeiten.“
Neue Leute, neue Ideen, neue Denkansätze?
 Nicht nur die Wahlleitung, sondern auch einige der Kandidaten begannen ihr Studium in Greifswald erst im jetzigen Wintersemester. Das wirft die Frage auf, inwieweit so junge Küken im StuPa etwas bewirken können oder ob es sinnvoller wäre, den alten Hasen den Vortritt zu lassen. „Meine Erfahrungen mit dem Verwaltungsapparat der Uni sind bislang sehr theoretischer Natur, dass ist schon ein Nachtteil“, erklärt Dietrich Wenzel, Stupist in der kommenden Legislatur und Student im ersten Semester. Vor allem das Erlernen und Verstehen von Formalien enthält für die jungen Küken großen Arbeitsaufwand, der neben dem Universitätsleben erarbeitet werden muss. „Gleichzeitig hoffe ich doch, dass meine Motivation noch etwas schwungvoller ist, als sie das vielleicht im fünften Semester wäre.“ Ebenso haben die neuen Stupisten eine unvoreingenommene und unverbrauchte Sicht auf aktuelle Themen, da sie sich in frühere Debatten nicht einmischen konnten beziehungsweise sie nicht miterlebt haben. Sie kommen mit unkonventionellen Denkansätzen, die ein neues Licht auf Situationen werfen. Die jungen Küken wollen mit frischem Elan schnell etwas erreichen. Jedoch kann sich aber Ernüchterung einstellen, da die Sitzungen viele formelle Aspekte enthalten. Gerade alte Hasen zeigen diesbezüglich mehr Geduld. Ein weiterer Aspekt sei, dass die Wahl zum Parlamentsmitglied denjenigen dazu verpflichtet, ein ganzes Jahr in Greifswald zu bleiben und sich aktiv am hochschulpolitischen Geschehen zu engagieren. „Ich denke, dass man im zweiten Semester eine Amtszeit im Gremium besser unterbringen kann als kurz vor dem Abschluss“, meint Dietrich. Gerade Studenten, die ein Auslandssemester planen, organisieren ihr Studium daraufhin. Eine Legislatur in späteren Semestern ist so kaum möglich.
Nicht nur die Wahlleitung, sondern auch einige der Kandidaten begannen ihr Studium in Greifswald erst im jetzigen Wintersemester. Das wirft die Frage auf, inwieweit so junge Küken im StuPa etwas bewirken können oder ob es sinnvoller wäre, den alten Hasen den Vortritt zu lassen. „Meine Erfahrungen mit dem Verwaltungsapparat der Uni sind bislang sehr theoretischer Natur, dass ist schon ein Nachtteil“, erklärt Dietrich Wenzel, Stupist in der kommenden Legislatur und Student im ersten Semester. Vor allem das Erlernen und Verstehen von Formalien enthält für die jungen Küken großen Arbeitsaufwand, der neben dem Universitätsleben erarbeitet werden muss. „Gleichzeitig hoffe ich doch, dass meine Motivation noch etwas schwungvoller ist, als sie das vielleicht im fünften Semester wäre.“ Ebenso haben die neuen Stupisten eine unvoreingenommene und unverbrauchte Sicht auf aktuelle Themen, da sie sich in frühere Debatten nicht einmischen konnten beziehungsweise sie nicht miterlebt haben. Sie kommen mit unkonventionellen Denkansätzen, die ein neues Licht auf Situationen werfen. Die jungen Küken wollen mit frischem Elan schnell etwas erreichen. Jedoch kann sich aber Ernüchterung einstellen, da die Sitzungen viele formelle Aspekte enthalten. Gerade alte Hasen zeigen diesbezüglich mehr Geduld. Ein weiterer Aspekt sei, dass die Wahl zum Parlamentsmitglied denjenigen dazu verpflichtet, ein ganzes Jahr in Greifswald zu bleiben und sich aktiv am hochschulpolitischen Geschehen zu engagieren. „Ich denke, dass man im zweiten Semester eine Amtszeit im Gremium besser unterbringen kann als kurz vor dem Abschluss“, meint Dietrich. Gerade Studenten, die ein Auslandssemester planen, organisieren ihr Studium daraufhin. Eine Legislatur in späteren Semestern ist so kaum möglich.
 Marian Wurm, ehemaliger StuPa-Präsident und einer der alten Hasen im neuen StuPa, führt an, dass gerade die Stupisten, welche in den Fachschaftsräten angefangen und sich von unten nach oben gearbeitet haben, die beste Arbeit leisten, da in den Fachschaftskonferenzen Themen behandelt werden, die die Studenten stärker beschäftigen. „Doch läuft man Gefahr, einfache Probleme nicht mehr zu sehen, mit denen die Studierenden im Uni-Alltag konfrontiert sind“,so Marian. Dieser langwierige Weg eignet sich jedoch kaum für Bachelor-Studenten, da diese nach Regelstudienzeit nur drei Legislaturen miterleben können. Aber für Studiengänge, die auf Diplom oder Staatsexamen hinauslaufen, scheint diese Methode ideal zu sein.
Marian Wurm, ehemaliger StuPa-Präsident und einer der alten Hasen im neuen StuPa, führt an, dass gerade die Stupisten, welche in den Fachschaftsräten angefangen und sich von unten nach oben gearbeitet haben, die beste Arbeit leisten, da in den Fachschaftskonferenzen Themen behandelt werden, die die Studenten stärker beschäftigen. „Doch läuft man Gefahr, einfache Probleme nicht mehr zu sehen, mit denen die Studierenden im Uni-Alltag konfrontiert sind“,so Marian. Dieser langwierige Weg eignet sich jedoch kaum für Bachelor-Studenten, da diese nach Regelstudienzeit nur drei Legislaturen miterleben können. Aber für Studiengänge, die auf Diplom oder Staatsexamen hinauslaufen, scheint diese Methode ideal zu sein.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Konstellation des kommenden StuPa auf die Beschlussfähigkeit auswirkt und ob alte und neue Parlamentarier eine produktive Kommunikation untereinander führen. Egal, ob man nun im zweiten Semester oder im zehnten Semester studiert: „Man muss sich auch seiner Verantwortung bewusst sein, immerhin verwaltet man die Beiträge aller Studierenden“, schließt Marian ab.
» Klare Ziele gesetzt «
Die Medizinstudentin Steffi Wauschkuhn ist die Wahlsiegerin der diesjährigen StuPa-Wahl. moritz sprach mit ihr über ihren Wahlerfolg und die Ziele, die sie im StuPa verfolgt.
Hast du mit dem Wahlerfolg gerechnet?
Ich freue mich sehr über das Wahlergebnis. Ich habe mir natürlich gewünscht in das Studierendenparlament (StuPa) oder den Senat, für den ich ja auch kandidiert habe, einziehen zu können. Aber mit diesem überraschenden Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Ich bin sehr froh, dass so viele ihr Vertrauen und ihre Stimme in mich gesetzt haben, obwohl ich hochschulpolitisch noch nicht in Erscheinung getreten bin.
Wieso bist du zur Wahl angetreten?
In meinen ersten beiden sehr lernintensiven Jahren in Greifswald hatte ich wenig Zeit, mich hochschulpolitisch zu engagieren. Durch mir bekannte Stupisten wurde allerdings mein Interesse daran geweckt. Jetzt nach meinem Physikum ist alles ein wenig entspannter, sodass nun die richtige Zeit für mein Engagement ist.
Was sind deine Ziele?
Als Ziel für StuPa und Senat habe ich mir auf die Fahne geschrieben: Die CO2-neutrale Uni, die auch ein Programmpunkt der Solidarischen Universität (Soli-Uni) ist, die Förderung der studentischen Kultur, momentan am präsentesten ist der Club 9, die Förderung und der Ausbau der Alleinstellungsmerkmale des Universitätsstandortes Greifswald und die stärkere Einbindung der Studenten in die Forschung.
Was erwartest du dir von deiner Arbeit im StuPa?
Durch hochschulpolitisch aktive Freunde war ich früher schon immer über die Arbeit des StuPa unterrichtet, welche Anträge gestellt wurden, wie die Sitzungen abgelaufen sind. Dadurch weiß ich, was mich erwartet. Die Soli-Uni-Liste hat viele Plätze sowohl im Senat als auch im StuPa erhalten. Wir haben uns klare Ziele gesetzt. Die Kommunikation läuft gut. Deshalb hoffe ich auf produktive Ergebnisse.
Ein Artikel von Anne Sammler und Corinna Schlun; Grafiken von Ann-Kathrin Barjenbruch
von moritz.magazin | 28.01.2013
 17 Sitzungen des Studierendenparlamentes gab es in dieser Legislatur bisher. Debatten, Anträge, Misstrauensvoten – alles war dabei. Doch was wird in Erinnerung bleiben?
17 Sitzungen des Studierendenparlamentes gab es in dieser Legislatur bisher. Debatten, Anträge, Misstrauensvoten – alles war dabei. Doch was wird in Erinnerung bleiben?
Wenn man sich die Wahlversprechen aus der letzten Legislatur des Studierendenparlaments (StuPa) einmal genauer anschaut, fällt eines besonders auf: Scheinbar hochschulgruppenübergreifend haben ein Großteil der Stupisten versprochen sich für den Ausbau und Verbesserung des Hochschulsportes, für eine bessere Vernetzung zwischen den einzelnen studentischen Gremien und für den Erhalt der studentischen Kultur ausgesprochen. Zusätzlich zu diesen Top drei der studentischen Forderungen gab es auch vereinzelte Exoten: So positionierte sich Gesa Geissel für eine Beachparty, aus dem Grünen-Lager wurden mehr Stellplätze für Fahrräder an den Uni-Gebäuden gefordert und selbst ein Semesterticket wurde für Greifswalder Studenten als wichtig empfunden, um aufgelistet zu werden. Es wurde viel versprochen, doch wie viele von diesen Vorhaben wurden in die Praxis umgesetzt?
Antrag für eine ökologische Mensa kam nicht von der grünen Hochschulgruppe
Ein Antrag auf eine ökologischere Mensa wurde überraschenderweise nicht von der Grünen Hochschulgruppe sondern vom Ring Christlich Demokratischer Studenten eingebracht. Dieser wurde inzwischen vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) ausgiebig bearbeitet und es fällt auf: Antragsteller Matias Bluhm ist noch am Ball und scheint immer noch Feuer und Flamme für dieses Projekt zu sein. Dass diese Entwicklung vom einem gegebenen Wahlversprechen bis zur tatsächlichen Umsetzung nicht als alltäglich angesehen werden kann, dürfte an dieser Stelle nicht überraschen, scheinen doch viele Stupisten das ein oder andere mal zu vergessen, dass sie ihren Wählern auch eine gewisse Pflicht gegenüber haben. Zu oft wurden Forderungen im Wahlheft verewigt, die scheinbar im Laufe der Legislatur keine Beachtung mehr fanden. So scheint es nie zu einer geforderten Prüfung eines Semestertickets gekommen zu sein. Da kommt die Frage auf, ob der eine oder andere Stupist es nicht am besten Patrick Schmidt hätte gleich tun sollen: Er verzichtete auf jegliche Zielaufzählungen im alten Wahlheft.
Dauerthema: „Studentenwerk-App mit Bezahlfunktion“
Natürlich wurden nicht alle Vorsätze liegen gelassen. Die Junge Union zum Beispiel forderte bereits auf ihren Flyern in diesem und im letzten Jahr eine „Studentenwerk-App mit Bezahlfunktion“. Die scheint sich jedoch als schwieriger realisierbar zu entpuppen als zuerst gedacht: Stadt, Uni und Studentenwerk planen alle, mehr oder weniger, eine eigene App. Nach Angaben von Christoph Böhm sollte mit dieser vor 2015 nicht mehr zu rechnen sein.
Aber nicht nur die einzelnen Forderungen der Hochschulgruppen haben die Sitzungen inhaltlich gefüllt. Ganz nebenbei hat sich die Studierendenschaft, vertreten durch das StuPa, für eine Diagonalquerung auf der Euroapkreuzung ausgesprochen, zahlreiche Satzungsänderungsversuche wurden unternommen und selbst ein Antrag auf eine eigene Hochschulimkerei wurde eingereicht. Es dürfte für jeden Geschmack was dabei gewesen sein.
Im StuPa-Alltag fehlte es oft an inhaltlichen Disputen. Manche Anträge wurden viel zu schnell abgenickt, wenige Nachfragen ließen immer wieder eine eher mäßige Sitzungsvorbereitung vermuten, wie bei den Konzepten zur Verwendung der unrechtmäßig erhobenen Rückmeldegebühren. So zeichneten sich immer die gleichen Akteure heraus. Besonders die erfahrenen Stupisten Christoph Böhm und Alexander Wilhelm Schmidt stachen mit ihren Redebeiträgen häufig hervor und wurden somit zu den Wortführern. Oft konnte man auch etwas von Fabian Schmidt, Marvin Hopf, Christopher Riemann oder Martin Grimm hören, wohingegen Oliver Gladrow, Gunnar Meiselbach, Daniela Gleich, Marc Wildschrei oder Max Pröbsting vor allem mit ihrer Abwesenheit glänzten. Ohnehin waren die meisten Sitzungen nicht voll besetzt, was die eine oder andere Entscheidung äußerst knapp werden ließ oder gar verhinderte, weil keine Mehrheit zustande kommen konnte.
Gerade einmal 22 Stupisten nahmen durchschnittlich an den Sitzungen teil
Mit Marco Wagner und Erik von Malottki mischten regelmäßig studentische Senatsmitglieder in den Debatten mit. Besonders bemerkenswert war Eriks energisches Eintreten gegen eine Satzungsreform, bei der er eine „Überregulierung“ befürchtete. Dabei konnte er schnell viele Stupisten von seiner Meinung überzeugen, gegen die Änderungen zu stimmen, wobei sich vorher eine klare Mehrheit abzeichnete.
Wenn man sich die Sitzungszeiten einmal genauer anschaut, fällt besonders eins auf: Gerade einmal sechs Überstunden, resultierend aus den Verlängerungen nach 24 Uhr – außerordentliche Sitzungen sind hier nicht mit einbezogen worden – hat sich dieses StuPa bis zum 04. Dezember 2012 erlaubt. Insgesamt wurden bis jetzt zwölf ordentliche und fünf ausserordentliche Sitzungen einberufen. 103 Anträge (davon sieben als Satzungsänderungsanträge) wurden eingereicht. Zum Vergleich: Das letzte StuPa (2011/2012) hat bis zum ähnlichen Zeitpunkt (06. Dezember 2011) mit zwölf ordentlichen, drei ausserordentlichen Sitzungen und insgesamt 101 eingereichten Anträgen, wovon vier Satzungsänderungsanträge jeglicher Art waren, einen ähnlichen Schnitt erreicht. Zu nennen sei an dieser Stelle auch, dass das StuPa- Präsidium wieder voll besetzt war. Neu-StuPist und gleich Neu-Präsident Milos Rodatos schaffte es, sich zwei Mitstreiter für das Präsidium zu suchen. Dabei waren beide zunächst keine Mitglieder im Parlament. Timo Neder gelang als Nachrücker zu einem Stimmzettel im StuPa und Emilia Bokov war nicht zur Wahl angetreten. Die stellvertretenden Präsidiumsmitglieder müssen nicht unbedingt auch gewählte Stupisten sein. Die Aufgabe vom Präsidium ist es vor allem, für einen reibungslosen Ablauf der Sitzungen zu sorgen. Der Präsident hatte das Plenum vorwiegend gut im Griff, und behielt bei den meisten Streitereien einen kühlen Kopf. Häufig mischte er selbst in den Diskussionen mit und war damit zweifellos der dritte Wortführer im Parlament; oft parteiergreifend und nicht immer sachlich, was ihm auch Kritik einbrachte.
Hochschulpirat als Präsident = mehr Transparenz?!
„Mehr Transparenz der Arbeit der Studentischen Gremien“ kündigte Milos in seiner Bewerbung an. Als Präsident hatte er die besten Voraussetzungen, dies auch zu erfüllen. So kündigte er in seinem Antrittsinterview mit moritz (mm98) an, anhand einer eigenen Internetseite „die Arbeit des Präsidiums transparent und nachvollziehbar darzulegen.“ Passiert ist hier nichts, Protokolle wurden viel zu spät und mit fragwürdiger Qualität veröffentlicht. Dafür fand der Präsident aber andere Stellen, in denen er sich bewähren konnte. Im Senat nutzte er ausgiebig sein Mitspracherecht und meldete sich als höchster Vertreter der Studierendenschaft häufig zu Wort.
Stellt sich die Frage, was zum Ende der Legislatur hin zusätzlich in Erinnerung bleibt. Es wurden zahlreiche Anträge auf Geheimabstimmungen als „Sternstunden der Demokratie“ bezeichnet, Antragsteller von Schliessung der Tagesordnungspunkte ohne Debatte und Endabstimmung als „Demokratieverweigerer“ benannt und das Wissen darüber kundgetan, welche Stupisten ihre Eltern verklagen würden und welche nicht.
Ein Bericht von Natalie Rath und Simon Voigt
 „Deutsch für alle!“ – Studenten des Faches Deutsch als Fremdsprache geben für internationale Studierende und Asylbewerbern Deutschunterricht und lernen so die Welt der Integration kennen.
„Deutsch für alle!“ – Studenten des Faches Deutsch als Fremdsprache geben für internationale Studierende und Asylbewerbern Deutschunterricht und lernen so die Welt der Integration kennen.