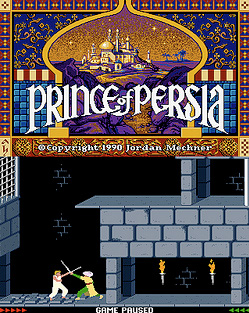von Arvid Hansmann | 15.06.2010
Es war die große Erzählkunst der schönen Schahrasad die den grimmigen König Schahriyar dazu brachte, sie nicht nach der ersten gemeinsamen Nacht zu töten, sondern tausend weitere Nächte ihren spannenden und aufregenden Geschichten zu lauschen, bis er ihr Gnade gewährte.
Und was sie in ihren weit verzweigten Erzählungen ausbreitete, hat sich wie das verschlungene Muster eines Teppichs über das Bild dessen gelegt, was nebulös mit „Orient“ überschrieben wird. Jene Erzählungen, über Jahrhunderte tradiert, transformiert und ergänzt, haben Imaginationen in Form, Farbe und Klang geschaffen, die in immer wieder neuen Stereotypen fixiert wurden. Selbst für die frühmittelalterlichen Araber waren viele Geschichten schon Exotismen, die sie von den Persern (Sassaniden) übernahmen.
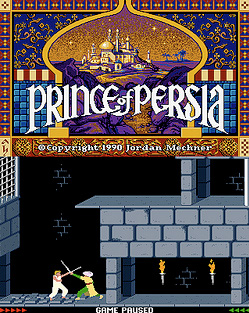
Das erste "Prince of Persia"-Computerspiel
Von jenen exotischen Stereotypen ließ sich auch der Spieleentwickler Jordan Mechner (geb. 1964) leiten, als der Ende der 1980er Jahre das Computerspiel „Prince of Persia“ entwarf. So abstrakt verpixelt und grobmotorisch die Szenerie und die einleitend untermalenden Klänge auch waren, sie genügten in ihrer Zeichenhaftigkeit, um die simple Rahmenhandlung vom inhaftierten Helden, der die Sultanstochter aus den Fängen des Bösen Großwesirs befreien muss, ausreichend zu unterstreichen, sodass eine fundierte Imaginationsfläche gegeben war. Den klar definierten Bewegungsabläufen des Protagonisten, dem Schematismus der Gefahren in den Labyrinthen der zwölf Level steht ein immer wieder auftretendes Überraschungsmoment gegenüber, dass auch vor Selbstironie nicht zurückschreckt.
Sicher war Schauspieler Jake Gyllenhaal (geb. 1980) in seiner Kindheit ebenso von diesem Spiel begeistert, was durch Trotz gegenüber dem möglichen väterlichen Vorwurf der „Volksverdummung“ noch unterstrichen wurde. Nun ist der selbst in die Rolle des Protagonisten geschlüpft und mag damit zu einer Imaginationsfigur der heutigen Jugend werden – zumindest, wenn die Rechung des Disney-Konzerns aufgeht.
„Sein oder nicht sein …“ – aber nichts mit „Play it again, Sam.“ (mehr …)
von Arvid Hansmann | 07.03.2010
Auch wenn ich das Filmprogramm wieder nur in bruchstückhaften Auszügen wahrnehmen konnte, so schien darüber in diesem Jubiläumsjahr der Grundtenor von „Gefangenschaft“ und „Befreiung“ zu schweben. Sei es der konkrete Umgang mit der dem Motiv der Haftanstalt, oder die Skizzierung sozialer Normen und Schranken, gegen die die Protagonisten ankämpften, an denen sie scheiterten, die sie überwanden.
„Und sperrt man mich ein
Im finsteren Kerker (…)“

Filmplakat "A somewhat gentle man"
Der norwegische Wettbewerbsbeitrag „En ganske snill mann“ („A somewhat gentle man“) von Hans Petter Moland stellte dabei mit seinem grotesk-lakonischen Humor eine gewisse Ausnahme dar, da die tragische Situation des entlassenen Schwerverbrechers – so viel sei verraten – in einem gewissen „Happy End“ der Frühlingssonne ausklingt. Um dem Klischee zu folgen, dass Verbrecher meist „Ausländer“ seien, besetzte Moland die Hauptrolle mit dem Schweden Stellan Skarsgård, der hier in seiner gebrochenen Vaterfigur an den „Fluch der Karibik“ erinnert.
Den digitalen Arabesken aus untotem Seemannsgarn steht hier aber die nüchtern-realistische Welt Skandinaviens gegenüber, die jedoch mit ihren schrägen Charakteren und „desperate housewives“ ebenso zu Amüsement und Gruseln einlädt: Dieser Film ist wärmstens für den „Nordischen Klang“ zu empfehlen!
In puncto Realismus ging der Rumäne Florin Şerban in „Eu cand vreu sa fluier, fluier“ („Wenn ich pfeifen will, dann pfeife ich“) noch einen Schritt weiter. Für die Geschichte eines jugendlichen Sträflings, die fast ausschließlich in der Barackenlandschaft einer Zuchtanstalt mit „agrarischer Ausrichtung“ spielt, wurden teils echte „Knastbrüder“ und Wärter eingesetzt. (mehr …)
von Arvid Hansmann | 29.11.2009
Im Rahmen unserer Serie “Greifswalder rund um den Globus” erscheinen in loser Abfolge Berichte von Kommilitonen über Erfahrungen im Ausland. Dieses Mal berichtet Moritz-Autor Arvid Hansmann über seine Eindrücke von einer Studienreise nach Syrien und in den Libanon. Der Text erschien bereits im aktuellen moritz-Magazin Nr. 80, dort konnten jedoch nur wenige der sehenswerten Fotos untergebracht werden.
Als sich der Asket Simeon im frühen 5. Jahrhundert auf eine hohe Säule stellte und diese für den Rest seines Lebens so gut wie nie wieder verließ, konnte er nicht ahnen, dass an diesem Ort wenige Jahrzehnte später seinetwegen einriesiges Pilgerzentrum errichtet werden würde. Ebenso konnte er nicht ahnen, dass aus dieser Klosteranlage im nordsyrischen Kalksteinmassiv im Mittelalter eine Festung werden würde, was ihr den heute gebräuchlichen arabischen Namen Qalaat Simaan einbrachte. Noch weniger hätte er sich vorstellen können, dass aus den mehr oder minder frommen Pilgern im beginnenden 21. Jahrhundert Touristen geworden sind, die mit distanzierter Faszination oder romantischer Verklärung auf seine Vita blickten, den architektonischen Formenreichtum der Ruinen bewunderten oder einfach nur die bilde Briese und das grandiose Aussichtspanorama genossen …
Touristen – diesem Begriff haften sogleich diffamierende Assoziationen an: eine amöbiale Masse, meinst älterer Menschen, die sich aus einem Reisebus über eine „Sehenswürdigkeit“ ergießt und dabei von einem Reiseleiter mit einem Fähnchen dirigiert wird, um bei der Bedienung des perpetuum-mobile-artigen Fotoapparats nicht von den vorgegebenen Wegen abzuweichen. Auch wenn unsere Gruppe aus Rostocker und Greifswalder Studierenden und Dozenten, die am Abend des 2. Oktober 2009 in Damaskus eintraf, in vielen Punkten diesem Klischee widersprach, so waren wir doch nichts anderes als Touristen – Gäste von zwei kontrastreichen Ländern, die uns mit Offenheit empfingen und uns ein Spektrum aus Licht- und Schattenseiten aufzeigten, das wir nur in dem Maße rezipieren konnten, wie es in knapp 10 Tagen möglich war.
Reisen durch die Jahrtausende (mehr …)
von Arvid Hansmann | 05.03.2009
Die 59. Berlinale als Spiegel weltumgreifender Perspektiven und Ressentiments. – Ein Beitrag unseres Gastautors Arvid Hansmann. Berlinale-Fotos von Arvid findet ihr in unserer Galerie.
„This is the end …”

Regisseur Dani Levy auf der Berlinale
Glaubt man Dani Levys Beitrag „Joshua“, den er zum Projekt „Deutschland 09 – 13 kurze Filme zur Lage der Nation” beigesteuert hat, so ist eine optimistische Stimmung in unserem Land nur durch Zuhilfenahme von halluzinogenen Medikamenten möglich. Nur so kann sein kleiner Sohn in einem „national befreiten Dorf” als messianischer Führer gesehen werden – doch mit abklingender Wirkung ertönt ein martialischer Chor: „Morgen müsst ihr sterben; morgen seid ihr tot!”
Man mag Levy unterstellen, dass er als Jude mit einer gewissen Skepsis an deutsche Identitätsbefindlichkeiten herangeht. Doch sind die Gedanken einer nationalen Orientierung, die sich als resignativer Protest gegen die unüberschaubaren Globalisierungsprozesse äußern, nur noch durch den prototypischen Charakter der NS-Herrschaft an die Deutschen gebunden: Das Dritte Reich mag mit all seinen ideologischen Paradoxien ein Vorbild bieten – die konkrete Ausprägung in der Gegenwart ist jedoch in allen Teilen der Welt an soziale, ethnische, oder geographische Phänomena gebunden.
Welche grotesken Stilblüten der Nationalismus treibt, zeigt der Film „Rossiya 88” von Pavel Bardin. Wer hier zunächst an eine Dokumentation der russischen Wendezeit denkt, irrt gewaltig: Die Zahl verweist auf den Buchstabenkombination „H.H.”. Während hierzulande bereits bei der Nummernschildvergabe auf derartige Dopplungen verzichtet wird, so hat sich in Russland eine Szene herausgebildet, die die Nazi-Ikonographie adaptiert und auf ihr alltägliches Umfeld anwendet. Dabei wird in Kauf genommen, dass das „H” im Kyrillischen gar nicht existiert und dass die „Sieg Cheil”-Rufe die Großeltern nur zu Kopfschütteln veranlassen, die einst aus erheblich tieferer Entschlossenheit gegen Hitlerdeutschland kämpften. Was in dieser äußerst unästhetischen Bewegung jedoch zum Ausdruck kommt, ist die allgemeine Antipathie, die offenbar in der russischen Gesellschaft gegenüber den Migranten aus den muslimisch geprägten Regionen des Riesenreiches herrscht: Die Polizei sieht gerne einmal weg, wenn ein Gemüsehändler zusammengeschlagen wird. (mehr …)
von Arvid Hansmann | 22.08.2008
Über Moral und Menschlichkeit in Christopher Nolans “The Dark Knight”
Das, was einen Menschen zu einem Individuum, zu einer Persönlichkeit werden lässt, ist sein Gesicht. Im Gesicht eines Menschen erkennen wir, wer er ist und wie er ist – oder zumindest vorgibt zu sein. Um sich von jener Individualität loslösen zu können, greift der Mensch seit prähistorischen Zeiten zu einem Hilfsmittel: Der Maske.
Im antiken Drama waren es die Masken, die die Stereotypen von „Komödie” und „Tragödie” kennzeichneten. Doch bereits damals war es der undifferenzierte Grenzbereich zwischen beiden Extremen, der die Gemüter der Zuschauer am meisten bewegte. Die Fratze des Clowns war trotz ihrer Komik stets von tragischer Melancholie bis hin zu garstiger Boshaftigkeit geprägt.

Ein derartiger „Grenzgänger” ist nun auch in den deutschen Kinos zu sehen. Die große Aufmerksamkeit, die der Figur des „Jokers” in „The Dark Knight”, dem zweitem „Batman”-Film unter der Regie von Christopher Nolan, zuteil wird, ist sicher dem tragischen Tod des Darstellers Heath Ledger (1979-2008) geschuldet. Dass sich in der grotesk entstellten Mimik des exzentrischen Comic-Charakters bei genauerer Betrachtung das junge Gesicht des sympathisch-vielseitigen Australiers verbirgt, der sich in der Öffentlichkeit – wie beispielsweise bei Berlinale 2006 – so unkompliziert und natürlich gab, verschafft den Leinwandbildern eine emotionale Tiefe, welche die bereits intendierte Komplexität erheblich weiter steigert. (mehr …)