von Archiv | 11.12.2007
 Ihre geputzten Schuhe brauchten die Konzerthörer am vergangenen Donnerstagabend im Café Koeppen nicht vorzeigen. Etwas Geduld mußten sie viel eher mitbringen. Denn das aus Berlin angereiste Jazztrio Spoom trat mit leichter Verspätung und einer kurzfristigen personellen Umbestzung ins Rampenlicht. Denn Andreas Lang vom Quartz-Quartett vertrat den kurzfristig ausgefallenen Jonas Westergaard am Kontrabass. „Wir haben lange pausiert und stellen jetzt unser neues Material vor“, sagte Gitarrist Ronny Graupe von der vor drei Jahren gegründeteten Combo. Ihr einziger Greifswalder Auftritt während ihrer zweiwöchigen Tournee in diesem Jahr führte das deutsch-dänische Ensemble ins gut besuchte Café Koeppen in der Bahnhofsstraße. Mit überraschenden Klängen. Mit einem Standard von Wayne Shorter eröffnete Spoom recht unbeschwert ihren Auftritt, gingen dann allerdings rasch zu Stücken aus eigener Feder über. Beim dezenten Kreisen der Besen vom Schlagzeuger Christian Lillinger setzte Ronny Graupe bei „Reno“ begleitet von Andreas Langs Kontrabasstupfern auf seiner siebensaitigen, halbakkustischen Gitarre weich ein. Nicht mit treibenden Rhythmen oder wilden Läufen, sondern mit gedämpften, ja melodischem Jazz erspielte sich Spoom den aufrichtigen Applaus seiner Zuhörer. Vergessen waren alle Startschwierigkeiten. Denn niemand hatte seinen Platz im Café vorzeitig verlassen. Nach einem fantasievoll versteckten Tango, dem bewegende Nocturne „Es war die Nachtigall“ oder ein im Gitarrensolo aufleuchtendes „Summertime“ verdichtete sich die Stille im Raum hörbar und alle Augen richteten sich glänzend auf Ronny Graupe, Christian Lillinger und Andreas Lang. Jene beflügelten mal lyrisch, mal tänzerisch im getragenen Feiertagston. Ganz harmonisch klang der Tag des Nikolaus damit aus.
Ihre geputzten Schuhe brauchten die Konzerthörer am vergangenen Donnerstagabend im Café Koeppen nicht vorzeigen. Etwas Geduld mußten sie viel eher mitbringen. Denn das aus Berlin angereiste Jazztrio Spoom trat mit leichter Verspätung und einer kurzfristigen personellen Umbestzung ins Rampenlicht. Denn Andreas Lang vom Quartz-Quartett vertrat den kurzfristig ausgefallenen Jonas Westergaard am Kontrabass. „Wir haben lange pausiert und stellen jetzt unser neues Material vor“, sagte Gitarrist Ronny Graupe von der vor drei Jahren gegründeteten Combo. Ihr einziger Greifswalder Auftritt während ihrer zweiwöchigen Tournee in diesem Jahr führte das deutsch-dänische Ensemble ins gut besuchte Café Koeppen in der Bahnhofsstraße. Mit überraschenden Klängen. Mit einem Standard von Wayne Shorter eröffnete Spoom recht unbeschwert ihren Auftritt, gingen dann allerdings rasch zu Stücken aus eigener Feder über. Beim dezenten Kreisen der Besen vom Schlagzeuger Christian Lillinger setzte Ronny Graupe bei „Reno“ begleitet von Andreas Langs Kontrabasstupfern auf seiner siebensaitigen, halbakkustischen Gitarre weich ein. Nicht mit treibenden Rhythmen oder wilden Läufen, sondern mit gedämpften, ja melodischem Jazz erspielte sich Spoom den aufrichtigen Applaus seiner Zuhörer. Vergessen waren alle Startschwierigkeiten. Denn niemand hatte seinen Platz im Café vorzeitig verlassen. Nach einem fantasievoll versteckten Tango, dem bewegende Nocturne „Es war die Nachtigall“ oder ein im Gitarrensolo aufleuchtendes „Summertime“ verdichtete sich die Stille im Raum hörbar und alle Augen richteten sich glänzend auf Ronny Graupe, Christian Lillinger und Andreas Lang. Jene beflügelten mal lyrisch, mal tänzerisch im getragenen Feiertagston. Ganz harmonisch klang der Tag des Nikolaus damit aus.
Geschrieben von Uwe Roßner
von Archiv | 10.12.2007
Das Feuerzeug – ein Märchenmusical nach Hans Christian Andersen im Theater Vorpommern
 Nach beendeten Krieg und Entlassung aus der königlichen Armee zieht ein armer Soldat durch das Land in seine Heimat zurück. Auf seinem Weg trifft er eine alte Hexe, deren Feuerzeug in einen riesigen holen Baum gefallen ist und den Soldaten bittet, ihr doch zu helfen und es wieder herauf zu holen. Er solle auch reich dafür belohnt werden. Der Soldat kriecht in den Baum und steht plötzlich vor drei Türen, die mit Kupfer, Silber und Gold gefüllt sind und von drei großen Hunden bewacht werden. Den Tornister voll Gold und das Feuerzeug in der Tasche, kehrt er wieder nach oben zurück, wo die alte Hexe schon nach ihrem Feuerzeug verlangt. Doch der Soldat fällt nicht auf sie herein. Im Kampf überwältigt er die Hexe und behält das alte Feuerzeug für sich.
Nach beendeten Krieg und Entlassung aus der königlichen Armee zieht ein armer Soldat durch das Land in seine Heimat zurück. Auf seinem Weg trifft er eine alte Hexe, deren Feuerzeug in einen riesigen holen Baum gefallen ist und den Soldaten bittet, ihr doch zu helfen und es wieder herauf zu holen. Er solle auch reich dafür belohnt werden. Der Soldat kriecht in den Baum und steht plötzlich vor drei Türen, die mit Kupfer, Silber und Gold gefüllt sind und von drei großen Hunden bewacht werden. Den Tornister voll Gold und das Feuerzeug in der Tasche, kehrt er wieder nach oben zurück, wo die alte Hexe schon nach ihrem Feuerzeug verlangt. Doch der Soldat fällt nicht auf sie herein. Im Kampf überwältigt er die Hexe und behält das alte Feuerzeug für sich.
In seiner Heimatstadt angekommen, lässt er sich das beste Zimmer der Stadt geben, die feinsten Röcke schneidern und sich vom armen Schusterlehrling regelmäßig neue Stiefel anfertigen. Mit dem restlichen Gold, lässt er es sich lange Zeit gut gehen, bis eines Tages alles ausgegeben war. Mit dem Geld verschwinden auch die ihm so zugetanen Bürger und Freunde wieder. Durch Zufall benutzt er eines Abends das Feuerzeug und entdeckt sein Geheimnis. Es ruft die drei Hunde, welche dem Soldaten, je nach Wunsch, etwas von dem Kupfer, dem Silber oder dem Gold bringen und all seine Wünsche erfüllen können. Mit Hilfe des geheimnisvollen Feuerzeugs gelingt es ihm am Ende den König zu überrumpeln und die eingesperrte Prinzessin aus dem Kupferturm zu heiraten.
Mit diesem und über 150 anderen Märchen schuf der weltberühmte dänische Dichter Hans Christian Andersen (1805-1875) einen neuen Märchentypus gegenüber dem Volksmärchen. Einen Typus, der kraft der kindlichen Augen die Wirklichkeit zum Märchen macht. Andersen war ein zielbewusster Künstler und griff die Kindersprache als das stilbildende Element für seine Dichtung auf. In seiner Erneuerung der Märchenpoesie humanisierte er die Grimmsche Welt, merzte das meiste von allem grob Fantastischen aus und führte zahlreiche kleine, deutliche Züge aus dem wirklichen Leben ein. Er entfernte die allzu wunderhafte Machtentfaltung und brachte den Glauben hervor, arm und von unten kommend zuerst Böses durchmachen zu müssen, um dann von Gott und den Menschen geliebt zu werden. Andersens Lebenslauf selbst besteht in einem außergewöhnlichen Aufstieg aus armen Verhältnissen hin zu einer von fürstlicher Seite protegierten Dichterexistenz am Königshof. Diese soziale Doppelperspektive bestimmt nicht nur „Das Feuerzeug“, sondern alle Märchen des Dänen bis in die feinsten poetischen Verästelungen hinein. Vor allem prägt er das Märchen durch seinen eigenen Stil und spricht in ihm seine Gedanken, Ideen und Empfindungen aus. Was ihn dabei besonders auszeichnet, ist die Gabe der lebendigen, mündlichen Rede. Es ist sein großer Einfall, sie in die Schrift zu übertragen und dadurch den alten Sinn der Märchen, die doch von Mund zu Mund gingen, wieder zu erfüllen.
Andersens Prosa erweist sich als übermütig, vorwitzig und durchtrieben ihre Naivität ist so scheinheilig wie ihre Artigkeit. Er selbst erklärte einmal, er habe seine Märchen auf ein heterogenes Zielpublikum hin berechnet In einem Brief an seinen romantischen Dichterfreund Ingemann: „Ich greife eine Idee auf, die für Ältere gedacht ist und erzähle sie dann den Kleinen, während ich daran denke, dass Vater und Mutter oft zuhören, und ihnen muss man etwas für den Verstand geben.“
Mittlerweile gehört dieses Märchen zur Weltliteratur und wurde 1959 von der DEFA verfilmt. In Koproduktion mit dem Mecklenburgischen Landestheater Parchim ist jedoch nun unter der Regie von Thomas Ott-Albrecht ein Märchen-Musical zu „Das Feuerzeug“ entstanden und wird derzeit im Greifswalder Theater aufgeführt. Die Geschichte um den jungen Soldaten und die Liebe zu der Prinzessin, verbunden mit den Tücken des Lebens wird für die Kleinen ab fünf Jahren heiter erzählt und dargestellt und ist nicht nur für sie amüsant und lehrreich zugleich. Das Besondere an diesem Märchen-Musical ist nicht nur der Verzicht auf die Umsetzung grausamer Szenen des Originaltextes, sondern zudem die Musik der jungen Sängerin und Liedermacherin Vaile, die vielen als Schauspielerin in der Serie „Marienhof“ bekannt ist. Eine märchenhafte Musik also, die die Handlung treffend untermalt.
Geschrieben von Steffi Besch
von Archiv | 06.12.2007
„Die Kinder Hurins“, ein posthum veröffentlichter Roman J.R.R. Tolkiens, von seinem Sohn Christopher Tolkien herausgegeben, erschien 2007 auf dem deutschen Markt. Können die Erwartungen der internationalen Tolkien-Gemeinschaft erfüllt werden?
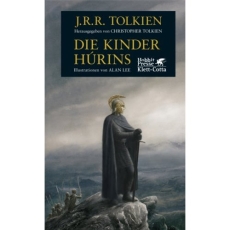 Im 1980 veröffentlichten Buch „Nachrichten aus Mittelerde“ bekommt der Leser eine Vielzahl längerer oder kürzerer Geschichten aus dem Reich Mittelerdes zu lesen. Er erhält detaillierte Informationen zu Ilsidur, einer der tragischen Gestalten des „Herrn der Ringe“, der Sauron den Einen Ring abschlug und auf dem Gipfel des Schicksalsberges innerhalb einer Sekunde das Dritte Zeitalter einleitete. Der Leser erfährt, wie Geschichte, Stolz und Intrige ein Volk wie das der Numenor korrumpiert und zerstört. Der Leser bekommt eine Vielzahl knapper oder gediegener Fragmente vorgesetzt, die von der phantastischen Tragweite Tolkienscher Gedanken zeugen.
Im 1980 veröffentlichten Buch „Nachrichten aus Mittelerde“ bekommt der Leser eine Vielzahl längerer oder kürzerer Geschichten aus dem Reich Mittelerdes zu lesen. Er erhält detaillierte Informationen zu Ilsidur, einer der tragischen Gestalten des „Herrn der Ringe“, der Sauron den Einen Ring abschlug und auf dem Gipfel des Schicksalsberges innerhalb einer Sekunde das Dritte Zeitalter einleitete. Der Leser erfährt, wie Geschichte, Stolz und Intrige ein Volk wie das der Numenor korrumpiert und zerstört. Der Leser bekommt eine Vielzahl knapper oder gediegener Fragmente vorgesetzt, die von der phantastischen Tragweite Tolkienscher Gedanken zeugen.
Von all diesen Geschichten sticht eine jedoch deutlich hervor: Die Geschichte Turin Turambars, Sohn Hurins. Dort, wo die Leser verzweifelt nach Luft gerangen haben, als sie die letzten Worte des Textes lasen; dort, wo sich das Schicksal Turins und seiner Familie zu überschlagen drohte, fand die Geschichte ein jähes Ende. Turin stand vor den Toren seiner Zukunft und die Geschichte hörte auf.
„Die Kinder Hurins“ beleuchtet diesen Teil des Buches genauer und lässt die Leser an den Geschehnissen rund um Hurin und seiner Familie teilhaben.
J.R.R. Tolkien hat in seinem Lebenswerk bereits eine Vielzahl nordischer Sagen und Mythen verwoben, um mit der Geschichte um den „Herrn der Ringe“ eine unermesslich große Welt zu schaffen. Eine Welt, in der Phantasie, Poesie und Epos vereint sind und sich zu einem Amalgam verbinden, dass seinesgleichen sucht. Aber bei all der Epik, die Tolkien beschreibt, besticht die Geschichte Hurins und seines Sohnes Turin durch ihre paradigmatische Natur. Kein anderes Werk Tolkiens zeigt so deutlich und bildreich, wie hoffnungslos schicksalsergeben Charaktere epischer Lyrik sind, wie viel Gewicht auf deren Taten liegt und wie schwer ihr eigenes familiäres Erbe wiegt.
Die Handlung des Buches, knapp gefasst, ist so dramatisch wie sie traurig ist: Hurin wird von seinem Widersacher Morgoth gefangengenommen und auf einem Berg angekettet, damit er sehen kann, wie sich die Geschichte seiner Familie entwickelt. Dessen Sohn, Turin Turambar, durchleidet in seinem Leben eine Vielzahl tragischer Erlebnisse, deren jeweiliger Ausgang bereits vorher prophezeit wird: Turin soll durch seine Handlungen sich und andere ins Unglück stürzen. Der Prophezeiung stets unbewusst folgend ist Turin Verursacher des Todes mehrerer Menschen, verliert im Kampf gegen einen Drachen sein Gedächtnis, schläft mit seiner Schwester und stößt sich letztlich in sein eigenes Schwert. Im Verlauf des Buches werden alle Personen, die Turin begegnen, seinem epischen Schicksal erliegen: Entweder sie sterben durch die Hand Turins, sie sterben durch ihre eigene Hand oder wirken massiv und unbewusst an der Spirale Turins Leben mit.
Keine der Personen ist in der Lage, diesem Kreislauf zu entrinnen oder ihn positiv zu verändern. Sie reflektieren ihre eigenen Handlungen nicht und das Verhältnis zwischen Wünschen und gottbestimmtem Schicksal ist unverrückbar.
Die von Christopher Tolkien zusammengefassten, erweiterten und kommentierten Fragmente seines Vaters beinhalten all jene Elemente, die die über lange Jahre angewachsene Tolkien-Leserschaft schätzen gelernt hat. Die Bildhaftigkeit des Epos, die Poesie der Fragmente und die Gewalt der Handlung übertrifft beinahe den „Herrn der Ringe“ und befriedigt vollkommen sämtliche Erwartungen, die man an dieses Buch stellen kann. Christopher Tolkien hat großartige Arbeit geleistet, als er die zahlreichen, jeweils knappen Fragmente des Vaters über Jahrzehnte geordnet und erweitert hat.
„Die Kinder Hurins“ ist kein Werk, das sich anbietet, in die Welt Tolkiens einzusteigen. Aber jene, die dessen phantastisches Werk bereits kennen- und schätzen gelernt haben, werden das Buch in Ehren halten: Als Ergänzung der tolkienschen Sagenwelt und als Abschluss des großen Fragments aus dem Buch „Geschichten aus Mittelerde“.
Geschrieben von tw
von Archiv | 05.12.2007
Der Lotto-Jackpot steht momentan so hoch wie noch nie: 43 Millionen Euro warten auf sechs Richtige plus Superzahl. Da kommt es schon mal vor, dass auch absolute Glücksspiel-Muffel zum Tippschein greifen.
Ein Bericht aus erster Hand.
 Ich habe noch nie ernsthaft Lotto gespielt. Na klar, einmal bin auch ich auf eines dieser Telefon-Verkaufsgespräche reingefallen, bei denen man angeblich drei Monate gratis tippen kann (und dann nur mit erheblichem juristischen Aufwand wieder aus dem Vertrag kommt). Aber um einfach in eine Annahmestelle zu gehen und einen Schein auszufüllen, dazu bin ich bisher einfach viel zu rational an die Sache herangegangen. Eine allgemeine Gewinnchance von weniger als zwei Prozent und die schon wahnwitzig geringe Chance auf den Jackpot von exakt 0,00000071511 Prozent lassen das statistikverliebte Herz nicht gerade höher schlagen. Mein Kopf sagt also nach wie vor: Finger weg. Nur wie viel hat die eigene Vernunft bei der Aussicht auf 43 Millionen Euro noch zu melden?
Ich habe noch nie ernsthaft Lotto gespielt. Na klar, einmal bin auch ich auf eines dieser Telefon-Verkaufsgespräche reingefallen, bei denen man angeblich drei Monate gratis tippen kann (und dann nur mit erheblichem juristischen Aufwand wieder aus dem Vertrag kommt). Aber um einfach in eine Annahmestelle zu gehen und einen Schein auszufüllen, dazu bin ich bisher einfach viel zu rational an die Sache herangegangen. Eine allgemeine Gewinnchance von weniger als zwei Prozent und die schon wahnwitzig geringe Chance auf den Jackpot von exakt 0,00000071511 Prozent lassen das statistikverliebte Herz nicht gerade höher schlagen. Mein Kopf sagt also nach wie vor: Finger weg. Nur wie viel hat die eigene Vernunft bei der Aussicht auf 43 Millionen Euro noch zu melden?
Die Lotto-Euphorie der letzten zwei Wochen hat ohne Zweifel auch in Greifswald ihre Spuren hinterlassen. In den Kiosken und Kleinmärkten mit Annahmestelle bilden sich regelmäßig am Mittwoch- und Samstagnachmittag lange Schlangen, wenn auch die Letzten noch ihren Tipp abgeben wollen. Ich stehe heute mittendrin und lausche dem Gespräch der beiden älteren Damen hinter mir. Sie unterhalten sich angeregt darüber, was man alles mit 43 Millionen Euro anstellen kann. Neues Haus, neues Auto, eine Kreuzfahrt – die üblichen Dinge eben. Ich wäre da genügsamer: Ein neues Fahrrad würde mir reichen. Nunja, ein Auto wäre tatsächlich nicht verkehrt. Und schon bin auch ich in Gedanken dabei, meinen Jackpot auszugeben. Das Lotto-Fieber ist sehr ansteckend.
Vor ein Problem werde ich gestellt, als ich mit dem Stift in der Hand vor meinem noch leeren Schein stehe. Was ankreuzen? Ich bin immer noch nicht infiziert genug um tatsächlich mit Geburtstagen oder Glückszahlen zu spielen. Also wechsle ich den Standard-schein gegen einen bereits ausgefüllten Vordruck. Geringe Chance bleibt geringe Chance, egal welche Zahlen ich nehme. Auf dem Weg nach draußen fällt mein Blick auf ein Plakat: „1,9 Millionen Euro nach Parchim!“. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es sie, die Lottomillionäre. Zwar gab es in den letzten Wochen keine größeren Gewinne im Raum Greifswald – aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vorsichtig verstaue ich meinen Schein in der Jackentasche.
Nun bin ich tatsächlich körperlich angespannt. Sicherheitshalber werfe ich noch einmal einen Blick auf den Garant meines zukünftigen Reichtums. Und erst jetzt bemerke ich, dass auf dem vorausgefüllten Tippschein mein Sternzeichen prangt: Fische. Ein Zeichen? Ich scheine langsam aber sicher doch dem Aberglauben zu verfallen. Jetzt kann ich wirklich nachvollziehen, warum sich in den letzten Tagen im Büro, im Café, in der Mensa und selbst bei unseren polnischen Kollegen die Gespräche um nichts anderes mehr drehen. Bei 43 Millionen Euro im Jackpot muss man den Nervenkitzel einfach fühlen.
Natürlich werde ich heute Abend mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht einmal meinen Spieleinsatz zurückgewinnen. Aber auch das wird mich wohl nicht davon abhalten, am Samstag und am kommenden Mittwoch wieder einen Schein auszufüllen. Denn bis zur Ziehung am 12. Dezember kann der Jackpot noch größer werden. Wenn er auch dann nicht geknackt werden kann, reichen schon sechs Richtige für den Hauptgewinn. Da möchte ich natürlich auch wieder dabei sein und von den Millionen träumen – auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass ich bis dahin vom Blitz erschlagen werde.Geschrieben von Robin Drefs
von Archiv | 05.12.2007
Wohltemperierte Register zieht Robert Schneider mit seinem jüngsten Roman „Die Offenbarung“. Nicht allein für Johann Sebastian Bach.
Für Jakob Kemper gerät der Heiligabend des Jahres 1992 zur Passion. Erst verstimmt der gesundheitlich angeschlagene Naumburger Organist den Weihnachtsgottesdienst der geschrumpften Gemeinde kräftig mit Dissonanzen, dann bringt ihn ein zufällig aufgestöbertes Notenkonvolut im Gehäuse seines Instruments an den Rand seiner Kräfte. Denn der Papierstapel in der alten Reisetasche enthält ein bisher unbekanntes Spätwerk Johann Sebastian Bachs. Mit dem wiederentdeckten Opus Magnum in den Händen steht der schrullige Musikforscher vor einem Wendepunkte. Denn die renommierte Bachgesellschaft schickt sich an, die bereits seit Jahren ausstehende Restauration der Naumburger Domorgel in Kürze fachmännisch zu begleiten. Ungewiss bleibt deren Offenheit für diesen überraschenden Fund.
„Die Offenbarung“ ist ein bewegendes Stück Literatur aus der Feder Robert Schneiders. Das in die neunziger Jahre platzierte Geschehen zeigt augenzwinkernd historische und persönliche Altlasten der Umbruchsphase der liebenswürdig karikierten Naumburger Figuren auf und fügt die gewordenen Lebensläufe zu einem griffigen Musikroman zusammen. Nach dem Achtungserfolg von Werner Bräunigs „Rummelplatz“ zur Leipziger Buchmesse stiftet der Aufbau Verlag mit Robert Schneiders „Die Offenbarung“ einen bemerkenswerten Leseanstoß zu den frühen neunziger Jahren in Gesellschaft, Kultur und Forschung der wiedervereinigten Bundesrepublik.
Geschrieben von Uwe Roßner
 Ihre geputzten Schuhe brauchten die Konzerthörer am vergangenen Donnerstagabend im Café Koeppen nicht vorzeigen. Etwas Geduld mußten sie viel eher mitbringen. Denn das aus Berlin angereiste Jazztrio Spoom trat mit leichter Verspätung und einer kurzfristigen personellen Umbestzung ins Rampenlicht. Denn Andreas Lang vom Quartz-Quartett vertrat den kurzfristig ausgefallenen Jonas Westergaard am Kontrabass. „Wir haben lange pausiert und stellen jetzt unser neues Material vor“, sagte Gitarrist Ronny Graupe von der vor drei Jahren gegründeteten Combo. Ihr einziger Greifswalder Auftritt während ihrer zweiwöchigen Tournee in diesem Jahr führte das deutsch-dänische Ensemble ins gut besuchte Café Koeppen in der Bahnhofsstraße. Mit überraschenden Klängen. Mit einem Standard von Wayne Shorter eröffnete Spoom recht unbeschwert ihren Auftritt, gingen dann allerdings rasch zu Stücken aus eigener Feder über. Beim dezenten Kreisen der Besen vom Schlagzeuger Christian Lillinger setzte Ronny Graupe bei „Reno“ begleitet von Andreas Langs Kontrabasstupfern auf seiner siebensaitigen, halbakkustischen Gitarre weich ein. Nicht mit treibenden Rhythmen oder wilden Läufen, sondern mit gedämpften, ja melodischem Jazz erspielte sich Spoom den aufrichtigen Applaus seiner Zuhörer. Vergessen waren alle Startschwierigkeiten. Denn niemand hatte seinen Platz im Café vorzeitig verlassen. Nach einem fantasievoll versteckten Tango, dem bewegende Nocturne „Es war die Nachtigall“ oder ein im Gitarrensolo aufleuchtendes „Summertime“ verdichtete sich die Stille im Raum hörbar und alle Augen richteten sich glänzend auf Ronny Graupe, Christian Lillinger und Andreas Lang. Jene beflügelten mal lyrisch, mal tänzerisch im getragenen Feiertagston. Ganz harmonisch klang der Tag des Nikolaus damit aus.
Ihre geputzten Schuhe brauchten die Konzerthörer am vergangenen Donnerstagabend im Café Koeppen nicht vorzeigen. Etwas Geduld mußten sie viel eher mitbringen. Denn das aus Berlin angereiste Jazztrio Spoom trat mit leichter Verspätung und einer kurzfristigen personellen Umbestzung ins Rampenlicht. Denn Andreas Lang vom Quartz-Quartett vertrat den kurzfristig ausgefallenen Jonas Westergaard am Kontrabass. „Wir haben lange pausiert und stellen jetzt unser neues Material vor“, sagte Gitarrist Ronny Graupe von der vor drei Jahren gegründeteten Combo. Ihr einziger Greifswalder Auftritt während ihrer zweiwöchigen Tournee in diesem Jahr führte das deutsch-dänische Ensemble ins gut besuchte Café Koeppen in der Bahnhofsstraße. Mit überraschenden Klängen. Mit einem Standard von Wayne Shorter eröffnete Spoom recht unbeschwert ihren Auftritt, gingen dann allerdings rasch zu Stücken aus eigener Feder über. Beim dezenten Kreisen der Besen vom Schlagzeuger Christian Lillinger setzte Ronny Graupe bei „Reno“ begleitet von Andreas Langs Kontrabasstupfern auf seiner siebensaitigen, halbakkustischen Gitarre weich ein. Nicht mit treibenden Rhythmen oder wilden Läufen, sondern mit gedämpften, ja melodischem Jazz erspielte sich Spoom den aufrichtigen Applaus seiner Zuhörer. Vergessen waren alle Startschwierigkeiten. Denn niemand hatte seinen Platz im Café vorzeitig verlassen. Nach einem fantasievoll versteckten Tango, dem bewegende Nocturne „Es war die Nachtigall“ oder ein im Gitarrensolo aufleuchtendes „Summertime“ verdichtete sich die Stille im Raum hörbar und alle Augen richteten sich glänzend auf Ronny Graupe, Christian Lillinger und Andreas Lang. Jene beflügelten mal lyrisch, mal tänzerisch im getragenen Feiertagston. Ganz harmonisch klang der Tag des Nikolaus damit aus.
 Nach beendeten Krieg und Entlassung aus der königlichen Armee zieht ein armer Soldat durch das Land in seine Heimat zurück. Auf seinem Weg trifft er eine alte Hexe, deren Feuerzeug in einen riesigen holen Baum gefallen ist und den Soldaten bittet, ihr doch zu helfen und es wieder herauf zu holen. Er solle auch reich dafür belohnt werden. Der Soldat kriecht in den Baum und steht plötzlich vor drei Türen, die mit Kupfer, Silber und Gold gefüllt sind und von drei großen Hunden bewacht werden. Den Tornister voll Gold und das Feuerzeug in der Tasche, kehrt er wieder nach oben zurück, wo die alte Hexe schon nach ihrem Feuerzeug verlangt. Doch der Soldat fällt nicht auf sie herein. Im Kampf überwältigt er die Hexe und behält das alte Feuerzeug für sich.
Nach beendeten Krieg und Entlassung aus der königlichen Armee zieht ein armer Soldat durch das Land in seine Heimat zurück. Auf seinem Weg trifft er eine alte Hexe, deren Feuerzeug in einen riesigen holen Baum gefallen ist und den Soldaten bittet, ihr doch zu helfen und es wieder herauf zu holen. Er solle auch reich dafür belohnt werden. Der Soldat kriecht in den Baum und steht plötzlich vor drei Türen, die mit Kupfer, Silber und Gold gefüllt sind und von drei großen Hunden bewacht werden. Den Tornister voll Gold und das Feuerzeug in der Tasche, kehrt er wieder nach oben zurück, wo die alte Hexe schon nach ihrem Feuerzeug verlangt. Doch der Soldat fällt nicht auf sie herein. Im Kampf überwältigt er die Hexe und behält das alte Feuerzeug für sich. 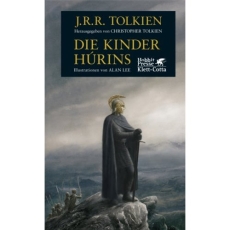 Im 1980 veröffentlichten Buch „Nachrichten aus Mittelerde“ bekommt der Leser eine Vielzahl längerer oder kürzerer Geschichten aus dem Reich Mittelerdes zu lesen. Er erhält detaillierte Informationen zu Ilsidur, einer der tragischen Gestalten des „Herrn der Ringe“, der Sauron den Einen Ring abschlug und auf dem Gipfel des Schicksalsberges innerhalb einer Sekunde das Dritte Zeitalter einleitete. Der Leser erfährt, wie Geschichte, Stolz und Intrige ein Volk wie das der Numenor korrumpiert und zerstört. Der Leser bekommt eine Vielzahl knapper oder gediegener Fragmente vorgesetzt, die von der phantastischen Tragweite Tolkienscher Gedanken zeugen.
Im 1980 veröffentlichten Buch „Nachrichten aus Mittelerde“ bekommt der Leser eine Vielzahl längerer oder kürzerer Geschichten aus dem Reich Mittelerdes zu lesen. Er erhält detaillierte Informationen zu Ilsidur, einer der tragischen Gestalten des „Herrn der Ringe“, der Sauron den Einen Ring abschlug und auf dem Gipfel des Schicksalsberges innerhalb einer Sekunde das Dritte Zeitalter einleitete. Der Leser erfährt, wie Geschichte, Stolz und Intrige ein Volk wie das der Numenor korrumpiert und zerstört. Der Leser bekommt eine Vielzahl knapper oder gediegener Fragmente vorgesetzt, die von der phantastischen Tragweite Tolkienscher Gedanken zeugen. Ich habe noch nie ernsthaft Lotto gespielt. Na klar, einmal bin auch ich auf eines dieser Telefon-Verkaufsgespräche reingefallen, bei denen man angeblich drei Monate gratis tippen kann (und dann nur mit erheblichem juristischen Aufwand wieder aus dem Vertrag kommt). Aber um einfach in eine Annahmestelle zu gehen und einen Schein auszufüllen, dazu bin ich bisher einfach viel zu rational an die Sache herangegangen. Eine allgemeine Gewinnchance von weniger als zwei Prozent und die schon wahnwitzig geringe Chance auf den Jackpot von exakt 0,00000071511 Prozent lassen das statistikverliebte Herz nicht gerade höher schlagen. Mein Kopf sagt also nach wie vor: Finger weg. Nur wie viel hat die eigene Vernunft bei der Aussicht auf 43 Millionen Euro noch zu melden?
Ich habe noch nie ernsthaft Lotto gespielt. Na klar, einmal bin auch ich auf eines dieser Telefon-Verkaufsgespräche reingefallen, bei denen man angeblich drei Monate gratis tippen kann (und dann nur mit erheblichem juristischen Aufwand wieder aus dem Vertrag kommt). Aber um einfach in eine Annahmestelle zu gehen und einen Schein auszufüllen, dazu bin ich bisher einfach viel zu rational an die Sache herangegangen. Eine allgemeine Gewinnchance von weniger als zwei Prozent und die schon wahnwitzig geringe Chance auf den Jackpot von exakt 0,00000071511 Prozent lassen das statistikverliebte Herz nicht gerade höher schlagen. Mein Kopf sagt also nach wie vor: Finger weg. Nur wie viel hat die eigene Vernunft bei der Aussicht auf 43 Millionen Euro noch zu melden?

