von Archiv | 17.05.2005
Silvio Dalla Torre entdeckt die kantable Seite des Kontrabasses
Wenn Silvio Dalla Torre mit sanfter Stimme von seinem „Bassetto“ spricht, dann leuchten seine Augen freundlich. Stiller Stolz liegt in den Zügen seines Gesichtes und seine Haltung strahlt Ruhe aus.

Nimmt er aber Instrument und Bogen zur Hand, weicht dieser Ausdruck einer tiefen Konzentration, ehe er seinem Streichinstrument wunderbare Töne entlockt: voll und rund, warm und sinnlich, aber auch bissig-zupackend und energisch. Dalla Torre ist Professor für Kontrabass an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT). Drei gravierende Veränderungen hat er an seinem Instrument vorgenommen, die dem Laien auf den ersten Blick nicht auffallen: Bogen, Saiten und Fingersatz sind bei ihm gänzlich anders als beim gewöhnlichem Kontrabasses. Kleine Dinge, die aber den feinen Unterschied ausmachen. Cellisten finden in den wieselflinken Bewegungen seiner linken Hand das auf ihrem Instrument gebräuchliche Vier-Finger-System wieder. Bisher war es üblich, die Töne auf dem Griffbrett des Kontrabasses mit drei Fingern zu greifen. Dalla Torre beweist mit der neuen Technik, dass man dabei keine Kraft spart. Speziell entwickelte Saiten aus neuen Materialien und eine veränderte Stimmung sorgten für einen ganz neuen Klang. Wie beim Cello sind sie nun in Quinten gestimmt und entlocken dem Instrument dadurch ein reicheres Obertonspektrum. Der Bogen ist im Vergleich zum normalen Kontrabassbogen deutlich schwerer. Dadurch wird der Arm entspannt und ein vollerer Klang produziert.
Mit diesen Veränderungen betrat Dalla Torre Neuland, nachdem ihm seine zwanzigjährige Arbeit als Orchestermusiker die Grenzen seines Instrumentes bewusst gemacht hatte. Obwohl der Kontrabass ein vielseitiges Instrument ist, das im klassischen Orchester, in der Kammermusik, im Jazz oder im Folk verwendet wird, hatte er doch bisher einen großen Makel: Das gute Stück konnte nicht kantabel gespielt werden. Schubert, Schumann, Mendelssohn, Verdi, um nur einige zu nennen, komponierten zwar für den Kontrabass wundervoll gesangliche Passagen in ihren Werken, dennoch blickt der Orchester-Kontrabassist in Symphoniekonzerten zuweilen neidisch auf die Kollegen, die von den Komponisten mit vergleichsweise viel häufigerer Ausführung ergreifender Melodien bedacht worden sind. Der Kontrabass durfte nicht mitsingen. Zumindest bisher.
Mit seiner Erfahrung und seinem spielpraktischem Wissen machte sich Dalla Torre auf die Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten seines Instrumentes. Der Kontrabass-Professor analysierte die spieltechnischen Voraussetzungen der verschiedenen Streichinstrumente sowie die dazu notwendigen physiologischen Bedingungen und gelangte nach jahrelanger Auseinandersetzung zu neuen Lösungen. Das Herumstöbern in Büchern und Archiven erbrachte außerdem Hinweise auf das historische Instrument „Bassetto“. Es war von der Musikgeschichte bislang vergessen worden. Obwohl das Instrument, das zwischen 1650 und 1720 seine Blütezeit erlebt hatte, in Quellen belegt ist, kann es derzeit nicht hundertprozentig rekonstruiert werden. Die Angaben in der Literatur geben nur vage Anhaltspunkte für seine korrekte Stimmung und Spielpraxis. Dalla Torre gilt heute als sein Wiederentdecker. Daher hat er entschieden, seinen Kontrabass als „seinen“ Bassetto zu bezeichnen – nicht etwa aus Eitelkeit, sondern einfach, um seinen Instrument, das mit einem riesigen Tonumfang von viereinhalb Oktaven und einem hinreißenden Klang zu ganz neuen Ausdrucksformen in der Lage ist.
Als erstes greifbares Ergebnis seiner Forschungen legte Dalla Torre kürzlich, als Weltersteinspielung eines Bassettos, die CD „Songs, Chansons, Elegies“ vor (Hänssler-Classic, April 2005). Diesem ersten Schritt möchte Dalla Torre noch viele weitere folgen lassen. Ein bereits fertig gestelltes Konzert für Bassetto und Orchester des Rendsburger Komponisten Bodo Reinke, der von dem neuen Instrument so begeistert war, dass er spontan eine Komposition dafür zugesagte, wartet auf seine Uraufführung. Für 2006 ist die Veröffentlichung einer Bassetto-Schule geplant. Vorträge und Konzerte füllen den Terminkalender des Rostocker Professors, der dennoch die Arbeit mit seinen Studenten an erste Stelle setzt. Mit seinem Engagement hat Dalla Torre internationale Aufmerksamkeit und fachliches Interesse geweckt. So erhielt er eine Einladung an das renommierte Royal Conservatory of Music in Toronto/Kanada, der weitere mit Sicherheit folgen werden. Dabei geht es dem Professor nur um eines: um ein neues Verständnis für sein Instrument.
Geschrieben von Uwe Roßner
von Archiv | 17.05.2005
„Make my Day“ hieß es noch bei Dirty Harry. Taxifahrer Max (Jamie Foxx – „Ray“) hat sich das aber bestimmt anders vorgestellt. Erst steigt eine schöne Staatsanwältin in sein Taxi, dann ein Berufskiller der ihn mit auf Tour nimmt – das ist selbst für L.A. nicht alltäglich.
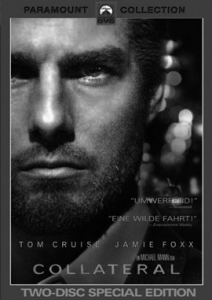 Mit Taxifahrer Max und dem Auftragsmörder Vincent, gespielt von Tom Cruise („Minority Report“), prallen zwei gänzlich verschiedene Charaktere aufeinander, deren Begegnung Spuren hinterlässt. Und damit sind nicht etwa die fünf Toten gemeint, sondern vor allem die messerscharfen Dialoge die das Leben beider verändern sollen. Von Regisseur Michael Mann („Der letzte Mohikaner“) werden nicht nur die beiden Protagonisten gekonnt in Szene gesetzt, sondern auch und vor allem Los Angeles. Es gelingt ihm, den ganz spezifischen Flair dieser Metropole einzufangen und gleichzeitig die Abgründe unserer Gesellschaft aufzutun. Wie ein Fehler im System lässt sich Vincent von Max durch die Straßen, sozusagen die Adern der Stadt fahren, und beendet mit eiskalter Präzision das Leben Fremder. Der Herzschlag der Stadt bleibt stets deutlich hörbar.
Mit Taxifahrer Max und dem Auftragsmörder Vincent, gespielt von Tom Cruise („Minority Report“), prallen zwei gänzlich verschiedene Charaktere aufeinander, deren Begegnung Spuren hinterlässt. Und damit sind nicht etwa die fünf Toten gemeint, sondern vor allem die messerscharfen Dialoge die das Leben beider verändern sollen. Von Regisseur Michael Mann („Der letzte Mohikaner“) werden nicht nur die beiden Protagonisten gekonnt in Szene gesetzt, sondern auch und vor allem Los Angeles. Es gelingt ihm, den ganz spezifischen Flair dieser Metropole einzufangen und gleichzeitig die Abgründe unserer Gesellschaft aufzutun. Wie ein Fehler im System lässt sich Vincent von Max durch die Straßen, sozusagen die Adern der Stadt fahren, und beendet mit eiskalter Präzision das Leben Fremder. Der Herzschlag der Stadt bleibt stets deutlich hörbar.
Im Stile von „Heat“ bewahrt sich Michael Mann seinen stringenten Stil und überzeugt durch eine angenehme Klarheit, die den Staub der Großstadt wie nach einem Regenguss wegzuwaschen scheint, kombiniert mit Action an den richtigen Stellen im richtigen Maß.
Mit Making-Of, Featuretten, Filmkommentar und weiteren Extras überzeugt auch die Bonusausstattung. Präzision an allen Ecken – Dialoge, Bilder, Extras, Charaktere.
Geschrieben von Joel Kaczmarek
von Archiv | 17.05.2005
Zu manchen Gedichten hat man sofort eine Beziehung, ein inneres Bild vor Augen. Ralf Schmerberg gibt mit der DVD „Poem“ Gedichten ein Gesicht und setzt sie in Videoclip-Ästhetik um. Untermalt werden diese von sanften, unaufdringlichen Klavier- oder Celloklängen.
 Zu den beeindruckensten Gedicht-Verfilmungen gehört „Sophie“ von Hans Arp. Herman van Veen spricht mit melancholischer Schwere vom Verlust eines geliebten Menschen abwechselnd mit einer Kinderstimme aus dem Off. Zerbrochene Fensterscheiben, alte Gardinenfetzen, ein verfallenes noch möbliertes Haus, das von der Vergangenheit erzählt, aus die sich der Darsteller nicht lösen kann. Trauer und Todessehnsucht schwingen in seiner Stimme: „Jeder vergangene Tag bringt dich mir näher.“
Zu den beeindruckensten Gedicht-Verfilmungen gehört „Sophie“ von Hans Arp. Herman van Veen spricht mit melancholischer Schwere vom Verlust eines geliebten Menschen abwechselnd mit einer Kinderstimme aus dem Off. Zerbrochene Fensterscheiben, alte Gardinenfetzen, ein verfallenes noch möbliertes Haus, das von der Vergangenheit erzählt, aus die sich der Darsteller nicht lösen kann. Trauer und Todessehnsucht schwingen in seiner Stimme: „Jeder vergangene Tag bringt dich mir näher.“
Klaus Maria Brandauer spricht in s/w-Ästhetik Heinrich Heines „Der Schiffbrüchige“. Zu sehen ist nur sein Gesicht, seine Mimik, sein Ausdruck. Die Handlung des Gedichtes wirkt umso stärker. Fest schaut er dem Zuschauer in die Augen und scheint doch zu sich selbst zu sprechen.
„Nach grauen Tagen“ von Ingeborg Bachmann setzt Schmerberg filmisch ins Großstadtgrau Berlins, eine viel zu kleine Plattenbau-Wohnung mit schreienden und überdrehten Kindern, dem jungen streitenden Elternpaar und dem Wendepunkt, mit dem die Familie nicht weniger chaotisch, jedoch deutlich friedvoller miteinander umgeht.
Weitere Gedichte von Hermann Hesse, Johann Wolfgang von Goethe, Mascha Kaléko, Kurt Tucholky, Else Lasker-Schüler, Georg Trakl, Paul Celan, Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller werden unter anderem dargestellt von Meret Becker, Marcia Haydée, Luise Reiner, Jürgen Vogel und unter anderem gesprochen von Paul Celan, Hannelore Elsner und Anna Thalbach.
Die filmische Interpretation verschiedenster Gedichte lief 2003 im Kino und ist ein bisher einzigartiges Projekt, Gedichten ein „Gesicht“ zu geben. Schmerberg selbst schreibt, dass der Film Impulse und Assoziationen frei setze und die eigene Empfindungs- und Wahrnehmungsbereitschaft bestimme, was der Film erzählt.
Geschrieben von Judith Küther
von Archiv | 17.05.2005
Regisseur Sydney Pollack hat es geschafft – in die heiligen Hallen der Vereinten Nationen. Als erster Regisseur erhielt er für seinen neuen Film „Die Dolmetscherin“ die Dreherlaubnis für das legendäre New Yorker UN-Hauptgebäude am Hudson River.
Nach Filmen wie „Die Firma“ oder „Die 3 Tage des Condor“ drehte Pollack nun erneut einen hochspannenden Polit-Thriller. Die UN-Simultanübersetzerin Sylvia Broome (Nicole Kidman) spricht den Dialekt eines fiktiven afrikanischen Landes, das kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Der Präsident dieses Staates, der des Völkermordes bezichtigt wird, soll vor der UN-Vollversammlung eine Rede halten. Einige Tage davor wird Sylvia Zeugin eines Mordkomplotts an dem afrikanischen Diktator und gerät in die Schusslinie.
Deswegen wird ihr FBI-Agent Tobin Keller (Sean Penn), eigentlich Personenschützer für hochrangige UN-Gäste, zugewiesen. Er misstraut zunächst der Geschichte der Dolmetscherin. Doch dann wird bei Sylvia eingebrochen und Agent Keller erfährt bruchstückhaft von Sylvias Vergangenheit – doch nur bruchstückhaft. Und dann gibt es da noch Simon Broome, den Bruder von Sylvia. Was für eine Rolle spielt er in diesem undurchsichtigen Komplott?
Mit Nicole Kidman und Sean Penn hat Sydney Pollack ein hochkarätiges Schauspielergespann vor die Kamera gestellt, die den Konflikt zwischen Diplomatie und Korruption in New York mit Spannung und dem nötigen Gefühl darstellen. Geschmälert wird das Kinovergnügen allerdings durch einen unverständlichen Handlungsrahmen, der einen kitschigen Nachgeschmack hinterlässt. In der Stadt, wo selbst die Sicherheitsbeamten des örtlichen H&M ein übersteigertes Geltungsbewusstsein zu ihrer Wachpostenfunktion besitzen, muss Sylvia allein durch die unbewachten Flure des UNO-Gebäudes vor Verfolgern flüchten.
Nichtsdestotrotz bildet der Drehort einen ausgezeichneten Rahmen für Fragen nach Moral und Kriegsschuld und bietet einen realitätsnahen Einblick in die Hallen der Vereinten Nationen.
Geschrieben von Verena Lilge, Florian Benkenstein, Jessyca Keil
von Archiv | 17.05.2005
Im Jahre 1185 kommt der Kreuzritter Godfrey von Ibelin (Liam Neeson) in seine alte französische Heimat um seinen unehelichen Sohn Balian (Orlando Bloom) zu suchen. Dieser verdient als Schmied seinen Lebensunterhalt und steht den Plänen seines Vaters, ihn ins Heilige Land zu begleiten, zunächst skeptisch gegenüber.
 Durch den tragischen Tod von Frau und Kind zu einer tödlichen Affekthandlung gedrängt, schließt er sich aber wenig später doch seinem Vater und dessen Gefolgsleuten an. In einem Hinterhalt schwer verwundet kann Godfrey seinen Sohn noch bis in die süditalienische Hafenstadt Messina begleiten, wo er ihn im Sterben zum Ritter und seinem legitimen Erben ernennt.
Durch den tragischen Tod von Frau und Kind zu einer tödlichen Affekthandlung gedrängt, schließt er sich aber wenig später doch seinem Vater und dessen Gefolgsleuten an. In einem Hinterhalt schwer verwundet kann Godfrey seinen Sohn noch bis in die süditalienische Hafenstadt Messina begleiten, wo er ihn im Sterben zum Ritter und seinem legitimen Erben ernennt.
Nach einer abenteuerlichen Seefahrt gelangt Balian nach Jerusalem, das von einem multireligiösen Alltagsleben gekennzeichnet ist. Von hier aus wird ein fragiler Kreuzfahrerstaat regiert, an dessen Spitze offiziell ein todkranker König (Edward Norten) steht. Bald wird aber deutlich, dass der gegenwärtige Frieden mit dem übermächtigen König Saladin (Ghassan Massoud) von verschiedenen Parteien nicht geduldet wird. Nicht zuletzt durch die verbotene Beziehung zu der Prinzessin Sybilla (Eva Green) wird Balian in den intriganten Wettstreit um die Macht in Jerusalem hineingezogen und bald ist es an ihm die heilige Stadt gegen die Armee des Saladin zu verteidigen.
Zwei Meinungen zu Ridley Scotts neuem Film
Meinung Teil 1
„Königreich der Himmel“ überwältigt den Zuschauer mit herrlichen, in Farbe und Ausstattung schwelgenden, sorgfältig durchkomponierten Bildern, die die unentschlossene Geschichte allerdings trotzdem nicht kaschieren können.
Der Held gelangt ins heilige Land und wird dort vom Hufschmied zum Verteidiger der Stadt Christi. Zwischendurch verliebt er sich in eine verheiratete Prinzessin und muss eine Glaubenskrise überwinden. Beide Handlungsstränge verliert der Film aber entweder aus den Augen oder beendet sie mit Hilfe plumper Dialoge.
Die sich dem Zuschauer unweigerlich aufdrängenden, penetranten Parallelen zu „Gladiator“, die sich zum Teil bis auf Farbgebung, Schnitt und Bildmotive erstrecken, stören ebenso, wie die zwischen bemüht wirkendem Tiefgang und handfester Aktion schwankende Handlung. Die Schlachtszenen sind erstklassig und mitreißend gemacht, lassen sich aber nicht mit dem unmotiviert aufblitzenden Pathos zu einem homogenen Ganzen zusammenfügen.
Dadurch wird jede aufkommende Gefühlsregung des Zuschauers für die Helden im Keim erstickt. Dabei sind die Schauspielerleistungen gewohnt (Liam Neeson, Jeremy Irons) bis überraschend gut (Orlando Bloom) und retten den Film über mehrere langweilige Klischees bedienende Szenen hinweg. Geradezu lächerlich ist Balians Brunnenbau mit bitterarmen Kindern, die dann selbstgebastelte Schiffchen auf dem plötzlich sprudelndem Wasser schwimmen lassen. Leider hat die Inszenierung keine Geduld für eine glaubwürdige, langsame Entwicklung ihrer Charaktere und eilt lieber plump zur nächsten Szene, zu mehr Aktion, die die Handlung vorantreiben soll.
Die am Ende des Films eingeblendeten Verweise auf die aktuelle, unruhige politische Lage im gelobten Land sind ebenso unpassend, wie der kurz vor Schluss für wenige Sekunden auftauchende Richard Löwenherz. Beides zusammen scheint dem Film eine historische Authenzität verleihen zu wollen, die völlig unangebracht ist, denn bei der Erschaffung einer eigenen Welt, wie es Scott trotz allem nach „Gladiator“ wiederum gelungen ist, sind solche Verweise fehl am Platz.
Wer sich also drei Stunden lang im 12. Jahrhundert aufhalten will und großartige Bilder liebt, ist in diesem Film genau richtig, Kinogänger, die sich gerne interessante und spannende Geschichten erzählen lassen, werden über weite Strecken enttäuscht werden.
Meinung Teil 2
Es ist durchaus legitim dieses neue Werk von Ridley Scott mit seinem Geniestreich „Gladiator“ zu vergleichen. In der Choreographie der Schlachtszenen steht er ihm in nichts nach, vermag ihn sogar zu übertreffen, was aber durch die in den letzten fünf Jahren gesetzten Maßstäbe eines Peter Jackson zu erklären ist.
Schwieriger sieht es mit der Charakterisierung des Helden aus. Dem tragischen und rachedurstigen Gladiator Maximus wird der „realpolitische“ Balian gegenübergestellt, in dessen Rolle Orlando Bloom sein „Legolas-Image“ ablegen kann, indem er konsequent Pfeil und Bogen gegen das Breitschwert tauscht. Liam Neeson hat als Mentor-Vater-Figur eine Routine entwickelt, bei der er mittlerweile Acht geben muss, dass sie nicht inflationär wird. Auch die anderen hochkarätigen Akteure, wie Jeremy Irons, oder der noch zu wenig beachtete David Thewlis zeigen, dass sie zu komplexeren Dialogen in der Lage sind, als ihnen das Drehbuch vorgibt.
Auch die „Erlöserfunktion“ ist hier etwas anders als beim Gladiator geartet. Dies mag mit der geänderten Definition von „Erlösung“ und „Sieg“ zu erklären sein. Mit der Aussage, dass sich Glauben und „gewissenhaftes Handeln“ nicht im fanatischen Festhalten an einer bestimmten Religion, oder an bestimmten Stätten erschöpft, sondern durch die aktive gute Tat und das lebendig friedliche Miteinander praktiziert wird, ergibt hier ein äußerst versöhnlicher Lösungsansatz.
Etwas kritischer ist die Aussage zu werten, dass diese „Friedensherrschaft“ nur unter einem entsprechend gütigen und gerechten König zu wahren sei. Der Frieden wird also durch diejenigen gefährdet, die sich gegen diesen Monarchen wenden. Dies wird im Film sowohl auf der christlichen, wie auf der muslimischen Seite gezeigt, wenn auch dort etwas dezenter. Die Aufrechterhaltung seiner Autorität lässt Saladin den Sieg erringen.
Fazit: Ein Werterbewustsein, das man gerne als amerikanisch bezeichnet, wird in eine Welt projiziert, in der durchschnittene Kehlen und gespaltene Köpfe, in denen „ein Brei aus Hirn und Kettenhemd angerichtet wird“ (zeitgenössische Lyrik) das Alltagsbild prägten.
Die gewaltigen Bilder und der klare Handlungsverlauf geben diesem Werk einen „massenwirksamen“ Charakter. Dadurch wird an die Tradition eines Sergej Eisenstein angeknüpft, der 1938 mit „Alexander Newski“ ästhetische und dramaturgische Maßstäbe setzte (auch für George Lucas). Wie damals muss auch hier der aktuelle politische Kontext berücksichtigt werden.
Geschrieben von Anne Schürmann, Arvid Hansmann


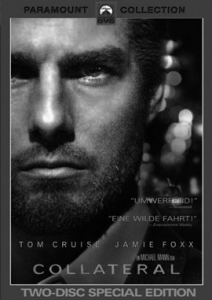 Mit Taxifahrer Max und dem Auftragsmörder Vincent, gespielt von Tom Cruise („Minority Report“), prallen zwei gänzlich verschiedene Charaktere aufeinander, deren Begegnung Spuren hinterlässt. Und damit sind nicht etwa die fünf Toten gemeint, sondern vor allem die messerscharfen Dialoge die das Leben beider verändern sollen. Von Regisseur Michael Mann („Der letzte Mohikaner“) werden nicht nur die beiden Protagonisten gekonnt in Szene gesetzt, sondern auch und vor allem Los Angeles. Es gelingt ihm, den ganz spezifischen Flair dieser Metropole einzufangen und gleichzeitig die Abgründe unserer Gesellschaft aufzutun. Wie ein Fehler im System lässt sich Vincent von Max durch die Straßen, sozusagen die Adern der Stadt fahren, und beendet mit eiskalter Präzision das Leben Fremder. Der Herzschlag der Stadt bleibt stets deutlich hörbar.
Mit Taxifahrer Max und dem Auftragsmörder Vincent, gespielt von Tom Cruise („Minority Report“), prallen zwei gänzlich verschiedene Charaktere aufeinander, deren Begegnung Spuren hinterlässt. Und damit sind nicht etwa die fünf Toten gemeint, sondern vor allem die messerscharfen Dialoge die das Leben beider verändern sollen. Von Regisseur Michael Mann („Der letzte Mohikaner“) werden nicht nur die beiden Protagonisten gekonnt in Szene gesetzt, sondern auch und vor allem Los Angeles. Es gelingt ihm, den ganz spezifischen Flair dieser Metropole einzufangen und gleichzeitig die Abgründe unserer Gesellschaft aufzutun. Wie ein Fehler im System lässt sich Vincent von Max durch die Straßen, sozusagen die Adern der Stadt fahren, und beendet mit eiskalter Präzision das Leben Fremder. Der Herzschlag der Stadt bleibt stets deutlich hörbar. Zu den beeindruckensten Gedicht-Verfilmungen gehört „Sophie“ von Hans Arp. Herman van Veen spricht mit melancholischer Schwere vom Verlust eines geliebten Menschen abwechselnd mit einer Kinderstimme aus dem Off. Zerbrochene Fensterscheiben, alte Gardinenfetzen, ein verfallenes noch möbliertes Haus, das von der Vergangenheit erzählt, aus die sich der Darsteller nicht lösen kann. Trauer und Todessehnsucht schwingen in seiner Stimme: „Jeder vergangene Tag bringt dich mir näher.“
Zu den beeindruckensten Gedicht-Verfilmungen gehört „Sophie“ von Hans Arp. Herman van Veen spricht mit melancholischer Schwere vom Verlust eines geliebten Menschen abwechselnd mit einer Kinderstimme aus dem Off. Zerbrochene Fensterscheiben, alte Gardinenfetzen, ein verfallenes noch möbliertes Haus, das von der Vergangenheit erzählt, aus die sich der Darsteller nicht lösen kann. Trauer und Todessehnsucht schwingen in seiner Stimme: „Jeder vergangene Tag bringt dich mir näher.“ Durch den tragischen Tod von Frau und Kind zu einer tödlichen Affekthandlung gedrängt, schließt er sich aber wenig später doch seinem Vater und dessen Gefolgsleuten an. In einem Hinterhalt schwer verwundet kann Godfrey seinen Sohn noch bis in die süditalienische Hafenstadt Messina begleiten, wo er ihn im Sterben zum Ritter und seinem legitimen Erben ernennt.
Durch den tragischen Tod von Frau und Kind zu einer tödlichen Affekthandlung gedrängt, schließt er sich aber wenig später doch seinem Vater und dessen Gefolgsleuten an. In einem Hinterhalt schwer verwundet kann Godfrey seinen Sohn noch bis in die süditalienische Hafenstadt Messina begleiten, wo er ihn im Sterben zum Ritter und seinem legitimen Erben ernennt.

