von Archiv | 13.04.2007
Ein persönlicher Rückblick der StuPa-Legislatur 2006/2007
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das wichtigste Organ der verfassten Studierendenschaft. In einer überaus sitzungs- und beschlussreichen Legislatur wurden in 19 Sitzungen über 190 Tagesordnungspunkte verhandelt, 154 Beschlüsse gefasst und etwa 70 Personen in die unterschiedlichsten Ämter gewählt, während gut 80 Gäste unsere hochschulöffentliche Arbeit verfolgten.
 Die 21 gewählten Mitglieder entscheiden in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft und wählen die Vertreter in die Exekutive (den AStA) und in die moritz-Medien.
Die 21 gewählten Mitglieder entscheiden in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft und wählen die Vertreter in die Exekutive (den AStA) und in die moritz-Medien.
Zu den wichtigsten Themen und Beschlüssen gehörten in der zurückliegenden Legislatur die Stellungnahme zur Rektorwahl ebenso wie die Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen der Landtagsparteien im Vorfeld der Wahlen im September letzten Jahres.
Außerdem beschloss das StuPa über seinen 170.000 Euro umfassenden Haushalt.
Weitere wichtige Beschlüsse waren die Entscheidung zur Trennung von Amt und Mandat ab der im April beginnenden Legislatur, die besagt, dass man entweder im StuPa oder im AStA oder in den Führungspositionen der moritz-Medien arbeiten darf. Doppelmitgliedschaften sind damit zukünftig ausgeschlossen.
Auch das Universitätsjubiläum 2006 wurde vom StuPa unterstützt: Es richtete im April ein entsprechendes Co-Referat und eine weitere Mitarbeiterstelle ein, um die Veranstaltungen der studentischen Selbstverwaltung zu betreuen.
Ein weiterer wichtiger Beschluss war die Zustimmung zum KiTa-Projekt, das uns seit gut zwei Jahren beschäftigt und im August umgesetzt werden soll: Eine gemeinsame KiTa mit der Universität, dem Klinikum und dem Studentenwerk Greifswald, die sich mit längeren Öffnungszeiten vor allem an Kinder für Studierende richtet.
Bereits im Juni letzten Jahres nahm das StuPa außerdem Stellung zu der wiederholten Nichtanpassung des BAföG-Satzes und forderte die Verbesserung der sozialen Situation der Studierenden. Eine entsprechende Petition liegt dem Petitionsausschuss der Deutschen Bundestages vor. Auch das leibliche Wohl der Studierenden liegt dem StuPa am Herzen: Es hält die bestehenden Kapazitäten als auch die bauliche Situation und Ausstattung der Mensa für vollkommen unzureichend. Ein entsprechender Beschluss mit der Forderung, dass bis Ende 2006 Pläne entwickelt werden sollten, wie der Bedarf an Essensportionen gedeckt werden kann, wurde mehrfach in den Senatssitzungen angesprochen. Bislang jedoch ohne Erfolg.
Insgesamt wurden 16 Finanzanträge positiv beschieden. Der Förderbetrag beläuft sich in Summe auf über 37.500 Euro.
Über die gesamte Arbeit berichteten wir ausführlich auf unserer Homepage (www.stupa.uni-greifswald.de) mittels Vorankündigungen („Aktuelles“) und „Nachbetrachtungen“ sowie insgesamt 14 Pressemitteilungen, die z.T. überregionale Beachtung fanden und zu insgesamt 3 Fernsehinterviews und einem Radiointerview führten. Auch in den moritz-Medien wurde – mitunter zu Recht kritisch – über unsere Arbeit berichtet.
Ein Höhepunkt war im letzten Oktober die Teilnahme an dem Universitätsjubiläum und dem Festakt im Dom und in der Aula, was zu den Repräsentationspflichten ebenso gehört wie die regelmäßige Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden AStA- und den monatlich stattfindenden Senats-Sitzungen.
All das wäre niemals allein möglich gewesen. Präsidiumsarbeit ist Teamarbeit. Daher möchte ich mich sehr herzlich bei Catharina Frehoff, Philipp Kohlbecher und Christopher Trippe für ihre engagierte, zielorientierte und zuverlässige Arbeit im Präsidium bedanken.
Außerdem danke ich dem AStA-Vorsitzenden Alexander Gerberding für die gute und harmonische Zusammenarbeit im letzten Jahr. Abschließend möchte ich auch denjenigen StuPistinnen danken, die trotz der mitunter langen Sitzungen regelmäßig zu ihrer ehrenamtlichen Arbeit erschienen sind und sehr lebhaft und ausdauernd diskutierten, immer mit dem Ziel, tragfähige und sinnvolle Beschlüsse zu erzielen.
Geschrieben von Kathrin Berger, Präsident des Studierendenparlamentes
von Archiv | 13.04.2007
So wetterte Ernst Moritz Arndt 1848 in seinen „Reden und Glossen“:
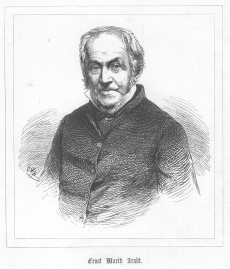 „Juden und Judengenossen, getaufte und ungetaufte, arbeiten unermüdlich und auf allen äußersten radikalen Linken mitsitzend, an der Zersetzung und Auflösung dessen, worin uns Deutschen bisher unser menschliches und heiliges eingefaßt schien, an der Auflösung jeder Vaterlandsliebe und Gottesfurcht… Horcht und schaut, wohin diese giftige Judenhumanität mit uns fahren würde, wenn wir nichts eigentümliches, deutsches dagegenzusetzen hätten…“.
„Juden und Judengenossen, getaufte und ungetaufte, arbeiten unermüdlich und auf allen äußersten radikalen Linken mitsitzend, an der Zersetzung und Auflösung dessen, worin uns Deutschen bisher unser menschliches und heiliges eingefaßt schien, an der Auflösung jeder Vaterlandsliebe und Gottesfurcht… Horcht und schaut, wohin diese giftige Judenhumanität mit uns fahren würde, wenn wir nichts eigentümliches, deutsches dagegenzusetzen hätten…“.
Ortag, Peter: Jüdische Kultur und Geschichte. Ein Überblick., 5. aktualisierte Auflage, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Potsdam, 2004, S. 100.
Zitiert: „Reden und Glossen“, Ernst Moritz Arndt, 1948.
Geschrieben von Ernst Moritz Arndt
von Archiv | 13.04.2007
Engagierte Greifswalder starten Hilfsprojekt realCITY
Wie viel Zeit er früher am Computer verbracht hat, ist nicht zu erfahren, doch klar ist, dass es Peter Eitel irgendwann nicht mehr reichte, nur in der virtuellen Welt von „SimCity“ Straßen, Häuser und Flughäufen zu bauen.
 Er wollte wirklich etwas tun. So kam ihm im Sommer 2005 die Idee, ein Projekt ins Leben zu rufen, bei dem Studenten das theoretische Wissen, das sie in Vorlesungen und Seminaren erworben haben, in der Praxis anwenden konnten.
Er wollte wirklich etwas tun. So kam ihm im Sommer 2005 die Idee, ein Projekt ins Leben zu rufen, bei dem Studenten das theoretische Wissen, das sie in Vorlesungen und Seminaren erworben haben, in der Praxis anwenden konnten.
Dass Entwicklungszusammenarbeit einen hierfür geeigneten Rahmen bieten könnte, war dem Politikstudenten schnell klar, da er vor dem Beginn seines Studiums selbst ein Jahr als freiwilliger Entwicklungshelfer in Guatemala gearbeitet hatte. Ein Name war schnell gefunden und so konnte „realCITY“ starten. „Am Anfang waren wir nur zu siebt“, erinnert sich Peter Eitel heute. Ein Verein wurde dennoch bald darauf gegründet und die Fühler nach Partnerprojekten in einem Entwicklungsland ausgestreckt. Nach langer, nicht immer einfacher Suche, fanden Peter und seine Hand voll Mitstreiter schließlich mit der Hilfsorganisation „Mayan Hope“ in Nebaj in Guatemala einen noch jungen Partner, der die Vorstellungen der Greifswalder teilte.
Mit Interesse und Begeisterung
Nun, es war bereits Winter geworden, hieß es auch diesseits des Ozeans Mitstreiter für das Projekt zu gewinnen. Studenten und Professoren sollten es sein, so viel war sicher. Und interdisziplinär sollte das Projekt ja auch angelegt sein. Doch wen konnte man ansprechen? Wer würde Interesse haben? Studenten und Professoren aller Fachrichtungen ein Projekt anzubieten, das ihren fachlichen und persönlichen Interessen entspricht und für das sie sich begeistern können, kommt einer Quadratur des Kreises recht nahe.
Um dem hohen akademischen Anspruch gerecht zu werden und Professoren verschiedener Institute zu gewinnen, musste die Idee der hilfsbereiten Studenten zunächst zu Papier gebracht werden. Es entstand eine 25 Seiten starke Projektbeschreibung, die Idee, Ablauf und Struktur von realCITY enthielt. Diese im Gepäck, wurden Kontakte geknüpft, und schließlich akademische Unterstützung gefunden.
Doch im Mittelpunkt des Projektes standen und stehen natürlich die Studenten. Eine Informationsveranstaltung im Frühjahr 2006, in der das Projekt interessierten Studiosi vorgestellt wurde, war ein voller Erfolg: Von 50 Zuhörern wurden noch am selben Abend 30 von ihnen zu Projektteilnehmern. realCITY konnte starten.
Über Grenzen hinaus
Im Sommersemester 2006 nahmen 32 Studenten der Greifswalder Universität ihre Arbeit in verschiedenen Projektgruppen auf. Gegliedert in die drei Arbeitsgruppen Geschichte/Politik, Medizin und Wirtschaft setzten sich die Experten, also Studenten der jeweiligen Fachrichtung, mit Guatemala auseinander. Die Gruppe „Public Relations“ kümmerte sich parallel um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins um ihm auch über die Grenzen Greifswalds hinaus zu Bekanntheit zu verhelfen. So entstanden während des Sommersemesters 2006 bereits konkrete Ideen, wie die Menschen in Nebaj ihr Leben verbessern könnten – immer in enger Abstimmung mit der Hilfsorganisation Mayan Hope, die die Menschen vor Ort betreut.
Um sich ein eigenes Bild von „ihrem“ Projekt zu machen, reiste schließlich im August 2006 eine Gruppe von elf Greifswaldern auf eigene Kosten nach Nebaj und kehrte tief beeindruckt zurück. So trauten die beteiligten Medizinstudenten ihren Ohren kaum als sie erfuhren, dass für die etwa 250.000 Menschen der Region nur ein einziges Krankenhaus mit 35 Betten zu Verfügung steht.
Die unglaublichen Erfahrungen sowie intensive persönliche Gespräche mit den Menschen vor Ort inspirierten die Greifswalder zu neuen Projekten, die sie mit großem Enthusiasmus im vergangenen Wintersemester vorantrieben. So wollen sie zum einen das örtliche Krankenhaus finanziell und materiell unterstützen. Zum anderen planen die angehenden Ärzte einen Austausch von deutschen und guatemaltekischen Medizinstudenten mit jeweiliger Famulatur im anderen Land.
Auch die anderen Projektgruppen stehen dem in nichts nach. Während sich die Gruppe Geschichte/Politik mit den Wahlen in Guatemala im kommenden Jahr beschäftigt, möchte die Wirtschaftsgruppe ein Internetcafé in Nebaj einrichten und fair gehandelter Kaffee aus der Region in Greifswald verkauften. Jeder macht das, was er am besten kann zum Wohle aller. Auf diesen Nenner könnte man das Konzept von realCITY bringen. Der Verein selbst sieht sich dabei als unentgeltlicher Dienstleister für kleinere Entwicklunsghilfsorganisationen wie eben Mayan Hope, als Bindeglied und Koordinationsstelle zugleich.
Knappe Kasse
Natürlich kann dies nur mit der tatkräftigen Unterstützung vieler geschehen. Geld ist knapp und realCITY ist auf Spenden angewiesen. „Der Schritt an andere Universitäten, die sich dann mit anderen Projekten in anderen Ländern beschäftigen, ist leider noch nicht gelungen“, beschreibt Peter einen Traum, der jedoch bald wahr werden könnte. Kontakte nach Augsburg bestehen bereits. Für diejenigen, die die Reise nach Guatemala selbst scheuen, aber trotzdem sehen möchten, wie es dort aussieht, hat der Verein am 21. September im Amtsgericht die Ausstellung „Kulturelle Vielfalt in Guatemala“ von Diego Molina vorbereitet. Dafür lohnt es sich doch, den Platz vor dem Computer zu verlassen.
Geschrieben von Kai Doering
von Archiv | 13.04.2007
Der 29. Deutsche Kunsthistorikertag in Regensburg
Was verbindet man mit den Buchstaben KSK? In erster Linie sicher uniformierte Soldaten, die durch die karge Bergwelt Afghanistans schleichen.
 Doch KSK steht auch für „Künstlersozialkasse“, eine Institution, die in einem vermeintlich „brotlosen Gewerbe“ für eine gewisse Absicherung sorgen soll. Ob nun diejenigen, die vorrangig nicht selbst Kunst produzieren, sondern sich in theoretisch-wissenschaftlicher Weise mit ihr auseinandersetzen, ebenfalls ein Anrecht auf diese Unterstützung haben sollten, war eine der Fragen, die auf einem Forum über den „Kunsthistoriker als Freiberufler“ diskutiert wurden. Das Forum war ein Bestandteil des 29. Deutschen Kunsthistorikertages, der vom 14. bis 18. März 2007 in der Universität Regensburg stattfand. Die Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern und 96 Referenten aus dem In- und Ausland gliederte sich in eine Vielzahl von Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen. So reichte die Auswahl von mittelalterlicher Kathedralarchitektur über Raumkonstruktionen im Film bis zur Kunstgeschichte im digitalen Zeitalter. PD Dr. Ulrich Fürst, der zurzeit den immer noch vakanten Lehrstuhl für Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut vertritt, leitete die Sektion „Asien blickt auf Europa“, in der die Sicht des fernen Ostens auf die okzidentale Kultur punktuell aufgezeigt wurde.
Doch KSK steht auch für „Künstlersozialkasse“, eine Institution, die in einem vermeintlich „brotlosen Gewerbe“ für eine gewisse Absicherung sorgen soll. Ob nun diejenigen, die vorrangig nicht selbst Kunst produzieren, sondern sich in theoretisch-wissenschaftlicher Weise mit ihr auseinandersetzen, ebenfalls ein Anrecht auf diese Unterstützung haben sollten, war eine der Fragen, die auf einem Forum über den „Kunsthistoriker als Freiberufler“ diskutiert wurden. Das Forum war ein Bestandteil des 29. Deutschen Kunsthistorikertages, der vom 14. bis 18. März 2007 in der Universität Regensburg stattfand. Die Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern und 96 Referenten aus dem In- und Ausland gliederte sich in eine Vielzahl von Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen. So reichte die Auswahl von mittelalterlicher Kathedralarchitektur über Raumkonstruktionen im Film bis zur Kunstgeschichte im digitalen Zeitalter. PD Dr. Ulrich Fürst, der zurzeit den immer noch vakanten Lehrstuhl für Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut vertritt, leitete die Sektion „Asien blickt auf Europa“, in der die Sicht des fernen Ostens auf die okzidentale Kultur punktuell aufgezeigt wurde.
Dass ein Schwerpunkt der Umgang mit mittelalterlicher Bausubstanz im Kontext von Denkmalpflege und Städtebau nach 1945 war, wurde schnell aufgrund der lokalen Gegebenheiten verständlich. Wie in Greifswald hatte die Regensburger Altstadt den Krieg halbwegs unbeschadet überstanden. Der desolate Zustand der verwinkelte Bausubstanz wurde in den 1950er und 60er Jahren als Argument herangezogen, um das Ideal der „autogerechten Stadt“ zu realisieren. Etliches fiel den Straßenerweiterungen zum Opfer. Einige Schreckenszenarien konnten jedoch verhindert werden. So bleibt eine vierspurige Überführung parallel zur „Steinernen Brücke“ aus dem 12. Jahrhndert, der ältesten erhaltene Donauquerung überhaupt, glücklicherweise eine Hypothese.
Grau in Grau
Wie die Moderne hätte „wüten“ können, zeigt sich an dem Campusgelände. Vom Audimax bis zur Mensa erscheint alles als ein zusammenhängender Komplex aus grauem Sichtbeton. Mit den Terrassenanlagen, Teichen und spärlichen Grünflächen machen die kubischen Formen fast den Eindruck als hätte Albert Speer den Auftrag erhalten, einen japanischen Garten zu gestalten.
Auf der begleitenden Messe präsentierten sich Institutionen wie das digitale Bildarchiv „prometheus“ ebenso, wie zahlreiche Kunstverlage, deren prächtige Bildbände trotz der zuletzt gewährten 30 Prozent Rabatt immer noch schwer erschwinglich waren. Doch der Messebereich wurde weniger zum Erwerb, als vielmehr für das Gespräch genutzt – generell galt hier das Prinzip „sehen und gesehen werden“. Ob nun zur selbstbewussten Darlegung des eigenen Forschungsstandes, oder mit der Hoffung verbunden, eine der raren sicher bezahlten Stellen zu ergattern, der Inhalt des zuvor gehörten Vortrages war oft nur „Aufhänger“ um in den Dialog zu treten. So konnte man aber auch ganz unkonventionell auf der „Bierzeltgarnitur“ in Foyer mit dem chinesischen Professor Zhu Qingsheng über das von ihm betreute „Museum of World Art“ in Peking sprechen.
Die begleitende Ausstellung zu Geschichte der Synagogen in Deutschland in der benachbarten UB fand aufgrund der peripheren Lage nur wenig Resonanz. Verschiedene Fachexkursionen rundeten das Programm ab. Dort konnte man beispielsweise etwas über die jüdischen Spuren in Regensburg erfahren. Studenten nahmen in dieser Szenerie oft nur eine rezipierende Rolle ein. Aber trotz all der ökonomischen Schwarzmalerei sollte den angehenden Kunthistorikern bewusst werden, welch ein interessantes Themenspektrum ihr Studium zu bieten hat.
Geschrieben von Arvid Hansmann
von Archiv | 13.04.2007
Futurama in Kopenhagen
Kopenhagen hat es laut The Economist schon auf Platz drei der teuersten Städte gebracht. In einer Umfrage aus dem brandeins-Magazin geben 66 Prozent der Dänen an mit ihrem Leben zufrieden zu sein, im Vergleich dazu: nicht einmal 20 Prozent der Deutschen behaupten das von ihrem Dasein.
 In Kopenhagen scheint es neben dem Regen auch Millionen von Kronen hernieder zu prasseln. Alles modernisiert, alles neu und alles doch zu perfekt.
In Kopenhagen scheint es neben dem Regen auch Millionen von Kronen hernieder zu prasseln. Alles modernisiert, alles neu und alles doch zu perfekt.
Wohnheim als Touristenmagnet
Dass die skandinavischen Länder bekannt sind für Design ist klar, aber beim Besuch des Tietgen-Studentenwohnheims im Stadtteil Orestad in Kopenhagen kippt einem schon die Kinnlade herunter. Das Wohnhaus wurde 2005 gebaut und ist jetzt schon ein Touristenmagnet für Design-Interessierte. Holz, Glas und Beton dominieren den Rundbau. Zum Innenhof hin befinden sich die Gemeinschaftsküchen und Megaterassen, während nach außen des Gebäudes die Zimmer sind. Das Besondere ist, dass alle Räume komplett verglast sind. Geht also im gegenüberliegenden Innenhofblock gerade eine wilde Party ab, nimmt sich der moderne Däne seine Chipkarte zur Hand und hat Eintritt in jede Etage des „Rundblocks“. Das ganze futuristische Gefühl wird verstärkt durch das Nicht-Vorhandenseins von Tapeten, ein wenig Wärme spendet Holz im Camouflage-Look. Alles wirkt sehr industriell, durchsichtig und schwer betonklotzig. Das scheint die dänische Vorstellung vom modernen Leben zu sein. Kein Stopp ist in Sicht, denn gleich neben dem Wohnheim wird ein komplett neues Viertel hochgezogen, eine Mischung aus Uni-Campus und Wohnviertel. Wem das alles zu krass wird, der kann bei der klassischen Kopenhagen-Tour bleiben und romantische Fotos mit der Meerjungfrau machen. Übrigens: Der gemeine dänische Student bekommt 600 Euro im Monat vom Staat geschenkt, geht meist zusätzlich arbeiten, trinkt 5-Euro-teures Plörrenbier, fährt ebenfalls viel Fahrrad und trägt Leggings.
Geschrieben von Maria-Silva Villbrandt
 Die 21 gewählten Mitglieder entscheiden in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft und wählen die Vertreter in die Exekutive (den AStA) und in die moritz-Medien.
Die 21 gewählten Mitglieder entscheiden in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft und wählen die Vertreter in die Exekutive (den AStA) und in die moritz-Medien.
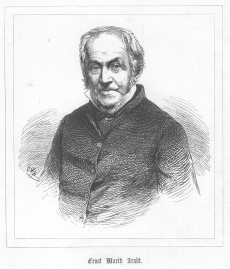 „Juden und Judengenossen, getaufte und ungetaufte, arbeiten unermüdlich und auf allen äußersten radikalen Linken mitsitzend, an der Zersetzung und Auflösung dessen, worin uns Deutschen bisher unser menschliches und heiliges eingefaßt schien, an der Auflösung jeder Vaterlandsliebe und Gottesfurcht… Horcht und schaut, wohin diese giftige Judenhumanität mit uns fahren würde, wenn wir nichts eigentümliches, deutsches dagegenzusetzen hätten…“.
„Juden und Judengenossen, getaufte und ungetaufte, arbeiten unermüdlich und auf allen äußersten radikalen Linken mitsitzend, an der Zersetzung und Auflösung dessen, worin uns Deutschen bisher unser menschliches und heiliges eingefaßt schien, an der Auflösung jeder Vaterlandsliebe und Gottesfurcht… Horcht und schaut, wohin diese giftige Judenhumanität mit uns fahren würde, wenn wir nichts eigentümliches, deutsches dagegenzusetzen hätten…“.  Er wollte wirklich etwas tun. So kam ihm im Sommer 2005 die Idee, ein Projekt ins Leben zu rufen, bei dem Studenten das theoretische Wissen, das sie in Vorlesungen und Seminaren erworben haben, in der Praxis anwenden konnten.
Er wollte wirklich etwas tun. So kam ihm im Sommer 2005 die Idee, ein Projekt ins Leben zu rufen, bei dem Studenten das theoretische Wissen, das sie in Vorlesungen und Seminaren erworben haben, in der Praxis anwenden konnten. Doch KSK steht auch für „Künstlersozialkasse“, eine Institution, die in einem vermeintlich „brotlosen Gewerbe“ für eine gewisse Absicherung sorgen soll. Ob nun diejenigen, die vorrangig nicht selbst Kunst produzieren, sondern sich in theoretisch-wissenschaftlicher Weise mit ihr auseinandersetzen, ebenfalls ein Anrecht auf diese Unterstützung haben sollten, war eine der Fragen, die auf einem Forum über den „Kunsthistoriker als Freiberufler“ diskutiert wurden. Das Forum war ein Bestandteil des 29. Deutschen Kunsthistorikertages, der vom 14. bis 18. März 2007 in der Universität Regensburg stattfand. Die Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern und 96 Referenten aus dem In- und Ausland gliederte sich in eine Vielzahl von Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen. So reichte die Auswahl von mittelalterlicher Kathedralarchitektur über Raumkonstruktionen im Film bis zur Kunstgeschichte im digitalen Zeitalter. PD Dr. Ulrich Fürst, der zurzeit den immer noch vakanten Lehrstuhl für Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut vertritt, leitete die Sektion „Asien blickt auf Europa“, in der die Sicht des fernen Ostens auf die okzidentale Kultur punktuell aufgezeigt wurde.
Doch KSK steht auch für „Künstlersozialkasse“, eine Institution, die in einem vermeintlich „brotlosen Gewerbe“ für eine gewisse Absicherung sorgen soll. Ob nun diejenigen, die vorrangig nicht selbst Kunst produzieren, sondern sich in theoretisch-wissenschaftlicher Weise mit ihr auseinandersetzen, ebenfalls ein Anrecht auf diese Unterstützung haben sollten, war eine der Fragen, die auf einem Forum über den „Kunsthistoriker als Freiberufler“ diskutiert wurden. Das Forum war ein Bestandteil des 29. Deutschen Kunsthistorikertages, der vom 14. bis 18. März 2007 in der Universität Regensburg stattfand. Die Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern und 96 Referenten aus dem In- und Ausland gliederte sich in eine Vielzahl von Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen. So reichte die Auswahl von mittelalterlicher Kathedralarchitektur über Raumkonstruktionen im Film bis zur Kunstgeschichte im digitalen Zeitalter. PD Dr. Ulrich Fürst, der zurzeit den immer noch vakanten Lehrstuhl für Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut vertritt, leitete die Sektion „Asien blickt auf Europa“, in der die Sicht des fernen Ostens auf die okzidentale Kultur punktuell aufgezeigt wurde. In Kopenhagen scheint es neben dem Regen auch Millionen von Kronen hernieder zu prasseln. Alles modernisiert, alles neu und alles doch zu perfekt.
In Kopenhagen scheint es neben dem Regen auch Millionen von Kronen hernieder zu prasseln. Alles modernisiert, alles neu und alles doch zu perfekt. 

