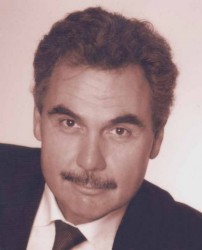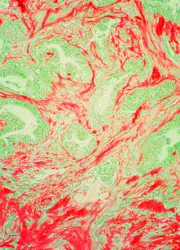Uns Studenten interessiert an der Universität in erster Linie meist die Lehre, doch natürlich wird hier in Greifswald auch geforscht. In der Serie “Nachgeforscht” wollen wir einzelne Projekte und die Menschen dahinter vorstellen.
Das Universitätsklinikum Greifswald hat sich an der bislang weltweit größten klinischen Studie zu Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinomen) beteiligt.
Zudem wurde das Greifswalder Pankreaszentrum als das erste in Mecklenburg-Vorpommern als Kompetenzzentrum zertifiziert. Auch beginnt ab März diesen Jahres die EU-Förderung eines Grundlagenprojektes zur weiteren Erforschung von Pankreastumoren.
Die Bauchspeicheldrüse oder Pankreas ist entscheidend am Verdauungsvorgang beteiligt. Sie sitzt unter dem Magen und vor der Wirbelsäule. Dieses zwischen 15 und 20 Zentimeter große Organ wird 70 bis 100 Gramm schwer und produziert täglich anderthalb Liter eines Bauchspeichel genannten Sekretes, welches Verdauungsenzyme enthält. Zudem gibt sie stoffwechselsteuernde Hormone wie Insulin an das Blut ab.
Prof. Markus M. Lerch, Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin A, unterhielt sich mit dem webMoritz über die vergangene und zukünftige Forschungsarbeit.
webMoritz: Herr Professor Lerch, könnten Sie die klinische Studie zum Bauchspeicheldrüsenkrebs, an der sich das Greifswalder Universitätsklinikum beteiligt hat, und ihre Hintergründe einmal näher erläutern?
Prof. Lerch: Pankreaskrebs tritt zwar nicht so häufig auf wie etwa Brust-, Magen- oder Prostatakrebs, aber er ist viel bösartiger als diese Krebssorten. Es handelt sich hier um den vierthäufigsten zum Tode führenden Krebs. Bei Darmkrebs zum Beispiel beträgt die Chance, die ersten fünf Jahre zu überleben, durchschnittlich etwa 70 bis 80 Prozent. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs hingegen sind nur etwa ein Viertel der Betroffenen nach der gleichen Zeitspanne noch am Leben, und das auch nur unter optimalen Bedingungen.
Es ist sehr schwierig, diese Krebsart zu behandeln. Die wichtigste Behandlungsmöglichkeit ist die Operation. Sie ist auch die einzige, von der man weiß, dass sie zur Heilung führen kann. Und die Ergebnisse der Chirurgie kann man verbessern, wenn man anschließend bei den Patienten noch eine Chemotherapie durchführt.
Chemotherapie verdoppelt Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten
Aus einer vorausgegangenen Studie wussten wir bereits, dass sich die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten bei anschließender Chemotherapie verdoppelt. Es gab zwei verschiedene Chemotherapien, die dieses Ergebnis erzielt haben, aber keinen direkten Vergleich.
Genau dieser war dann Inhalt der Studie, an der wir uns zusammen mit 158 anderen Kliniken beteiligt haben. Wir haben die eine nach dem Zufall ausgewählte Hälfte der insgesamt 1.088 Patienten aus 17 Ländern mit der einen Therapie behandelt, die andere mit der anderen.
Dann haben wir ausgewertet, wie viele Patienten nach fünf Jahren noch leben. Und es hat sich herausgestellt, dass beide Chemotherapien gleich gut sind. Aber die Nebenwirkungen – vor allem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Entzündung der Mundschleimhäute – sind bei der einen weniger ausgeprägt.
Die besser verträgliche Chemotherapie wird mit dem Medikament Gemcitabin durchgeführt, etwas mehr Nebenwirkungen führt die Therapie mit 5-Fluoruracil mit sich, ein schon sehr lange bekanntes Chemotherapeutikum. Bei beiden handelt es sich um sogenannte Zytostatika, sie hemmen das Zellwachstum.
In Zukunft wird also vermehrt das mit weniger Nebenwirkungen verbundene Gemcitabin verwendet werden.
Zertifizierung bringt Vorteile für Patienten
webMoritz: Am 10. Januar diesen Jahres wurde das Greifswalder Pankreaskarzinomzentrum als das erste seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern zertifiziert. Welchen Effekt hat diese Zertifizierung für das Klinikum und die Patienten?
Prof. Lerch: Es gibt in Deutschland nur wenige Zentren, die sich auf Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse spezialisiert haben. Das gilt sowohl für die Pankreatitis, also die Entzündung der Bauchspeicheldrüse, als auch für den Pankresaskrebs. Bei einer nicht zertifizierten Einrichtung hängt es von dem behandelnden Arzt und dessen Spezialkenntnissen ab, welche Behandlung der Patient erhält. Mark Twain hat es so ausgedrückt: „If all a man has is a hammer, the whole world looks like a nail“.
Ein zertifiziertes Zentrum versucht dies zu vermeiden. Ausnahmslos jeder Patient mit einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung wird mit allen Befunden in einer sogenannten Tumorkonferenz vorgestellt. Hier sitzen dann mehrere Spezialisten verschiedener Fächer – Chirurgie, Strahlentherapie, Pathologie, Gastroenterologie, Hämatoonkolgie et cetera. Jeder Fall wird einzeln besprochen und im Konsens und nach den neuesten Leitlinien die beste Behandlungsmöglichkeit für diesen bestimmten Patienten beschlossen.
Es ist auch jedem Patienten zu empfehlen, ein solches Zentrum aufzusuchen. Denn eines ist leider gezeigt worden: Je spezialisierter eine Klinik ist und je mehr Patienten sie behandelt, desto besser sind die Ergebnisse. Das ist beispielsweise bei der Pankreaschirurgie ganz deutlich. Wenn man im Jahr nur zweimal einen solchen Tumor operiert, ist die Sterblichkeit der Patienten viel höher, als wenn man diesen Eingriff zehn- oder zwanzigmal vornimmt. Je mehr Erfahrung das Zentrum und auch der einzelne Chirurg hat, desto besser ist die Prognose für den Patienten, nach fünf Jahren noch am Leben zu sein.
Das läuft natürlich ein bisschen entgegen den Vorstellungen der Politik, eine möglichst ortsnahe Versorgung zu schaffen.
Auch die Patienten stehen vor der Wahl, entweder eine lange Wegstrecke auf sich zu nehmen, um zu einem wirklichen Spezialisten für die Krankheit zu gelangen, oder in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu gehen, wo die Behandlung auch nicht unbedingt schlecht ist.
Sicher ist es angenehmer, ein Krankenhaus in der Nähe aufzusuchen. Aber für einige, wenn auch längst nicht für alle Erkrankungen, ist ganz klar gezeigt, dass die spezialisierten Zentren viel bessere Ergebnisse haben als die Allgemeinkrankenhäuser. Sowohl die Pankreatitis, als auch das Pankreaskarzinom gehören dazu.
Bei Brustkrebs beispielsweise werden inzwischen 70 bis 80 Prozent aller Patientinnen in solchen spezialisierten Einrichtungen behandelt. Ähnlich werden sich auch die Pankreaszentren etablieren.
Die Zentren bekommen zumindest in Mecklenburg-Vorpommern bislang auch nicht mehr Geld für einen Fall. Die Zertifizierung bringt also weniger einen Vorteil für die Krankenhäuser mit sich, als vielmehr für die Patienten.
webMoritz: Die Europäische Union fördert ab März diesen Jahres ein Grundlagenprojekt zur Erforschung der sogenannten Tumormikroumwelt, um die Heilungschancen von betroffenen Patienten zu verbessern. Was kann man sich hierunter vorstellen?
Fortschritte reichen noch nicht aus, um Patienten zu heilen
Prof. Lerch: Die Studie zur Tumormikroumwelt ist keine klinische Studie, in der man Medikamente testet, sondern Grundlagenforschung, in der untersucht wird, wie der Tumor eigentlich funktioniert und wie man neue Medikamente entwickeln kann, um ihn zu bekämpfen.
Einer der Gründe, warum man beispielsweise Brustkrebs mit einer Chemotherapie relativ gut behandeln kann und den
Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht, ist die sogenannte Mikroumwelt. Der Pankreastumor hat eine sehr enge Beziehung zu den Bindegewebszellen um ihn herum. Und diese bilden einen massiven Panzer aus Narbengewebe um die Tumorzellen. Das führt zum Einen dazu, dass sich Tumor- und Bindegewebe gegenseitig beeinflussen, etwa das Wachstum steigern können. Und zum Anderen verhindert das Narbengewebe, dass die Chemotherapie den Tumor überhaupt erreicht. Das macht ihn so extrem schwierig zu behandeln.
In dem EU-Projekt arbeiten Fachleute verschiedener Spezialgebiete aus mehreren Ländern zusammen, um herauszufinden, wie verantwortlich für die Therapieresistenz diese Tumormikroumwelt ist und wie man sich dieses zunutze machen kann. Vielleicht muss man beispielsweise erst die Zellen, die für das Narbengewebe verantwortlich sind entfernen und kann dann den Tumor viel besser behandeln.
Wie viel Zeit diese Forschung insgesamt in Anspruch nehmen wird, ist ganz schwer zu sagen. Ich selbst beschäftige mich seit etwa 15 Jahren mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir haben zwar in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, sie reichen aber immer noch nicht aus, um einen einzelnen Patienten wirklich zu heilen. Bislang können wir nur Leben verlängern und Leiden lindern.
Von der Erforschung der Tumormikroumwelt erhoffen wir uns jetzt Durchbrüche für die Behandlung der Patienten. Jetzt wird erstmals nicht mehr nur auf den Tumor an sich fokussiert, sondern auch auf die Tumorumgebung. Erst seit wenigen Jahren wird überhaupt über diesen Ansatz nachgedacht.
webMoritz: Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Auf welchem Weg sind denn Sie persönlich zu diesem Forschungsgebiet gelangt?
Prof. Lerch: Vor mehr als 20 Jahren habe ich angefangen, mich für die Bauchspeicheldrüse zu begeistern. Das habe ich vor allem dem fantastischen Betreuer meiner Doktorarbeit, die schon von der Bauchspeicheldrüse handelte, zu verdanken.
Dann habe ich in allen wissenschaftlichen und klinischen Stationen, die ich durchlaufen habe – und das waren ziemlich viele – immer mehr in diesem Bereich sowohl klinische als auch Grundlagenforschung betrieben.
Auch beeinflusst haben mich die Arbeiten des Nobelpreisträgers George Palade aus den siebziger Jahren. Er hat als Erster die Bauchspeicheldrüse unter dem Elektronenmikroskop untersucht. Hier hat er herausgefunden, wie Eiweiße grundsätzlich durch eine Zelle geschleust werden. Diese fundamentalen Arbeiten beschäftigen uns heute noch. Enzyme werden viel zielgerichteter durch die Azinuszellen [Azinus: funktionelle Einheit einer Drüse, Anm. d. Red.] des Pankreas transportiert, als dies in den Zellen aller anderen Organe geschieht. Es gibt eigentlich kein besseres Modell für dies Synthese, den Transport und die Ausscheidung von Eiweißen als die Pankreaszelle.
Die Bauchspeicheldrüse ist also nicht nur von der klinischen Seite her durch die schweren Erkrankungen, die bei ihrer Fehlfunktion ausgelöst werden, ein wichtiges Thema, sondern auch wissenschaftlich äußerst spannend. Es ist nach wie vor das faszinierendste Organ, das mir bislang begegnet ist.
„Greifswald bietet ein phantastisches Umfeld“
webMoritz: Und was hat Sie nach Greifswald geführt?
Prof. Lerch: Greifswald bietet ein phantastisches Umfeld. Ich hatte vorher eine Professur in Münster und habe dann einen Ruf für den Lehrstuhl für Gastroenterologie, Stoffwechsel und Ernährungsmedizin in Greifswald angenommen. Hier arbeite ich mit einer relativ großen Gruppe von etwa 20 Wissenschaftlern und Doktoranden zusammen. Auch bietet sich mir hier ein hervorragendes Forschungsumfeld. Wir arbeiten mit einer ganzen Reihe anderer Gruppen zusammen, sowohl hier in Greifswald in der SHIP Studie, im GANI-MED Projekt und verschiedenen Graduiertenkollegs, als auch mit Gruppen im Ausland. Zudem ist mein chirurgischer Partner hervorragend. Diese Arbeitsbedingungen machen mir schon sehr große Freude.
Hinzu kommt, dass ich ein Freund des Segelns und der See bin. Auch meine Familie fühlt sich hier außerordentlich wohl. Es war also die richtige Wahl für mich, nach Greifswald zu gehen.
webMoritz: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!