von Archiv | 13.04.2007
Prof. Dr. Walter Werbeck
Professor für Musikwissenschaften mit dem Schwerpunkt in der Kirchenmusik
 1952
1952
in Bochum geboren
studierte zunächst die Fächer Schulmusik für Gymnasien (1. Staatsexamen), Kirchenmusik (A-Prüfung) und Klavier (Staatl. Prüfung für Musiklehrer) an der Hochschule für Musik in Detmold, außerdem Geschichte an der Universität Bielefeld
Nahm dann das Studium der Musikwissenschaft bei Arno Forchert am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn auf
1987
Disssertation „Studien zur deutschen Tonartenlehre in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts“ wurde promoviert (die Arbeit erschien unter dem gleichen Titel 1989 im Bärenreiter-Verlag Kassel im Druck, als Band 1 der „Detmold-Paderborner Beiträge zur Musikwissenschaft“).
1995
Habilitation erfolgte ebenfalls an der Universität Paderborn; die Habilitationsschrift „Die Tondichtungen von Richard Strauss“ ist 1996 im Verlag Hans Schneider (Tutzing) erschienen (als Band 2 der „Dokumente und Studien zu Richard Strauss“).
1982 bis 1992
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn und lehrte anschließend in Bonn, Marburg, Basel, Detmold/Paderborn, Kiel und Greifswald.
1999
Professor für Musikwissenschaft mit einem Schwerpunkt in der Kirchenmusik am Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Universität Greifswald.
Werbecks Veröffentlichungen konzentrieren sich zum einen auf Editionen und Schriften zur deutschen Musik des frühen 17. Jahrhunderts.
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang seine Arbeit als Herausgeber des „Schütz-Jahrbuches“ sowie als Editionsleiter der „Neuen Schütz-Ausgabe“; in der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft arbeitet er im Vorstand mit.
Hinzu kommt seine Tätigkeit als Fachbeirat „Deutschland, 17. Jahrhundert“ für den Personenteil der Neuauflage der Enzyklopädie „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“ (Stuttgart und Kassel).
Einen weiteren Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit Werbecks bildet die Musik des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Insbesondere zu Leben und Werk von Richard Strauss hat er zahlreiche Beiträge publiziert.
Erschienen sind schließlich in der letzten Zeit mehrere Beiträge zur Musica baltica. Zusammen mit Greifswalder Kollegen gibt Werbeck die „Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft“ (Peter-Lang-Verlag Frankfurt/M. u. a.) heraus.
von Archiv | 13.04.2007
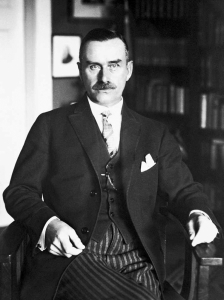 Der Musik fühlte sich Thomas Mann (1875 – 1955) Zeit seines Lebens verbunden. Durch den Gesang und das Klavierspiel der Mutter für sie interessiert. lernt er Violine. Sein technisches Können ist so weit entwickelt, dass er die Violinsonate Richard Strauss spielen konnte. Der spätere Träger des Literaturnobelpreises entschied sich für das Schreiben.
Der Musik fühlte sich Thomas Mann (1875 – 1955) Zeit seines Lebens verbunden. Durch den Gesang und das Klavierspiel der Mutter für sie interessiert. lernt er Violine. Sein technisches Können ist so weit entwickelt, dass er die Violinsonate Richard Strauss spielen konnte. Der spätere Träger des Literaturnobelpreises entschied sich für das Schreiben.
Besonderen Eindruck auf sein Hören und Schaffen macht auf ihn die Musik Richard Wagners. Der Protest der Richard-Wagner-Stadt Münchengab ihm einen Anstoß für die schließlich 1938 erfolgte Emigration in die USA. Hier lehrt er in Princeton als Gastprofessor.
In seinem Musikroman „Doktor Faustus“ (1947) setzt sich Mann mit dem Verhältnis bindung von Musik und Politik auseinander. Zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheint dazu der Selbstkommentar „Die Entstehung des Doktor Faustus“.
Geschrieben von Uwe Roßner
von Archiv | 13.04.2007
Komponist, Dirigent
1864-1949
 1864
1864
11. Juni: Richard Strauss wird als Sohn des Musikers Franz Strauss und dessen Frau Josephine (geb. Pschorr) in München geboren.
ab 1882
Er studiert einige Semester Philosophie, Kunstgeschichte und Ästhetik an der Münchener Universität.
Erste Kompositionen entstehen.
1885
Herzoglicher Hofkapellmeister in Meiningen.
1886
Strauss wird als dritter Kapellmeister an die Münchner Hofoper berufen.
ab 1889
Hofkapellmeister in Weimar.
Die symphonische Dichtung „Don Juan“ macht ihn zum wichtigsten jungen Komponisten in Deutschland.
1894
Auf einer Reise nach Ägypten komponiert Strauss seine erste Oper „Guntram“ mit eigenem Libretto.
Heirat mit der Sängerin Paulina de Ahna.
Rückkehr nach München als Erster Hofkapellmeister.
1895-1898
Die Vertonungen „Till Eulenspiegel“, „Also sprach Zarathustra“, „Don Quixote“ und „Ein Heldenleben“ entstehen.
Europäische Konzertreisen als Dirigent.
1898
Berufung als Kapellmeister an die Berliner Hofoper.
Strauss organisiert die „Genossenschaft deutscher Tonsetzer“.
1900
Bekanntschaft mit dem österreichischen Dichter Hugo von Hofmannsthal.
1905
Die Uraufführung seines bedeutendsten Bühnenwerkes, der Oper „Salomé“, in Dresden löst einen Skandal aus, da es vom Publikum für zu modern gehalten wird.
ab 1906
In Zusammenarbeit mit Hofmannsthal als Librettisten entstehen zahlreiche Opern.
1908
Generalmusikdirektor in Berlin und Leiter der Konzerte der Hofkapelle.
Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
1909
25. Januar: Uraufführung der Tragödie „Elektra“.
1911
26. Januar: Uraufführung der Komödie „Der Rosenkavalier“ unter Max Reinhardts Regie in Dresden.
1912
25. Oktober: Uraufführung von „Ariadne auf Naxos“ in Stuttgart. Die Oper ist als gemeinsamer Dank von Komponist und Dichter an Reinhardt gedacht.
1917
Strauss und Hofmannsthal sind mit Reinhardt und Franz Schalk (1863-1931) an der Gründung der Salzburger Festspiele beteiligt.
1919
Strauss wird gemeinsam mit Schalk Direktor der Wiener Staatsoper.
1924
Er überläßt Schalk die Direktion der Wiener Oper und lebt als freischaffender Komponist und Dirigent teils in Wien, teils in Garmisch-Partenkirchen.
1929
Nach dem Tod von Hofmannsthal hat Strauss Schwierigkeiten, einen passenden Textdichter zu finden.
1933
Unter den Nationalsozialisten wird er Präsident der Reichsmusikkammer.
1934
Sein Eintreten für den jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig, mit dem er eine Zusammenarbeit plant, bringt ihn in Schwierigkeiten mit den Machthabern. Er tritt von der Präsidentschaft der Reichsmusikkammer zurück.
1934-1945
Strauss ist als Gastdirigent an verschiedenen internationalen Opernbühnen engagiert. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet er in erster Linie als Dirigent in Bayreuth.
1935
Die Komische Oper „Die schweigsame Frau“ mit einem Libretto von Stefan Zweig entsteht.
1945
Nach Ende des Kriegs siedelt er in die Schweiz über.
1949
8. September: Richard Strauss stirbt in Garmisch-Patenkirchen.
Geschrieben von Uwe Roßner
von Archiv | 13.04.2007
„Die Oberläche“ feiert Uraufführung
Wenn alle den Mund öffnen und reden, scheinbar einander zuhören, viel eher Monologe vor sich her sagen, dann ist die Verändigung gestört. Das Gehör funktioniert einwandfrei, doch der Kopf ist nicht in der Lage aus seiner subjektiven Weltsicht herauszutreten und sich im Umgang mit anderen Menschen Mühe zu geben. Das richtige Gespräch will halt gelernt sein. Viel schlimmer aber, wenn verlernt wurde sich an die Vorraussetzungen gelungener Kommunikation zu halten.
 Vom Zustand auszugehen, das die Figuren im Stück „Die Oberfläche“ noch nie funktionierende Konversation betrieben ganz zu schweigen. Die Personen, durchnumeriert, weil nicht benannt, stehen symbolisch für die gesamte gesellschaftlichen fehlerhafte Kommunikation. In Zeiten immer neuerer technischer Spielereien der Übermittlung von Gedanken, Interessen und Wünschen stellt der polnische Autor Szymon Wróblewski in seinem Schauspiel eine Familie in den Vordergrund, die aufgrund vom falschen Zuhören, Hineininterpretieren in die Aussagen anderer zu Grunde geht. Vater und Mutter unterbrechen sich regelmäßig. Inhaltlich interessieren sich beide ebenfalls nicht für einander. Die Tochter steht zwischen den Stühlen. Einmal von der Mutter falsch verstanden, fällt sogleich das Beil des Henkers über den Vater. Der Vorwurf lautet Missbrauch der eigenen Tochter. Dem Beobachter ist nicht klar, ob das nicht gesehene, sondern nur von den Figuren ausgesproche wahr ist. Vielleicht fehlt es einem selbst an der Fähigkeit zuhören, besser verstehen zu können. Dies ist durch den Autoren beabsichtigt. Ein Blick in den alltäglichen Spiegel der menschlichen Monologe scheint „Die Oberfläche“ zu sein. Nur das Timing der Darstellenden auf der Bühne lässt sich außerhalb der Bühne nicht finden. Um zu wissen, wann der Einsatz des eigenen Selbstgesprächs trotz Zuhörender beginnt und endet, dazwischengesprochen werden kann, ist nicht einfach auswendig lernbar. Die einzelnen Rollen müssen verkörpert werden. Und sind.
Vom Zustand auszugehen, das die Figuren im Stück „Die Oberfläche“ noch nie funktionierende Konversation betrieben ganz zu schweigen. Die Personen, durchnumeriert, weil nicht benannt, stehen symbolisch für die gesamte gesellschaftlichen fehlerhafte Kommunikation. In Zeiten immer neuerer technischer Spielereien der Übermittlung von Gedanken, Interessen und Wünschen stellt der polnische Autor Szymon Wróblewski in seinem Schauspiel eine Familie in den Vordergrund, die aufgrund vom falschen Zuhören, Hineininterpretieren in die Aussagen anderer zu Grunde geht. Vater und Mutter unterbrechen sich regelmäßig. Inhaltlich interessieren sich beide ebenfalls nicht für einander. Die Tochter steht zwischen den Stühlen. Einmal von der Mutter falsch verstanden, fällt sogleich das Beil des Henkers über den Vater. Der Vorwurf lautet Missbrauch der eigenen Tochter. Dem Beobachter ist nicht klar, ob das nicht gesehene, sondern nur von den Figuren ausgesproche wahr ist. Vielleicht fehlt es einem selbst an der Fähigkeit zuhören, besser verstehen zu können. Dies ist durch den Autoren beabsichtigt. Ein Blick in den alltäglichen Spiegel der menschlichen Monologe scheint „Die Oberfläche“ zu sein. Nur das Timing der Darstellenden auf der Bühne lässt sich außerhalb der Bühne nicht finden. Um zu wissen, wann der Einsatz des eigenen Selbstgesprächs trotz Zuhörender beginnt und endet, dazwischengesprochen werden kann, ist nicht einfach auswendig lernbar. Die einzelnen Rollen müssen verkörpert werden. Und sind.
Geschrieben von Björn Buß
von Archiv | 13.04.2007
„Polarkreis 18“ von Polarkreis 18 (Motor)
Das Beeindruckende dieser Musik ist ihre Frische. Ein Bündel aus Klängen treibt den Hörer in genau eine Richtung: vorwärts. Perlende Gitarren, giftige Synthesizerfragmente und entgiftende E-Pianos, melodramatisch ausgeführte Streicherpassagen und brilliante Pop-Rhythmen. Unverwechselbarkeit entsteht jedoch vor allem durch das Phänomen der Polarkreis-18-Stimme Felix Räuber, denn da kommt man ins Rätselraten: Ist’s Mann, Frau, Kind oder einprogrammierte Vokalhysterie?
Das Songwriting und eine teilweise unkonventionelle Spurabmischung machen sich diese große Wandelbarkeit zunutze, setzten freundliche und träumerische Melodien gegen Passagen des emotionalen Ausbruchs. Eine stellenweise kindliche Aggressivität tritt in den Vordergrund, als gäbe es keine Grenze zwischen Unterbewusstsein und Kehlkopf, zwischen Bestürzung und Trotz. Und prompt überdeckt das dichte Netz kluger Arrangements die wieder in Traum gesunkene Stimme – alles muss vorwärts. Die zehn eigenständigen Songs geben erst nach und nach das Geheimnis preis, wo sie zusammengeräubert wurden. Mars Volta, Björk, Radiohead. Alles richtig, alles falsch. Entstanden ist diese Musik in Dresden in den letzten vier Jahren – und deshalb sei es erst am Ende verraten – in einer „Nachwuchsband“ starrsinniger Anfang-20Jähriger, die ihr Ding durchgezogen haben. Das Ding selbst produzierten. Das Ding zu einem Deal machten. Das Konzentrat des Albums lässt befürchten, dass das Ding jetzt ausgequetscht ist. Seine schöpferische Qualität lässt hoffen, dass es vorwärts geht.
Geschrieben von Robert Tremmel
 1952
1952
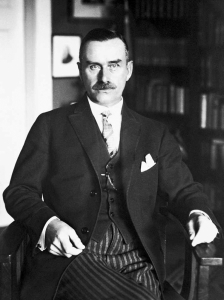 Der Musik fühlte sich Thomas Mann (1875 – 1955) Zeit seines Lebens verbunden. Durch den Gesang und das Klavierspiel der Mutter für sie interessiert. lernt er Violine. Sein technisches Können ist so weit entwickelt, dass er die Violinsonate Richard Strauss spielen konnte. Der spätere Träger des Literaturnobelpreises entschied sich für das Schreiben.
Der Musik fühlte sich Thomas Mann (1875 – 1955) Zeit seines Lebens verbunden. Durch den Gesang und das Klavierspiel der Mutter für sie interessiert. lernt er Violine. Sein technisches Können ist so weit entwickelt, dass er die Violinsonate Richard Strauss spielen konnte. Der spätere Träger des Literaturnobelpreises entschied sich für das Schreiben. 1864
1864 Vom Zustand auszugehen, das die Figuren im Stück „Die Oberfläche“ noch nie funktionierende Konversation betrieben ganz zu schweigen. Die Personen, durchnumeriert, weil nicht benannt, stehen symbolisch für die gesamte gesellschaftlichen fehlerhafte Kommunikation. In Zeiten immer neuerer technischer Spielereien der Übermittlung von Gedanken, Interessen und Wünschen stellt der polnische Autor Szymon Wróblewski in seinem Schauspiel eine Familie in den Vordergrund, die aufgrund vom falschen Zuhören, Hineininterpretieren in die Aussagen anderer zu Grunde geht. Vater und Mutter unterbrechen sich regelmäßig. Inhaltlich interessieren sich beide ebenfalls nicht für einander. Die Tochter steht zwischen den Stühlen. Einmal von der Mutter falsch verstanden, fällt sogleich das Beil des Henkers über den Vater. Der Vorwurf lautet Missbrauch der eigenen Tochter. Dem Beobachter ist nicht klar, ob das nicht gesehene, sondern nur von den Figuren ausgesproche wahr ist. Vielleicht fehlt es einem selbst an der Fähigkeit zuhören, besser verstehen zu können. Dies ist durch den Autoren beabsichtigt. Ein Blick in den alltäglichen Spiegel der menschlichen Monologe scheint „Die Oberfläche“ zu sein. Nur das Timing der Darstellenden auf der Bühne lässt sich außerhalb der Bühne nicht finden. Um zu wissen, wann der Einsatz des eigenen Selbstgesprächs trotz Zuhörender beginnt und endet, dazwischengesprochen werden kann, ist nicht einfach auswendig lernbar. Die einzelnen Rollen müssen verkörpert werden. Und sind.
Vom Zustand auszugehen, das die Figuren im Stück „Die Oberfläche“ noch nie funktionierende Konversation betrieben ganz zu schweigen. Die Personen, durchnumeriert, weil nicht benannt, stehen symbolisch für die gesamte gesellschaftlichen fehlerhafte Kommunikation. In Zeiten immer neuerer technischer Spielereien der Übermittlung von Gedanken, Interessen und Wünschen stellt der polnische Autor Szymon Wróblewski in seinem Schauspiel eine Familie in den Vordergrund, die aufgrund vom falschen Zuhören, Hineininterpretieren in die Aussagen anderer zu Grunde geht. Vater und Mutter unterbrechen sich regelmäßig. Inhaltlich interessieren sich beide ebenfalls nicht für einander. Die Tochter steht zwischen den Stühlen. Einmal von der Mutter falsch verstanden, fällt sogleich das Beil des Henkers über den Vater. Der Vorwurf lautet Missbrauch der eigenen Tochter. Dem Beobachter ist nicht klar, ob das nicht gesehene, sondern nur von den Figuren ausgesproche wahr ist. Vielleicht fehlt es einem selbst an der Fähigkeit zuhören, besser verstehen zu können. Dies ist durch den Autoren beabsichtigt. Ein Blick in den alltäglichen Spiegel der menschlichen Monologe scheint „Die Oberfläche“ zu sein. Nur das Timing der Darstellenden auf der Bühne lässt sich außerhalb der Bühne nicht finden. Um zu wissen, wann der Einsatz des eigenen Selbstgesprächs trotz Zuhörender beginnt und endet, dazwischengesprochen werden kann, ist nicht einfach auswendig lernbar. Die einzelnen Rollen müssen verkörpert werden. Und sind. 

