von Archiv | 15.04.2005
Über Hélène Grimaud, ihr Buch und ihre neue CD
Wolf oder Sonate? Für Hélène Grimaud wäre das keine Frage. Denn sie verbindet beides seit Jahren mit Leidenschaft: den Flügel für ihre Musik und die wilden Schmusetiere als Seelenverwandte während ihres Rückzugs in die Natur. Kein Wolfstick. Sondern eine aufrichtige Zuneigung, die zuletzt in ihrem Buch „Wolfssonate“ gipfelte.
Die Originalausgabe der bezaubernden Autobiographie „Variations sauvages“, wilde Variationen, erschien allerdings in Frankreich bereits vor zwei Jahren. Dennoch.
Neben dem Buch kehrte die 1970 in Aix-en-Provence geborene Pianistin im Februar mit ihrem ersten Solorecital für die Deutsche Grammophon in die hiesigen Landen zurück. Das Konzept „Tod und Transzendenz“ steht hinter den Klaviersonaten der Romantiker Frédéric Chopin (1810–1849) und Sergei Rachmaninov (1873–1943). Bei beiden jeweils die zweite. Chopins Berceuse in Des-Dur und Barcarolle in Fis-Dur runden das Ganze ab.
Was die Einspielung an Fragen offen ließ, beantwortete das ausverkaufte Konzert am 24. Februar im Großen Saal der Berliner Philharmonie. Der reißende Fluss von Noten war nicht gedankenlose Hast, sondern ein befreites Ausleben der komponierten Seelengemälde auf schwarzen und weißen Tasten.
Geschrieben von Uwe Roßner
von Archiv | 15.04.2005
Ob man in der Mensa sein Gegenüber von der Notwendigkeit des Nummerntausches überzeugen will, oder ob man an der Uni um gute Noten buhlt – sich zu verkaufen gehört zum täglichen Geschäft. Ricky, Shelley, George und Dave haben ihr Können zum Beruf gemacht. Sie sind Versicherungsvertreter. Man könnte auch sagen, sie prostituieren sich.
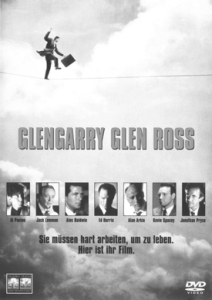 Ricky, gespielt von Al Pacino, ist der erfolgreichste von ihnen, die Spitze der firmeninternen Verkaufscharts, und wird von seinen Kollegen (Jack Lemmon, Alan Arkin und Ed Harris) dafür gehasst. Tempo kommt in die Sache, als das Firmenmanagement den Druck erhöht und einen Verkaufswettbewerb ausruft. Um den überlebenswichtigen Bonus zu erhalten, wird auch vor Raub und Betrug nicht zurückgeschreckt. Wer nicht verkauft, fliegt. Friss oder werde gefressen. Darwin lässt grüßen.
Ricky, gespielt von Al Pacino, ist der erfolgreichste von ihnen, die Spitze der firmeninternen Verkaufscharts, und wird von seinen Kollegen (Jack Lemmon, Alan Arkin und Ed Harris) dafür gehasst. Tempo kommt in die Sache, als das Firmenmanagement den Druck erhöht und einen Verkaufswettbewerb ausruft. Um den überlebenswichtigen Bonus zu erhalten, wird auch vor Raub und Betrug nicht zurückgeschreckt. Wer nicht verkauft, fliegt. Friss oder werde gefressen. Darwin lässt grüßen.
Regisseur James Foley machte sich mit „Die Kammer“ schon international einen Namen. Das Drehbuch ist eine Adaption von David Mamets gleichnamigem Bühnenstück. Der Theatercharakter ist deutlich spürbar: Der Film spielt nur an rund fünf verschiedenen Schauplätzen und ist dialoglastig. Brüskiert und mitunter entsetzt findet sich der Zuschauer in einem spannend gezeichneten Existenzkampf wieder.
Verfügbar ist der Film in Deutsch und Englisch. Soll sich allerdings auch die DVD gut verkaufen, muss an den Extras (3 Trailer) allerdings noch gefeilt werden. Ein Insider für alle, denen Blockbuster zu viel geworden sind.
Geschrieben von Joel Kaczmarek
von Archiv | 15.04.2005
Ein Semester in Greifswald
Wer kennt sie nicht, die typischen Eigenschaften eines jeden Erstsemester-Studenten: hochmotiviert, übereifrig, ahnungslos und im besten Fall auch wissbegierig. Wahrscheinlich werden sie auch deshalb von ihren Kommilitonen liebevoll „Erstis“ genannt. Ab Oktober 2004 sollte auch ich einer von ihnen werden. So begann ich mein erstes Studium an der EMAU. Im Gepäck: all die bekannten Erkennungsmerkmale.
 Mein erster Enthusiasmus verflog allerdings schon in der „Ersti-Woche“. Denn da hieß es anstehen und Geduld haben! Besonders am Tag der Begrüßung in beziehungsweise vor der Mensa. Als ich all die Neuankömmlinge dort das erste Mal auf einem Haufen sah, war mein erster Gedanke: Massenabfertigung! Wie am Fließband wurden wir unseren entsprechenden Studiengängen und Tutoren aufgeteilt. Doch dann stellte sich gerade dieses Gedränge als vorteilhaft heraus: Man fühlte sich alles andere als allein gelassen und konnte ganz einfach die ersten Kontakte knüpfen.
Mein erster Enthusiasmus verflog allerdings schon in der „Ersti-Woche“. Denn da hieß es anstehen und Geduld haben! Besonders am Tag der Begrüßung in beziehungsweise vor der Mensa. Als ich all die Neuankömmlinge dort das erste Mal auf einem Haufen sah, war mein erster Gedanke: Massenabfertigung! Wie am Fließband wurden wir unseren entsprechenden Studiengängen und Tutoren aufgeteilt. Doch dann stellte sich gerade dieses Gedränge als vorteilhaft heraus: Man fühlte sich alles andere als allein gelassen und konnte ganz einfach die ersten Kontakte knüpfen.
Danach ging es noch zu Fuß durch die Greifswalder Innenstadt. Da kam ich mir weniger als Erststudent sondern eher als Erstklässler vor. Mit Namenschild und Geschenkbeutel (Man könnte auch sagen: getarnte Zuckertüte) watschelte ich immer meinen Tutoren hinterher. Ich fand das sehr amüsant und tat das, was alle Erstis taten: Ja nicht den Anschluss verlieren!
Jetzt begann also, fern der Heimat, der „Ernst des Lebens“. Der entwickelte sich jedoch in den ersten Monaten entgegen meiner Vorstellungen. Mit welchen großen und kleinen Probleme man im Alltag und an der Uni aber auch konfrontiert wird: leerer Kühlschrank, bügeln, kaputter Fahrradschlauch, Konto im Minus, GEZ-Prüfer an der Haustür, vergessene Familiengeburtstage, radfahrer-unfreundliche Bordsteinkanten, Platzjagd im Hörsaal (zumindest am Anfang des Semesters), und touristenähnliche Orientierungslosigkeit an der Uni. Und das sind nur die Highlights! Umso stolzer war ich dann aber, wenn ich eines dieser Probleme erfolgreich beheben konnte.
Allgemeine Ahnungslosigkeit herrschte natürlich auch in meinem ersten Semester Studieren. Was bedeuten nur all die Abkürzungen wie „AStA“ oder „c.t.“? Wie funktioniert eine Kopierkarte? Was ist der „OPAC“? Und: Wieso gibt es in der Mensa immer eine lange und eine kurze Warteschlange an der Kasse?
Solche Fragen lassen einen vorkommen, als hätte man das Wort „Ersti“ direkt auf die Stirn tätowiert bekommen. Als es mir dann zu viele Fragen wurden, habe ich sie ganz einfach laut gestellt. Negative Erfahrungen habe ich damit nie gemacht. Ich bekam immer freundliche und hilfreiche Antworten von Mitarbeitern oder Kommilitonen.
Und dann kam der Tag, an dem dieses Tattoo verblasste. An einem der Hochschulinformationstage kam im Audimax ein junges Mädchen auf mich zu und fragte mich, wo das Theologische Institut sei. Jetzt sollte ich also antworten! Außer mir vor Begeisterung wurde mir erst im Nachhinein bewusst, was ich ihr eigentlich geantwortet hatte: „Nein, keine Ahnung, ich studier’ hier auch erst ein paar Monate.“ Ich weiß, nicht sehr hilfreich, aber ich sah für sie so aus, als hätte ich das wissen können! Allein das zählte für mich in diesem Moment.
Jetzt ist mein erstes Semester schon wieder vorbei. Die ersten Prüfungen sind geschrieben, die ersten Freundschaften entstanden und das anfängliche Heimweh (nahezu) verflogen. Und, das Wichtigste: Meine „Ersti“-Eigenschaften habe ich abgelegt und werde mein zweites Semester mit weniger Übereifer, dafür mit mehr Ahnung angehen!
Geschrieben von Anne Waldow
von Archiv | 15.04.2005
1865 erschienen die bekannten „sieben Streiche“ in einer Bildergeschichte in der Zeitschrift „Fliegende Blätter“ in München. Es war die erste und auch populärste Bildfolge von Wilhelm Busch, der sich damals damit seinen Lebensunterhalt sicherte.
Derweil träumte Busch zeitlebens davon, als ernsthafter und passionierter Maler anerkannt zu werden. Immerhin absolvierte er 1851-1854 eine professionelle Ausbildung zum Kunstmaler. Doch dieser Traum sollte sich nicht verwirklichen: Als Satiriker war er in seiner Epoche konkurrenzlos, aber als Kunstmaler blieb er zeitlebens ein Unbekannter. Unzufrieden über diese Situation schrieb er einst:
„Leicht kommt man an das Bildermalen,
doch schwer an Leute, die’s bezahlen.
Statt ihrer ist, als ein Ersatz,
der Kritikus sofort am Platz.“
Umso bedeutender waren und sind seine zahlreichen gemalten Bildergeschichten, die als Vorläufer der uns heute bekannten Comics gelten. Kurze, zugespitzte Texte und Bilder und eine an schwarzen Humor grenzende Komik zeichnen dabei alle Werke von Wilhelm Busch aus. Jedoch auch stets darauf bedacht, versteckte Kritik an dem status quo zu äußern.
Und wie immer in klassischen Geschichten siegt am Ende stets das Gute über das Böse, so dass Max und Moritz letztendlich auch das Zeitliche segnen. Dennoch sind die beiden Frechdachse bis heute nicht in Vergessenheit geraten und werden auch in Zukunft noch vielen Kindern und Erwachsenen ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. So auch die vielen anderen Geschichten, die zwar weniger bekannt, aber nicht weniger amüsant sind. Wie zum Beispiel „Fipps, der Affe“ oder „Die fromme Helene“.
1908, kurz nach dem Tod von Busch, veröffentlichte der Schriftsteller Ludwig Thoma einen Nachruf in der Zeitschrift „Simplizissimus“, in dem es heißt: „Er hat uns vieles gelassen, was lebendig bleiben wird.“ Dass die dreisten Streiche der beiden Schelme im Besonderen dazu zählen, ist unumstritten.
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, Max und Moritz!
von Archiv | 15.04.2005
„Milosevic’ Vater wurde vom Mittelschulreligionslehrer zum Russischlehrer, bevor er sich von den Felsen von Cattaro ins Meer stürzte. Seine Mutter erhängte sich, sein Onkel, der General, schoss sich mit zwei Revolvern stereo in den Kopf. Ein Transparent der Studentendemos ruft zur Bewahrung familiärer Traditionen auf.“
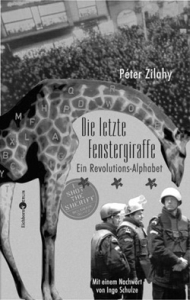 Péter Zilahy schreibt in seinem neuesten Buch voller Witz, Provokation und sowjetischer Nostalgie. Es geht um Revolution, um den Alltag des Lebens und Anekdoten, die einen schmunzeln lassen. Zilahy schreibt über ein fernes Land, eine scheinbar andere Welt und doch sind die Orte des Geschehens nicht weiter weg als Paris oder Wien.
Péter Zilahy schreibt in seinem neuesten Buch voller Witz, Provokation und sowjetischer Nostalgie. Es geht um Revolution, um den Alltag des Lebens und Anekdoten, die einen schmunzeln lassen. Zilahy schreibt über ein fernes Land, eine scheinbar andere Welt und doch sind die Orte des Geschehens nicht weiter weg als Paris oder Wien.
Ein „Revolutions-Alphabet“ heißt es, da der Autor das Buch wie ein Lexikon aufbaut. Es beginnt mit dem ersten Buchstaben des ungarischen, kroatischen, serbischen oder auch bosnischen Alphabets „a“ und endet mit dem letzten: „zs“. Der Titel des Werkes heißt deshalb „Fenstergiraffe“. Es bedeutet nichts anderes als „Ablak-Zsiráf“, womit die meisten Kinderlexika dieser Länder anfangen und enden. Zu jedem dieser Buchstaben sucht Péter Zilahy ein paar passende Wörter und fängt an zu erzählen. Über das Leben, die Diktatur, die Armee, die Revolution… Er lässt wenig aus und weiß immer mit einer Pointe abzuschließen.
„Die letzte Fenstergiraffe“: Eine Sammlung von Kurzgeschichten, die uns Teil der Revolution lassen werden.
Geschrieben von Kilian Jäger

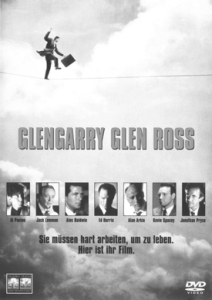 Ricky, gespielt von Al Pacino, ist der erfolgreichste von ihnen, die Spitze der firmeninternen Verkaufscharts, und wird von seinen Kollegen (Jack Lemmon, Alan Arkin und Ed Harris) dafür gehasst. Tempo kommt in die Sache, als das Firmenmanagement den Druck erhöht und einen Verkaufswettbewerb ausruft. Um den überlebenswichtigen Bonus zu erhalten, wird auch vor Raub und Betrug nicht zurückgeschreckt. Wer nicht verkauft, fliegt. Friss oder werde gefressen. Darwin lässt grüßen.
Ricky, gespielt von Al Pacino, ist der erfolgreichste von ihnen, die Spitze der firmeninternen Verkaufscharts, und wird von seinen Kollegen (Jack Lemmon, Alan Arkin und Ed Harris) dafür gehasst. Tempo kommt in die Sache, als das Firmenmanagement den Druck erhöht und einen Verkaufswettbewerb ausruft. Um den überlebenswichtigen Bonus zu erhalten, wird auch vor Raub und Betrug nicht zurückgeschreckt. Wer nicht verkauft, fliegt. Friss oder werde gefressen. Darwin lässt grüßen. Mein erster Enthusiasmus verflog allerdings schon in der „Ersti-Woche“. Denn da hieß es anstehen und Geduld haben! Besonders am Tag der Begrüßung in beziehungsweise vor der Mensa. Als ich all die Neuankömmlinge dort das erste Mal auf einem Haufen sah, war mein erster Gedanke: Massenabfertigung! Wie am Fließband wurden wir unseren entsprechenden Studiengängen und Tutoren aufgeteilt. Doch dann stellte sich gerade dieses Gedränge als vorteilhaft heraus: Man fühlte sich alles andere als allein gelassen und konnte ganz einfach die ersten Kontakte knüpfen.
Mein erster Enthusiasmus verflog allerdings schon in der „Ersti-Woche“. Denn da hieß es anstehen und Geduld haben! Besonders am Tag der Begrüßung in beziehungsweise vor der Mensa. Als ich all die Neuankömmlinge dort das erste Mal auf einem Haufen sah, war mein erster Gedanke: Massenabfertigung! Wie am Fließband wurden wir unseren entsprechenden Studiengängen und Tutoren aufgeteilt. Doch dann stellte sich gerade dieses Gedränge als vorteilhaft heraus: Man fühlte sich alles andere als allein gelassen und konnte ganz einfach die ersten Kontakte knüpfen.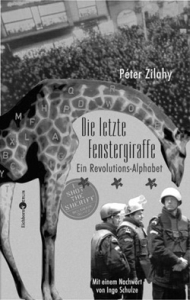 Péter Zilahy schreibt in seinem neuesten Buch voller Witz, Provokation und sowjetischer Nostalgie. Es geht um Revolution, um den Alltag des Lebens und Anekdoten, die einen schmunzeln lassen. Zilahy schreibt über ein fernes Land, eine scheinbar andere Welt und doch sind die Orte des Geschehens nicht weiter weg als Paris oder Wien.
Péter Zilahy schreibt in seinem neuesten Buch voller Witz, Provokation und sowjetischer Nostalgie. Es geht um Revolution, um den Alltag des Lebens und Anekdoten, die einen schmunzeln lassen. Zilahy schreibt über ein fernes Land, eine scheinbar andere Welt und doch sind die Orte des Geschehens nicht weiter weg als Paris oder Wien.

